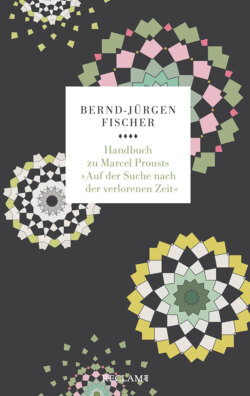Читать книгу Handbuch zu Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« - Bernd-Jürgen Fischer - Страница 12
ОглавлениеTitelblatt des ersten Teilbandes (von zwei) der ersten deutschen
Übersetzung von Bd. 1 durch Rudolf Schottlaender.
Übersetzungen
»Ein Französisch, in dem alle Wörter leicht und alle Sätze schwierig sind.« (The Spectator, 11. November 1922, anlässlich des Erscheinens von Scott-Moncrieffs Übersetzung von WS.)
Ins Deutsche
Der ›Entdecker‹ Prousts für Deutschland war sicherlich Rainer Maria Rilke, der bereits in einem Brief vom 21. Januar 1914 der Prinzessin Marie-Auguste von Thurn und Taxis die Lektüre empfahl31 und in einem Brief vom 3. Februar 191432 den Verleger Anton Kippenberg aufforderte, unverzüglich die Übersetzungsrechte für den Insel-Verlag zu sichern. Die erste öffentliche Stellungnahme zu Proust in Deutschland war aber wohl eine Studie des eminenten Romanisten Ernst Robert Curtius (1886–1956), die im Februar 1922 in der Zeitschrift Der Neue Merkur S. 745–761 erschien und von der Proust begeistert war (s. Prousts Brief an Curtius, Corr. XXI, S. 81, und dessen Antwort S. 128 f.). Fast zeitgleich (1923, aber Vorwort von Oktober 1922) erschien Victor Klemperers Die moderne französische Prosa, ein Studientext, in dem er Proust mit einem Ausschnitt aus Swann vorstellt (der letzte Abschnitt von Combray I) und die Passage vom »ungeheuren Bauwerk der Erinnerung« (WS, S. 70) mit den Worten kommentiert: »Man könnte die Formel aufstellen: Baudelaire + Bergson, doch ohne Bergsons Religiosität« (S. 301). Prousts literarische Bedeutung hat er offenbar nicht erkannt, obwohl er ihm die »Schluss- und Gipfelstellung« gibt: »Man wird in Marcel Prousts reichem und lockerem Skizzenbuch der modernen Seele kaum die große moderne französische Dichtung schlechthin sehen dürfen. Zu viel kühles und beklemmendes Spiel, zu viel bloßes Anschauen der Welt ohne den Versuch, einen Höhenweg in ihr zu finden, zu viel Religionslosigkeit der Haltung befremden mehr als der Verzicht auf Komposition eines Ganzen, als die Neuheit des Technischen. Aber ein Zeugnis für die Möglichkeiten der Verschmelzung von Romantik und Klassik ist das vielbändige und vielfältige Werk und weiter ein Zeugnis für den unversieglichen Reichtum und das ständig strömende Werden der französischen Dichtung« (S. 71 f.).
Einem breiteren deutschen Publikum wurde À la recherche du temps perdu eigentlich erst 1925 durch Curtius’ umfangreichen Essay Marcel Proust bekannt gemacht, der die ersten fünf Bände zum Gegenstand hat und als Teil seiner Monographie Französischer Geist im neuen Europa erschien (Einzeldruck 1955 bei Suhrkamp). Die Verzögerung lag freilich ebenfalls an Curtius, der es verstand, sein Territorium zu verteidigen und Proust dazu zu bewegen, allen Übersetzungsversuchen, so 1922 für die Tägliche Rundschau – »›Taëjlishes Roundschau‹ (excusez l’allemand de Céleste)« –, eine Absage zu erteilen, weil sie nicht Curtius’ Beifall fanden (s. Briefwechsel Proust–Gallimard, S. 517, 519, 525). Auf Anfrage des Berliner Verlages Die Schmiede, ob denn nicht Curtius selbst eine Gesamtübersetzung erstellen wolle, lehnte dieser jedoch ab. Nach diesem »Korb« betraute der Verlag den Philologen Rudolf Schottlaender (1900–88) mit der Übersetzung und publizierte 1926 den ersten Band des Gesamtprojekts Auf den Spuren der verlorenen Zeit unter dem Titel Der Weg zu Swann in zwei Teilbänden.33 Diese Ausgabe wurde – man ist versucht zu sagen: erwartungsgemäß – von Curtius so unmäßig verrissen, dass auf Druck von Gallimard der deutsche Verlag die Fortführung des Vorhabens an Walter Benjamin (1882–1940) und Franz Hessel (1880–1941) übertrug. Deren Band II, Im Schatten der jungen Mädchen, erschien 1927. Nachdem der Berliner Verlag 1929 den Betrieb einstellen musste, übernahm der Piper-Verlag München das Proust-Projekt; hier erschien 1930 in der Benjamin/Hessel-Übersetzung (in zwei Teilbänden) der dritte Band, Die Herzogin von Guermantes. Der heraufziehende Faschismus setzte dem Versuch, einen ausländischen und zudem halbjüdischen Autor in Deutschland zu publizieren, ein Ende; das Manuskript zur Übersetzung von Sodome et Gomorrhe, das Notizen Benjamins zufolge bereits 1926 fertig gewesen sein soll, ist verschollen.
1953 verkaufte der Verleger Peter Suhrkamp sein Haus in Kampen auf Sylt an das Verlegerehepaar Axel und Rosemarie Springer, um liquide genug zu sein, die Rechte an der deutschen Übersetzung vom Piper-Verlag erwerben zu können. Hier war wohl auch der Suhrkamp-Autor Hermann Hesse ein moralischer Motor, der schon seit 1925 gedrängt hatte, die »Gespinste dieses zarten Dichters«34 endlich vollständig ins Deutsche zu übertragen. Noch im gleichen Jahr stellte Suhrkamp die Literaturwissenschaftlerin Eva Rechel-Mertens (1895–1981), die bei Ernst Robert Curtius promoviert hatte, in seinem Verlag ein mit dem ausschließlichen Auftrag, eine Neu- bzw. Erstübersetzung von À la recherche du temps perdu zu erstellen; diese wurde 1957 abgeschlossen. Die Hilfsmittel, die ihr als Angestellte in einem Verlag zur Verfügung standen, erklären das erstaunliche Tempo, mit dem sie sich ihrer Aufgabe entledigte. Doch noch während Rechel-Mertens mit dem ersten Band beschäftigt war, erschien in Frankreich in Gallimards Reihe Bibliothèque de la Pléiade die von Clarac/Ferré überarbeitete, textkritisch kommentierte Neuausgabe der Recherche, die Rechel-Mertens dann ihrer Übersetzung zugrunde legte, notgedrungen erst nach dem ersten Band; dass der erste Band noch auf der EA beruht, ist jedoch nicht weiter problematisch, da bei diesem Band die Unterschiede zwischen dem Text der EA und der Clarac/Ferré-Fassung ohnehin marginal sind. Die erneute umfassende Revision des französischen Textes durch Tadié in den 1980er Jahren, die sich vor allem durch Neufassungen in den Texten der postumen Bände auszeichnete, machte allerdings auch eine Überarbeitung der deutschen Übersetzung erforderlich. Diese Aufgabe übernahmen Luzius Keller und Sybilla Laemmel 1994–2004 im Rahmen einer Gesamtausgabe der Werke Prousts bei Suhrkamp, die zudem mit Editionsberichten, Anmerkungsapparat, Namenverzeichnis und Bibliographie ausgestattet wurde.
2002 legte der Autor Michael Kleeberg mit Combray eine Übersetzung der ersten Hälfte des ersten Bandes vor, der 2004 die zweite Hälfte unter dem Titel Eine Liebe Swanns folgte.
Zu den Übersetzungen der Vorveröffentlichungen von Auszügen aus der Suche durch Hanno Helbling siehe oben, »Vorveröffentlichungen«.
Zur Reclam-Übersetzung
Die in den Bänden I bis VII der Reclam-Ausgabe vorgelegte Übersetzung hat sich zum Ziel gesetzt, die Sprache Prousts so, wie der Übersetzer sie im französischen Text gehört hat, auch im Deutschen zum Ausdruck zu bringen. Die Verwirklichung dieses Vorhabens ist natürlich nur auf einer sehr abstrakten Ebene möglich, denn dass das Französische anders klingt als das Deutsche, ist bekannt. Und so zeigen sich die ersten Fallstricke auch schon auf phonetischer Ebene, etwa bei den Händlerrufen in G, wenn der Ruf des Glasers »le vitri–, le vitri–er« mit seinen spitzen »i« unverzüglich Glasscherben assoziieren lässt – eine Assoziation, die im Schriftbild noch durch die Gestalt der »i« mit den Splittern ihrer Punkte unterstützt wird –, während das deutsche »Gla–, der Gla–ser« eher Gemütlichkeit transportiert. Ein ähnliches Problem stellt sich in großräumigerer Ausprägung bei der Aufführung von Vinteuils Sonate für Piano und Violine in WS, in deren Beschreibung Proust einen Absatz mit überdurchschnittlich vielen »p« und »f« ausstattet, offenkundig, um die Anschläge des Pianos und die Striche der Violine zu Gehör zu bringen – wobei dem Frikativ »ph« in »phrase«/»Phrase« offenbar eine Gelenkfunktion zwischen den Instrumenten zukommt, wie ja auch das Wort »phrase«/»Phrase« selbst als Gelenk zwischen dem Sprachlichen und dem Musikalischen fungiert:
Elle reparut, mais cette fois pour se suspendre dans l’air et se jouer un instant seulement, comme immobile, et pour expirer après. Aussi Swann ne perdait-il rien du temps si court où elle se prorogeait. Elle était encore là comme une bulle irisée qui se soutient. Tel un arc-en-ciel, dont l’éclat faiblit, s’abaisse, puis se relève et avant de s’éteindre, s’exalte un moment comme il n’avait pas encore fait: aux deux couleurs qu’elle avait jusque-là laissé paraître, elle ajouta d’autres cordes diaprées, toutes celles du prisme, et les fit chanter.
Swann n’osait pas bouger et aurait voulu faire tenir tranquilles aussi les autres personnes, comme si le moindre mouvement avait pu compromettre le prestige surnaturel, délicieux et fragile qui était si près de s’évanouir. Personne, à dire vrai, ne songeait à parler. La parole ineffable d’un seul absent, peut-être d’n mort (Swann ne savait pas si Vinteuil vivait encore) s’exhalant au-dessus des rites de ces officiants, suffisait à tenir en échec l’attention de trois cents personnes, et faisait de cette estrade où une âme était ainsi évoquée un des plus nobles autels où pût s’accomplir une cérémonie surnaturelle. De sorte que quand la phrase se fut enfin défaite flottant en lambeaux dans les motifs suivants qui déjà avaient pris sa place, si Swann au premier instant fut irrité de voir la comtesse de Monteriender, célèbre par ses naïvetés, se pencher vers lui pour lui confier ses impressions avant même que la sonate fût finie, il ne put s’empêcher de sourire, et peut-être de trouver aussi un sens profond qu’elle n’y voyait pas, dans les mots dont elle se servit.
Ein solches onomatopoetisches Spiel ließe sich in der Übersetzung nur auf Kosten der Semantik reproduzieren. In solchen Fällen heißt es abzuwägen, wie weit man dabei gehen sollte. In diesem Fall schien mir eher Zurückhaltung geboten, da auch die wenigsten französischen Leser diesen Kunstgriff überhaupt bemerken:35
Sie kehrte wieder, doch dieses Mal nur, um fast reglos in der Luft zu schweben, einen Augenblick ihr Spiel zu treiben und dann zu ersterben. Deshalb versäumte Swann nichts von dieser so kurzen Zeit, die sie verweilte. Sie war noch immer da, wie eine irisierende Seifenblase, die nicht vergeht. Wie ein Regenbogen, dessen Pracht verblasst, versinkt, dann wieder erblüht, bevor er gänzlich erstirbt, sich für einen Augenblick begeistert erhebt wie noch niemals zuvor: So fügte sie den beiden Farben, die sie bisher nur hatte erblicken lassen, andere schillernde Bänder, alle jene des Prismas hinzu und ließ sie erklingen.
Swann wagte nicht, sich zu rühren, und hätte auch gern die anderen Leute zur Ruhe gebracht, als hätte die leiseste Bewegung den übernatürlichen, lieblichen und zerbrechlichen Nimbus gefährden können, der doch so nah daran war zu vergehen. Tatsächlich jedoch dachte niemand daran, zu sprechen. Das unsagbare Wort eines einzelnen Abwesenden, vielleicht eines Toten (Swann wusste nicht, ob Vinteuil noch lebte), das über den kultischen Handlungen dieser Zelebranten atmete, genügte, die Aufmerksamkeit der dreihundert Personen gebannt zu halten, und machte aus diesem Podium, auf dem eine Seele also beschworen wurde, einen der erhabensten Altäre für den Vollzug eines übernatürlichen Rituals. Dieser Eindruck war so stark, dass Swann, als die Phrase sich schließlich auflöste und in Bruchstücken durch die folgenden Motive flatterte, die bereits an ihre Stelle getreten waren, zwar im ersten Augenblick irritiert war, als er die Gräfin von Monteriender, berühmt für ihre Naivität, sich zu ihm neigen sah, um ihm ihre Eindrücke sogar noch vor dem Ende der Sonate anzuvertrauen, sich dann aber eines Lächelns nicht enthalten konnte, wohl auch, weil er in den Worten, deren sie sich bediente, noch einen tieferen Sinn fand, den sie nicht darin sah. (WS, S. 483 f.)
Anders etwa bei dem Martinville-Aufsatz in WS (S. 252 f.), der rhythmisch stark gebunden ist und deshalb in SJM auch als »Prosagedicht« bezeichnet wird. Da dieses Merkmal insbesondere dazu dient, das etwas Schülerhaft-Eklektische dieses Marcelschen Erstlings zu transportieren, schien es mir wichtig genug, bei der Wortwahl gegebenenfalls Konzessionen an die Präzision zu machen, um hier auch im Deutschen einen naiv-plätschernden Tonfall zu erzielen.
Sein Interesse an den musikalischen Aspekten der Sprache machte Proust schon in dem Essay Mélancolique villégiature de Madame des Breyves36 explizit; in der Suche wird es ganz allgemein im Gebrauch der Satzzeichen deutlich und kommt konzentriert in den »cris de Paris« der Gefangenen zum Ausdruck. Die Kommasetzung in der Recherche ignoriert großzügig die »logischen« Regeln der französischen Grammatik und orientiert sich primär gleich den Atempausen im Gesang an rhythmischen Merkmalen; dies im Deutschen nachbilden zu wollen erwies sich jedoch als heikles Unterfangen, denn da die Intonationsstrukturen im Deutschen von anderen Regeln geleitet werden als im Französischen, könnte eine prosodische Kommasetzung im Deutschen nicht mehr die des Autors sein, sondern wäre zwangsläufig die des Übersetzers, der sich damit etwas zu sehr in den Vordergrund spielen würde; zudem ist eine Kommasetzung, die sich nicht dem Duden unterwirft, jenseits historischer Orthographie in wissenschaftlichen Editionen in Deutschland kaum plausibel zu machen. Im übrigen aber orientiert sich die Punktuation gänzlich – bis auf eine Ausnahme – an der Textvorlage. Die Sätze blieben durchweg unangetastet, Semikola blieben Semikola, Klammereinschübe und Einschübe zwischen Gedankenstrichen wurden originalgetreu wiedergegeben. Die Ausnahme bilden einige Einschübe, die bei Proust nur durch Kommata eingefasst sind; hier legte dann gelegentlich der andere Satzbau des Deutschen dem Leser eine falsche Vermutung über den Fortgang des Satzes nahe. In solchen Fällen hielt ich es für besser, die Kommata durch Gedankenstriche zu ersetzen.
In den »cris de Paris« (G, S. 153–157, 167–173, 182–184) werden die Händlerrufe, die Marcel in seinem Schlafzimmer von der Straße hereindringen hört, explizit in Bezug zu melodischen Strukturen der Gregorianik und zum Parlando bestimmter Opern gesetzt. Hier war natürlich Sorge zu tragen, dass die Übertragung der Rufe dann auch den beschriebenen Merkmalen entspricht. Zudem verleiht Proust den »cris« (auch: ›Schreie‹) eine gewisse Straßen-Authentizität, indem er sie mit derb-erotischen Konnotationen befrachtet. Um diesen beiden Aspekten Genüge tun zu können, waren gelegentlich Eingriffe vor allem auf lexikalischer Ebene notwendig, wenn eine deutsche Entsprechung einfach nicht passt oder nichts hergibt (z. B. »Römersalat« oder »Artischocke«, die durch »Feige« bzw. »Pflaume« ersetzt wurden). Um solche Behelfe zu vermeiden, hatte ich anfangs erwogen, die Rufe im Text auf Französisch stehen zu lassen und nur in den Anmerkungen eine wortgetreue Übersetzung anzubieten. Dies hätte aber den meines Erachtens erheblichen Nachteil gehabt, dass ein Leser, der nicht das Französische beherrscht – und von dem muss der Übersetzer natürlich ausgehen – dieses Glanzstück der Recherche (und ich hoffe, auch der Suche) nicht als die verliebte Komposition für ein Solo-Instrument, die Sprache nämlich, zu lesen, zu hören und zu genießen vermöchte, die es für französische Leser darstellt.
In rhythmischer Hinsicht bilden die deutschen Hilfsverben ein ständiges Ärgernis: während sich im Französischen auch bei längeren, im Perfekt oder Plusquamperfekt gehaltenen Passagen die Formen zu »avoir« mit ihren weichen oder gar nicht vorhandenen Konsonanten prosodisch im Hintergrund halten, gehen die deutschen Hilfsverbformen gern auf stimmlose Plosive und womöglich obendrein noch Frikative aus (»bist«, »hattest«) und drängen sich so verstärkt ins Bewusstsein, was die Sätze dann leicht ins Stampfen bringt. Um einer linguistischen Seekrankheit beim Leser vorzubeugen, habe ich gelegentlich den einen oder anderen Teilsatz ins Passiv transformiert, um wenigstens einen Wechsel zwischen den Formen von »haben« und »sein« zu erzielen.
Ein bekanntes Problem bei Übersetzungen aus dem Französischen bilden die Partizipialkonstruktionen, die zwar eine kompakte Ausdrucksgestaltung erlauben, aber im Deutschen für ungeschickt gelten und deshalb im allgemeinen in Relativsätze aufgelöst werden. Damit ist jedoch eine Erhöhung der syntaktischen Komplexität verbunden, was bei der Startbasis, die Proust vorgibt, wenig wünschenswert ist. Erfreulicherweise benutzt Proust aber gelegentlich auch Konstruktionen, bei denen man sich fragt, ob es nicht auch einfacher geht. Hier bietet sich dann die Möglichkeit, ein wenig Ausgleich zu schaffen. Die Auflösung der Partizipialkonstruktionen in Relativsätze sollte man allerdings nicht zum Prinzip erheben, denn häufig verbindet sich damit auch ein Verlust an Dynamik. So habe ich etwa dem längsten Satz der Recherche (SG, S. 28 ff., »Ohne mehr als eine zerbrechliche Ehre …«) schließlich die verpönten Partizipien belassen, da alle meine Versuche, sie zu vermeiden, dem Satz (dessen Matrixsatz übrigens die finite Verbform fehlt) die Spannkraft ausgetrieben hatten.
Obwohl das Französische und das Deutsche so eng verwandte Sprachen sind, zeigen sich bei der Genuszuordnung, die doch sprachhistorisch im allgemeinen recht stabil ist, erhebliche Unterschiede: man denke nur an le/die »Tour de France«. Dies hat weitreichende Konsequenzen, denn der Zusammenhalt der verschiedenen Teile eines Satzes wird ganz wesentlich über Kongruenzen gestiftet, d. h. durch Übereinstimmungen (oder eben Unterschiede) zwischen den Genus-Markierungen der Nomen und Pronomen des Satzes. Durch die Übersetzung wird aber gelegentlich verschieden, was gleich war, was kein Problem ist, und leider häufig auch gleich, was verschieden war: das kann dann den ganzen Satz durcheinanderbringen. Mit etwas Glück findet man zwar für dieses oder jenes Wort ein Synonym mit passenderem Genus, aber meist lässt sich nicht vermeiden, den Satz umzubauen, um ein Nomen aus dem Fokus eines Pronomens zu entfernen, in den es nicht gehört, oder um es umgekehrt in den Fokus des zugehörigen Pronomens hineinzurücken. Je komplexer der Ausgangssatz, desto umfassender im allgemeinen die Umbauarbeiten. Dabei treten natürlich auch Konflikte auf, wenn z. B. Proust eine Konstituente ans Satzende rückt, um ihr mehr Gewicht zu verleihen, sie im Deutschen an dieser Stelle aber aus Kongruenzgründen nicht stehen bleiben kann. Solche Erwägungen haben allerdings untergeordneten Stellenwert, da im Französischen die Prominenz der Endposition auch weitgehend durch die Neigung der französischen Sprache zur Endbetonung bedingt ist, während man bei den deutschen Satzenden mit ihrer Tonsenkung eher aufpassen muss, dass sie einem nicht allzu abrupt abstürzen (weshalb ich gelegentlich eine Partikel einfüge oder zu einer Langform greife, um eine Silbe zu gewinnen) oder sich in Gemurmel verlieren.
In lexikalischer Hinsicht habe ich mich insbesondere bei Fremdwörtern im Zweifelsfall am Verwendungsstatus eines Wortes orientiert, über den man sich ja heute mit Hilfe von Suchmaschinen mühelos ein einigermaßen repräsentatives Bild verschaffen kann. Wenn etwa Sachs/Villatte für »métempsycose« kommentarlos »Metempsychose« und »Seelenwanderung« nebeneinander anbieten, und umgekehrt für »Seelenwanderung« »métempsycose« und »migration des âmes«, dann zeigt ein Vergleich der Trefferhäufigkeiten, dass vom Gebrauchswert her der »métempsycose« mit Abstand die »Seelenwanderung« entspricht, der »Metempsychose« dagegen eher die »migration des âmes«. Häufig ist es allerdings auch so, dass sich Fremdwörter im Französischen ganz anders in einen Satz einschmiegen als im Deutschen, wenn sie Sprachen entstammen, die dem Französischen eng verwandt sind. So wird »chimisme« im Französischen kaum mehr als Fremdwort empfunden (obwohl es aus dem Lateinischen stammt, letztlich sogar aus dem Altägyptischen), während »Chemismus« im Deutschen stilistisch deutlich aus dem Rahmen fällt. In solchen Fällen habe ich es vorgezogen, zu Umschreibungen zu greifen – womit ich freilich das Fremdwort nicht vom Dienst suspendieren möchte. Denn bei anderen Gelegenheiten, wie etwa dem Wilhelm Meister-Pastiche in WG (S. 344 f.), wo goethisches Lokalkolorit aufgelegt werden muss, kann ein vollmundiges Fremdwort (»Kreszenz«) äußerst gelegen kommen. Generell habe ich mich, wie auch Proust selbst (vgl. das Motto zu diesem Kapitel), darum bemüht, lexikalisch den Ball flach zu halten – die Steilvorlagen liefert ja schon die Syntax – und damit die Sprache jener Salonatmosphäre fernzuhalten, in der sich der Proust der Freuden und Tage (»ich verleugne sie«)37 noch zu Hause fühlte: »Ich würde begrüßen, wenn [wie in den Rezensionen zu Freuden und Tage] die Epitheta ›feinsinnig‹ [›fin‹] oder ›empfindsam‹ [›délicat‹] ebenso wenig vorkämen wie Hinweise auf Freuden und Tage – dies hier [Swann] ist ein Werk der Kraft«, mahnt Proust den Herausgeber des Figaro, Gaston Calmette,38 und den Kriker René Blum weist er ausdrücklich auf den »›changé‹ et ›grandi‹«, den »›veränderten‹ und ›gewachsenen‹« Marcel hin, der ihm in der Suche nach der verlorenen Zeit begegnen wird.39 Ein Wort wie »Antlitz« etwa, das in der Rechel-Mertens/Keller-Übersetzung neunzigmal vorkommt, wäre geeignet, einem Text ein goethisches Flair zu verleihen, das dem reifen Proust nicht mehr steht; allerdings ist es auch kein Wort, auf das man mit leichter Hand verzichten könnte, denn neunmal habe ich es selbst auch für das Wort der Wahl angesehen.
Ein scheinbar untergeordnetes lexikalisches Problem bilden bei Proust die Wortwiederholungen. Er benutzt sie (in den Teilen, die er noch selbst durchgesehen hat) als Instrument, einem Satz, einer Passage und sogar dem ganzen Text ein konzeptuelles Zentrum zu verschaffen. Als Beispiel für einen Satz sei etwa auf den von »Blaubarts Zimmern« (so Michel Butor) in WS hingewiesen (S. 15 f., »Aber bald hatte ich …«), der um das Verb »creuser« (in der Übers.: »ausheben«) kreist, um das Motiv vom Bett als Grab zu konturieren, für eine längere Passage auf das »Diner Norpois« in SJM, dessen »Komposition« von dem Wort »composition« gekennzeichnet ist (S. 26–47), um auf die im Hintergrund stehende »composition« = »Aufsatz« zu verweisen, Marcels Martinville-Essay nämlich – der dann ironischerweise als einziges nicht als »composition«, sondern als Prosagedicht (»poème en prose«) auftritt. Hier wird das Problem deutlich, dass Allerweltswörter wie »creuser« oder »composition« je nach Zusammenhang verschieden übersetzt werden können und im allgemeinen auch sollten, hier aber wegen der speziellen Wiederholungsfunktion gleichartig behandelt werden müssen, will man nicht einen wichtigen Aspekt des Textes verschenken. In solchen Fällen nehme ich dann schon einmal leichte Schiefigkeiten im Ausdruck in Kauf: So würde man gemeinhin kaum von der »Komposition« eines Aktienpakets sprechen. – Zu einem textübergreifenden Leitbegriff s. die Bemerkungen zu »doute« S. 25 und S. 241. Den Wortwiederholungen in den späteren Bänden, insbes. E und WZ, lässt sich allerdings in den meisten Fällen schwerlich eine gestalterische Funktion zusprechen; hier handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach einfach um unkorrigiertes Material.
Der Erzähler der Suche ist im allgemeinen in einem Monolog befangen, doch gelegentlich wendet er sich auch mit Verve an den Leser. In Sodom und Gomorrha II,1 etwa entspinnt er sogar ein fiktives Zwiegespräch mit dem Leser über das mangelhafte Namengedächtnis des jungen Mannes, »›der der Autor‹« war bzw. »›der Ihr Held war, falls Sie es nicht selber sind.‹ – ›Das ist in der Tat sehr fatal, werter Herr Leser‹« (S. 75). Diese Erzählereingriffe werfen gewisse Übersetzungsschwierigkeiten auf, denn da das Französische häufig mit dem definiten Pronomen »vous« (»Sie«/»Ihr«/»ihr«) auch ausdrückt, was im Deutschen im Nominativ mit dem indefiniten »man« bzw. in den anderen Kasus mit »eines«/»einem«/»einen« ausgedrückt wird, bleibt an solchen Stellen unklar, eben weil direkte Erzählereingriffe keine Seltenheit sind, ob nicht auch bei diesen Formulierungen eine direkte Leseransprache intendiert ist. Ein typischer Fall, in dem dann auch die verschiedenen Übersetzungen zu verschiedenen Lösungen gekommen sind, ist etwa die Beschreibung der Aufführung eines Prélude von Chopin bei Madame de Saint-Euverte in WS II: »pour […] vous frapper au cœur« – um »Sie« (von mir lange bevorzugt), um »dich« (Schottlaender), um »einen« (Rechel-Mertens) oder um »uns« (S. 456) ins Herz zu treffen? Da der Fall häufiger vorkommt, wird jede starre Lösung auch das Gewicht von Erzählereingriffen verschieben und die Suche damit mehr oder eben weniger dem auktorialen Roman annähern, für den eine gewisse Distanz zwischen dem Erzähler und seiner Erzählung charakteristisch ist. Letztlich muss der Übersetzer von Fall zu Fall entscheiden und sich dabei auf sein Gefühl für Angemessenheit verlassen.
Zur Gretchenfrage der Übersetzungstheorie: »Wie hältst du’s mit den Redewendungen?«, gibt es im wesentlichen zwei Antworten: man übersetzt die Wendung wortgetreu, um die Metaphorik der Quellsprache zu erhalten und damit die Weltsicht ihrer Sprecher abzubilden (»Der frühe Vogel fängt den Wurm«), oder aber man sucht eine Wendung in der Zielsprache, die das in Rede stehende Konzept zum Ausdruck bringt (»Morgenstund hat Gold im Mund«). Beide Lösungen sind unbefriedigend: bei der ersten hat man oft das Gefühl, die »Übersetzung« überhaupt erst noch übersetzen zu müssen, bei der zweiten dagegen, dass die Wendung einfach nicht zu den Personen passt, denen sie in den Mund gelegt wird, die ja trotz aller Übersetzerei weiterhin Engländer, Franzosen, eben Angehörige der Sprechergemeinschaft der Quellsprache bleiben. Wie so häufig in den Geisteswissenschaften ist auch hier mit allgemeinen Rezepten nicht viel zu holen. Für gewöhnlich bemühe ich mich, Redewendungen so wörtlich wie möglich zu übersetzen, mich dabei aber an Wendungen, die im Deutschen zur Verfügung stehen, anzuschmiegen. Wenn etwa Albertine ausruft: »Tu me mets aux anges«, so wäre die sinngemäße Übersetzung »du bringst mich zum Höhepunkt« arg akademisch angesichts der Situation, die wörtliche »du bringst mich zu den Engeln« im Deutschen aber zu unüblich. Die Lösung »du bringst mich in den siebten Himmel« (E, S. 157), für die ich mich schließlich entschieden habe, versucht, beiden Aspekten gerecht zu werden, weist allerdings die Schwäche auf, dass es auch im Französischen die Wendung vom siebten Himmel (»septième ciel«) gibt, die Albertine ja aber nicht benutzt hat.
Auf dieses Problem der Erhaltung von Lokalkolorit bei Übersetzungen geht Proust übrigens selbst in Sodom und Gomorrha ein, wenn er von den nicht wiedererkennbaren »korrekten« Namen bei Mardrus und dem »entstellten Titel« auf dessen Tausendundeiner Nacht spricht (S. 323 f.), nämlich »Mille nuits et une nuit« – was dem arabischen Titel »alf laila wa-laila«, ›Tausend Nacht und Nacht‹, mehr oder weniger wörtlich entspricht und wohl den breit angelegten orientalischen Erzählerduktus signalisieren soll, damit aber etwas in den Titel legt, was im Original so nicht vorhanden ist, denn »alf laila wa-laila« ist einfach nur die grammatisch richtige Ausdrucksweise, um auf Arabisch »tausendundeine Nacht« zu sagen – und wie Galland es auch mit »Mille et une nuits« wiedergibt.
Bei Zitaten aus anderen französischen Sprachkunstwerken, die ja meist auch in deutscher Übersetzung vorliegen, hatte ich ursprünglich vor, jeweils diese etablierten Übersetzungen anzuführen; es stellte sich aber bald heraus, dass Proust diese Zitate aus inhaltlichen Gründen wählt, für den Übersetzer von Gedichten oder Theaterstücken jedoch häufig ganz andere Merkmale, wie Lautung, Reim oder Rhythmus, im Vordergrund stehen, so dass ein Zitat der entsprechenden Stelle der deutschen Übersetzung oft nicht das enthält, weswegen sie von Proust überhaupt erst angeführt wurde. Ich habe daher sehr häufig auch Zitate selbst übersetzt; wo ich übernehmen konnte, habe ich das getan und in den Anmerkungen vermerkt. Bei Zitaten aus einem klassischen griechischen oder lateinischen Text kommt noch hinzu, dass er bereits auf französischer Seite in mehreren verschiedenen Übersetzungen vorliegt, man aber nicht immer weiß, welche Proust benutzt oder gekannt hat, und dann im Deutschen ebenfalls mehrere Übersetzungen mit ganz verschiedenen Auffassungen der Übersetzer vorliegen (man denke nur an Ovids Metamorphosen). Hier habe ich mich im allgemeinen für die Übersetzung entschieden, die dem »kanonischen« Textverständnis am nächsten kommt, wie es bei Roscher40 (für die Auffassung zu Prousts Zeiten) und bei Pauly41 (für die moderne Sicht) umrissen wird.
Generell werfen intertextuelle Anspielungen die Frage auf, wie viel des anderen Textes denn »mitgemeint« ist und damit, wie eng man am Wortlaut bleiben oder wie weit man sich von ihm entfernen muss, um die Intention des Autors einzufangen. Wenn Proust etwa in WZ, S. 229, vom »enfarinement« bestimmter Parteien nach dem Krieg schreibt (›Einmehlung‹, im Text als »in Mehl gewälzt« übersetzt), wie es die Katze in La Fontaines Fabel Die Katze und die alte Ratte (1668) zum Zweck der Camouflage macht, so würden wir im Deutschen im allgemeinen wohl eher sagen, dass die fraglichen Parteien »Kreide gefressen« hätten, wie der nach Geißen lüsternde Wolf in Grimms Märchen. Ob man aber mit einer Übersetzung zugleich eine so weitgehende Transformation auch des kulturellen Bezugsrahmens vornehmen sollte, erscheint mir höchst zweifelhaft, besonders insofern, als damit ja meist noch weitere Verschiebungen verbunden sind, in diesem Beispiel etwa der Charakterisierung der in Rede stehenden Parteigruppierung als einer »Katze« hin zu einem »Wolf«, zwei Konzepte, die mit ganz verschiedenen Assoziationsfeldern ausgestattet sind, wie ein Blick in Lexika deutscher oder französischer Redewendungen unmittelbar vor Augen führt. Im vorliegenden Fall legt allerdings der für den Proust-Leser unsichtbare Text La Fontaines eine bestimmte Entscheidung äußerst nahe: Die Ratte der Fabel bezeichnet die getarnte Katze als »bloc enfariné«, als ›mehlbepuderten Block/Klumpen‹, und die politische Gruppierung, um die es Proust geht, ist der »bloc national«, der ›nationale Block‹.
Ein eher persönliches Problem des Übersetzens, das sich wohl kaum umgehen lässt, liegt in der Tatsache, dass der Übersetzer im allgemeinen das Werk, das er übersetzt, sehr viel besser kennt als jeder Erstleser und er sich deshalb gelegentlich überlegen muss, ob er sich für eine Lösung entscheiden will, die von vielen vermutlich nicht nachvollzogen werden kann, da ihnen die nötige Vertrautheit mit dem Text fehlt, oder sich sicherheitshalber doch lieber mit einer weniger markanten, konventionellen Lösung begnügen sollte, die keine Fragen aufwirft. Wenn sich etwa gleich zu Beginn von WS der Erzähler »völlig zerschlagen« fühlt von der Last der »taille« einer erträumten Eva, so liegt es natürlich nahe, die Übersetzung »Hüfte« zu wählen, die sich schließlich in jedem Wörterbuch findet. Doch der Kenner des Textes hat spätestens nach seiner dritten Lektüre ziemlich unweigerlich den Verdacht entwickelt, dass auch der Erzähler (und nicht nur der Autor) die Sache mit der Eva biologisch nicht so genau nimmt – so ist zum Beispiel seine Eva »aus einer falschen Lage meines Schenkels entsprungen«: aber war das denn nicht Dionysos, der aus dem Schenkel Zeus’ geboren wurde? Hier bietet einem dann ein Wort wie »Lende«, dessen Anwendungsbereich ja keineswegs auf Männer beschränkt ist (vgl. etwa Luthers »Lob der tüchtigen Hausfrau« in den Sprüchen Salomonis oder Goethes »Wanderer und Pächterin«), das aber dank Odysseus’ notorischer »Kraft der Lenden« eine gewisse Konnotation von Maskulinität gewonnen hat, eine der seltenen Gelegenheiten, durch eine minimale Akzentverschiebung dem verständigen Leser einen Wink zu geben, der ihm schon vor der soundsovielten Lektüre des Textes eine Ahnung von der eigentlichen Lage der Dinge eröffnen kann (WS, S. 11).
Grundsätzlich habe ich mich bemüht, keine Eingriffe am Text vorzunehmen, da ich es nicht für die Aufgabe des Übersetzers ansehe, Texte zu erklären oder gar zu verbessern: Wo Satzteile fehlen wie in WG, S. 481, wo Metaphern unverständlich sind wie die von Tante Léonies Stirnwirbeln in WS, S. 77, so wird der deutsche Leser damit wohl ebenso zurechtkommen müssen wie der französische. Anders sieht es aus, wenn eine im Französischen perfekt verständliche Passage durch eine Eins-zu-eins-Übersetzung unverständlich würde, wie es bei den meisten Kalauern Cottards der Fall ist (z. B. in WS, S. 359, die Doppelbedeutung von »blague« als ›Witz‹ und ›Beutel‹), bei den Sprachschnitzern des Hoteldirektors (z. B. in SG, S. 232, die Verwechslung der fast gleichlautenden »sole«, ›Seezunge‹, und »saule«, ›Weide‹) oder bei dem verlotterten Französisch des Liftboys in SG, S. 270, dessen Widerwille gegen die im Französischen grammatisch korrekte doppelte Verneinung im Deutschen nicht reproduzierbar ist. In solchen Fällen habe ich so vorsichtig wie möglich den Zusammenhang angepasst, um die Textlogik zu retten; auch diese Fälle sind jeweils in den Anmerkungen identifiziert und erläutert.
Zum Abschluss dieses Abschnitts sei noch auf die Problematik des texthistorischen Kontextes eingegangen, die sich bei der Neuübersetzung eines Textes zwangsläufig einstellt – denn dass schon eine oder mehrere ältere Übersetzungen existieren, lässt sich natürlich nicht ignorieren. Damit tritt dann die Versuchung auf, gegen die alten Übersetzungen anzuarbeiten. Schon der erste Satz der Recherche wirft ein helles Licht auf dieses Problem. Schottlaender etwa ersetzt das Perfekt der Vorlage durch ein Präteritum und übersetzt fragwürdig, aber sehr prägnant, »ging ich schlafen« statt »bin ich schlafen gegangen«; ein T-Shirt, das ich bei Ebay erworben habe, propagiert nicht Rechel-Mertens’ »schlafen gegangen«, sondern »zu Bett gegangen«; bei Kleeberg geht der Erzähler »zu früher Stunde« schlafen, und nicht einfach »früh«; hier könnte man dann mit einer Umstellung der »Zeit« anschließen und »Lange … frühzeitig« statt »Lange Zeit … früh« erwägen; schließlich wäre noch »sich zu Bett begeben« oder »sich schlafen legen« zu bedenken. Das ergibt 48 Möglichkeiten, von denen sich allerdings die meisten schon auf den ersten Blick als unbrauchbar erweisen. Die theoretische Möglichkeit, »longtemps« einfach nur als »lange« zu übersetzen, wie das Wörterbuch es vorschlägt, und damit auch die Zehnsilbigkeit des Originals zu erhalten, die eine lange epische Tradition hat, verbietet sich hier, da zum einen das »temps« in »longtemps« offenkundig auf den Kernbegriff des Titels rekurriert und es zum anderen mit dem »dans le temps« am Textende – 4251 Seiten später – eine Klammer bildet. Das eigentliche Problem mit den schließlich verbleibenden Kandidaten – »lange Zeit ging ich abends früh zu Bett«, das die Zehnsilbigkeit des Originals bewahrt, allerdings nicht das Tempus; »lange Zeit habe ich mich früh schlafen gelegt«, das die Reflexivität des »se coucher« bewahrt, aber umständlich klingt; »lange Zeit bin ich früh zu Bett gegangen«, um das deutsche »schlafen« für das französische »dormir« zu reservieren, das aber ein wenig nach Schlafsaal klingt – ist jedoch: Wird nicht jeder von ihnen das unangenehme Odeur mit sich tragen, nur als Konkurrent zur tradierten Fassung ins Rennen geschickt worden zu sein? Wie immer man sich da entscheiden mag – ich habe dann schließlich der Tradition meine Reverenz erwiesen –: Es bleibt das noch unangenehmere Gefühl, sich nicht wirklich frei entschieden zu haben.
Zu den Fehlern, die der aufmerksame Leser hier und dort finden mag und die bei der Erstauflage eines Werkes von diesem Umfang (1,1 Millionen Wörter) und Anspruch unvermeidlich auftreten, bitte ich um Vergebung, doch lassen Sie mich eine Bemerkung Prousts in einem Brief an Constantin de Brancovan vom Januar 1903 (Corr. III, S. 221) zu seiner eigenen Ruskin-Übersetzung zitieren: »Wenn es Fehler in meiner Übersetzung gibt, dann in den klaren und einfachen Partien, denn die unklaren, schwierigen sind über Jahre hinweg begrübelt, umgearbeitet, ergründet worden.«
L’infini, raisonneur, dit à Kant: entends-tu?
L’impératif finit à ce turlututu
Das Unendliche, der Widerspruchsgeist, spricht zu Kant: Hörst du gut zu?
Der Imperativ endet bei diesem Turlututu
1926 Rudolf Schottlaender (Übers.): Auf den Spuren der verlorenen Zeit. Tl. 1: Der Weg zu Swann. 2 Bde. Berlin: Verlag Die Schmiede, 1926.
1926 Walter Benjamin / Franz Hessel (Übers.): Auf den Spuren der verlorenen Zeit. Zweiter Roman: Im Schatten der jungen Mädchen. Berlin: Verlag Die Schmiede, [1926]. Neuausg. in: Walter Benjamin: Gesammelte Schriften. Übersetzungen. Supplement II. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1987. Weitere Neuausg.: Köln: Anaconda, 2016.
1930 Walter Benjamin / Franz Hessel (Übers.): Auf den Spuren der verlorenen Zeit. Dritter Roman: Die Herzogin von Guermantes. 2 Bde. München: Piper, 1930. Neuausg. in: Walter Benjamin: Gesammelte Schriften. Übersetzungen. Supplement III. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1987.
1953 Eva Rechel-Mertens (Übers.): Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Bd. I: In Swanns Welt. Bd. II: Im Schatten junger Mädchenblüte. Bd. III: Die Welt der Guermantes. Bd. IV: Sodom und Gomorra. Bd. V: Die Gefangene. Bd. VI: Die Entflohene. Bd. VII: Die wiedergefundene Zeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp / Zürich: Rascher, 1953–57. [Textgleiche Ausgabe für die DDR: Berlin: Rütten und Loening, 1974.]
1994 Luzius Keller (komm. Rev. der Übers. von Eva Rechel-Mertens auf der Grundl. der von Tadié rev. Fassung des frz. Textes): Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Bd. I: Unterwegs zu Swann. Bd. II: Im Schatten junger Mädchenblüte. Bd. III: Guermantes. Bd. IV: Sodom und Gomorrha. Bd. V: Die Gefangene. Bd. VI: Die Flüchtige. Bd. VII: Die wiedergefundene Zeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1994–2004. [Ab Bd. II zus. mit Sibylla Laemmel; Abt. II der Frankfurter Werk-Ausgabe.]
2002 Michael Kleeberg (Übers.): Combray. München: Liebeskind, 2002. [Taschenbuchausg. München/Zürich: Piper, 2004.]
2004 Michael Kleeberg (Übers.): Eine Liebe Swanns. München: Liebeskind, 2004. [Taschenbuchausg. München/Zürich: Piper, 2005.]
2013 Bernd-Jürgen Fischer (Übers. und Komm.): Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Bd. I: Auf dem Weg zu Swann. Bd. II: Im Schatten junger Mädchenblüte. Bd. III: Der Weg nach Guermantes. Bd. IV: Sodom und Gomorrha. Bd. V: Die Gefangene. Bd. VI: Die Entflohene. Bd. VII: Die wiedergefundene Zeit. Stuttgart: Reclam, 2013–16.
2017 Zweifel, Stefan (Übers. und Vorw.): Das Flimmern des Herzens. Aus den frz. Druckbogen erstmals übers. Berlin: Die Andere Bibliothek, 2017.
Ins Englische
Der mit Proust befreundete englisch-jüdische Autor Sydney Schiff bemühte sich seit 1920 bei Proust darum, zumindest den ersten Band der Recherche ins Englische übersetzen zu dürfen, doch Proust hielt ihn unter anderem für einen »Dilettanten« (Corr. XXI, S. 342) und entschied trotz seiner Freundschaft mit den Schiffs, der Übertragung der Aufgabe durch Gallimard an den professionellen Übersetzer Charles-Kenneth Scott-Moncrieff (1889–1930) zuzustimmen, der 1923 den ersten Band seiner Übersetzung vorlegte.
Titelblatt des ersten Teilbandes (von zwei) der Erstausgabe der Scott-Moncrieff-Übersetzung von Sodome et Gomorrhe.
Scott-Moncrieff hatte 1920 seine Stelle bei der Times aufgegeben, für die er gelegentlich Artikel schrieb, um sich ganz seiner Übersetzungsarbeit widmen zu können: 1921 beendete er die Übersetzung des altenglischen Beowulf, und ab 1922 arbeitete er an der Übersetzung von Prousts À la recherche du temps perdu. 1923 ging er wegen gesundheitlicher Probleme nach Italien, wo er abwechselnd in Florenz und Pisa und ab 1928 in Rom lebte; er starb 1930 in Rom an Magenkrebs und wurde im Campo Verano beigesetzt.
Die ersten drei Bände von Scott-Moncrieffs Übersetzung der Recherche waren noch in verhältnismäßig dichter Folge erschienen, 1922, 1924 und 1925, doch dann trat ein Hiatus von vier Jahren ein. Der Grund war nicht nur, dass Scott-Moncrieff inzwischen Pirandello, sondern mehr noch, dass der Verlag Chatto & Windus Sodome et Gomorrhe I entdeckt hatte, das in England kaum eine Chance gehabt hätte, die Zensur zu überstehen: »Werden Sie dafür sorgen, dass ich nicht verfolgt werde, wenn ich Sodome et Gomorrhe übersetze?« (Scott-Moncrieff an Winston Churchills Sekretär Edward March am 28. 11. 1924, zit. nach Findlay,42 S. 232). Der amerikanische Verleger Thomas Seltzer brauchte damals solche Bedenken zwar nicht in diesem Maße zu haben, schlug aber dennoch vor, »die schlimmsten Stellen auf Französisch, unübersetzt, zu belassen, dann werden sich unsere Zensoren ja vielleicht nicht einmischen« (Seltzer an Scott-Moncrieff am 18. 12. 1925, zit. nach Findlay, S. 249). Seltzer hatte bereits einschlägige Erfahrungen mit D. H. Lawrences Women in Love gemacht – die ihn in den Bankrott trieben, noch bevor er mit Scott-Moncrieff handelseinig werden konnte. Seine Neffen und Nachfolger Albert und Charles Boni kauften Scott-Moncrieff für $ 3000 die Rechte an den restlichen Bänden für den Fall ab, dass Chatto & Windus nicht publizieren sollte; so erschien eine erste, auf 2000 Exemplare limitierte und numerierte amerikanische Ausgabe 1927 unter dem camouflierenden, aber immerhin noch biblischen Titel Cities of the Plain bei Albert and Charles Boni, Inc., der schließlich, 1929, unter gleichem Titel auch eine Ausgabe beim amerikanischen Partner-Verlag von Chatto & Windus, Alfred A. Knopf, folgte, die auch in England vertrieben wurde, bis dann in den Vierzigern Chatto & Windus den englischen Markt wieder selbst versorgte. Merkwürdigerweise – merkwürdig insofern, als völlig unerklärlich ist, wie sich das alles vertrags- und urheberrechtlich dargestellt haben sollte – erschien parallel zur Boni-Ausgabe auch eine Ausgabe bei der amerikanischen Modern Library (New York: Random House). Diese beiden Ausgaben zumindest tragen die erklärungsbedürftige »Widmung des Übersetzers für Richard und Myrtle Kurt und ihren Schöpfer«, die Titelpersonen nämlich von Sydney Schiffs (1868–1944) Roman Richard Kurt, den dieser 1919 unter dem Pseudonym »Stephen Hudson« bei M. Secker (London) mit einer Widmung »To M. P.« veröffentlichte, wobei die Figur Richard Kurts im allgemeinen als eine Hommage an Proust gedeutet wird, mit dem Schiff befreundet war.
Nach dem Tod Scott-Moncrieffs übersetzte 1931 Sydney Schiff (abermals unter seinem Pseudonym »Stephen Hudson«) den letzten Band für Chatto & Windus mit dem Titel Time Regained; wenig später (1932) erschien in den USA eine weitere Übersetzung des letzten Bandes für den Verlag The Modern Library von Frederick A. Blossom unter dem Titel The Past Recaptured. Mit dem englischen Gesamttitel Remembrance of Things Past, den Scott-Moncrieff dem 30. Sonett Shakespeares entlehnt hatte (der sich seinerseits auf Wisdom of Solomon 11:12 in der Bishops’ Bible, 1572, bezog), war Proust allerdings nicht sehr glücklich: »›À la recherche du temps perdu‹ heißt das keineswegs«; auch der Titel Swann’s Way missfiel Proust wegen seiner unerwünschten Doppeldeutigkeit: »Swann’s Way kann Du côté de chez Swann bedeuten, aber auch ›auf Swanns Art und Weise‹. Hätten Sie ein ›to‹ hinzugefügt, wäre alles gerettet«, schrieb er im Oktober 1922 an Scott-Moncrieff (beide Zitate in Corr. XXI, S. 499). Dieses »to« begründet und rechtfertigt übrigens die Richtungskomponente »zu« in den neueren deutschen Titel-Übersetzungen Unterwegs zu Swann (Keller) bzw. Auf dem Weg zu Swann (Fischer).
Bei Proust-Kennern stießen auch die anderen von Scott-Moncrieff gewählten Einzeltitel, Within a Budding Grove für Bd. 2, Cities of the Plain für Bd. 4 und The Sweet Cheat Gone für Bd. 6, auf wenig Gegenliebe (»prissy euphemisms«: Graham Robb im Telegraph, 12. 10. 2002). Dennoch behielt die von Terence Kilmartin und Andreas Mayor auf der Grundlage des Clarac/Ferré-Textes 1981 durchgeführte Überarbeitung diesen Titel bei, wie auch die Untertitel für Bd. 2 und Bd. 4. Bd. 6, dessen Titel The Sweet Cheat Gone zwar sehr poetisch war, nämlich einem Gedicht von Walter de la Mare43 entlehnt, aber auch gänzlich unzutreffend, wurde jetzt mit The Fugitive neu betitelt. Die Kilmartin/Mayor-Bearbeitung bemüht sich neben der Anpassung an den neuesten Forschungsstand auch um eine Entrümpelung des ins Preziöse (»purplish prose«, R. Douglas-Fairhurst in The Observer, 17. 11. 2002) neigenden Stils Scott-Moncrieffs: Bei allen Meriten, die seiner Übersetzung zukommen, war es doch riskant, daraus zu zitieren, denn oft genug musste man dann feststellen, dass das, worauf es einem ankam, so bei Proust gar nicht stand (vgl. etwa Peter Bien in The Times Literary Supplement, 19. 11. 2014, S. 6). Scott-Moncrieff hatte kein Problem damit, Proust zu verbessern (»more Proustian than Proust«, A. N. Wilson in The Times Literary Supplement, 31. 10. 2014, S. 5), mit dessen Werk er sich offenbar derart identifizierte, dass »er mich für gewöhnlich mit einer Schimpfkanonade über Albertine empfing, deren Launen und üble Gewohnheiten ihn damals sehr beschäftigten« (Ernst Robert Curtius 1931 an Scott-Moncrieffs Mutter Jessie Margaret, 1858–1936, zit nach Findlay S. 284).
Bei der Überarbeitung 1992 des Kilmartin/Mayor-Textes wiederum durch D. J. Enright und Andreas Mayor, die durch die Neuordnung der französischen Textgrundlage durch Tadié notwendig geworden war, entschloss man sich beim Verlag Chatto & Windus, bei dem auch alle früheren Ausgaben erschienen waren, mit In Search of Lost Time einen Titel zu wählen, der dem des Originals deutlich näher kommt. Auch der Einzeltitel des 4. Bandes wurde jetzt in Sodom and Gomorrah geändert, den sehr lyrischen, aber wenig originalgetreuen Titel des zweiten Bandes, Within a Budding Grove, den Scott-Moncrieff dem Gedicht The Lover and Birds44 von William Allingham entnommen hatte, behielt die Bearbeitung jedoch bei.
2002 erschien bei Allen Lane (Penguin) eine Neuübersetzung unter dem Titel In Search of Lost Time, die von einem Team unter der Leitung von Christopher Prendergast erarbeitet wurde und bei der auch der zweite Band nun einen originalgetreueren Titel trägt, In the Shadow of Young Girls in Flower. Die einzelnen Bände wurden von jeweils eigenen Übersetzern bearbeitet, eine Vorgehensweise, die nicht überall auf Beifall stieß (»why use seven translators rather than 70? Or 700?«, Douglas-Fairhurst in The Observer, 17. 11. 2002). Auch die Änderung des Titels des 7. Bandes, der auf Sydney Schiff zurückgeht, von Time Regained (»triumphant past-participle«) in Finding Time Again erschien der Kritik wenig glücklich (»mealy-mouthed«, beide Zitate Graham Robb, a. a. O.). Die Prendergast-Übersetzung berücksichtigt zudem Prousts Kritik an der Doppeldeutigkeit des Moncrieffschen Titels für den ersten Band, fügt jedoch kein »to« hinzu, wie von Proust angeregt, sondern ein »by«, womit sie allerdings mit The Way by Swann’s der Bedeutung von Du côté de chez Swann deutlich näher kommt; erstaunlicherweise heißt dann jedoch der erste Band in der amerikanischen Ausgabe wieder Swann’s Way – vielleicht ja, weil »swans weg« aus Scott-Moncrieffs Übersetzung des Beowulf stammt.
Zum hundertsten Jahrestag des Erscheinens des ersten Bandes der Recherche startete die Yale University Press eine von William C. Carter kommentierte und überarbeitete Neuausgabe der ursprünglichen Übersetzung von Scott-Moncrieff unter Berücksichtigung der späteren Revisionen unter dem Titel In Search of Lost Time. Der erste Band, wieder mit dem heiklen Titel Swann’s Way, erschien im Januar 2014, der zweite im Januar 2016 unter dem Titel In the Shadow of Young Girls in Flower. Diese Ausgabe erspart dem Leser die Last des Blätterns, da die Anmerkungen an den Rand der jeweiligen Text-Seite gesetzt wurden.
1922 Charles Kenneth Scott Moncrieff (Übers.): Remembrance of Things Past. Bd. I: Swann’s Way. London: Chatto & Windus, 1922. Bd. II: Within a Budding Grove. Ebd. 1924. Bd. III: The Guermantes Way. Ebd. 1925. Bd. IV: Cities of the Plain. London: Knopf, 1929. Bd. V: The Captive. Ebd. 1929. Bd. VI: The Sweet Cheat Gone. Ebd. 1930. – In England: Stephen Hudson (d. i. Sydney Schiff; Übers.): Bd. VII: Time Regained. London: Knopf / [später:] Chatto & Windus, 1931. – In den USA: Frederick A. Blossom (Übers.): Bd. VII: The Past Recaptured. New York: Random House, 1932. (Modern Library Edition.) [Der Band »Time Regained« konnte von Scott Moncrieff nicht mehr fertiggestellt werden. Der Band »Cities of the Plain« erschien in den USA bereits 1927 in numerierter Auflage bei Albert & Charles Boni (New York) sowie bei Random House in der Modern Library Edition (New York).]
1970 Charles Kenneth Scott Moncrieff (Übers.) / Stephen Hudson (Übers., Bd. VIII und XII) / Terence Kilmartin (Rev. von Bd. I–VI der Übers. von 1922–30 auf der Basis der rev. frz. Textfassung von Clarac/Ferré) / Andreas Mayor (Rev. von Bd. VII der Übers. von 1931 auf der Basis der rev. frz. Textfassung von Clarac/Ferré): Remembrance of Things Past. Bd. I/II: Swann’s Way. Bd. III/IV: Within a Budding Grove. Bd. V/VI: The Guermantes Way. Bd. VII/VIII: Cities of the Plain. Bd. IX/X: The Captive. Bd. XI: The Fugitive. Bd. XII: Time Regained. London: Chatto & Windus, 1981. [Mayors Revision der Hudson-Übers. erschien bereits 1970 unter dem Titel »The Past Recaptured«.]
1992 Charles Kenneth Scott Moncrieff (Übers.) / Stephen Hudson (Übers.) / Terence Kilmartin (Rev. 1970) / D. J. Enright (Rev. von Bd. I–VI der rev. Übers. von 1970 auf der Basis der rev. frz. Textfassung von Tadié) / Andreas Mayor (Rev. von Bd. VII der rev. Übers. von 1981 auf der Basis der rev. frz. Textfassung von Tadié): In Search of Lost Time. Bd. I: Swann’s Way. Bd. II: Within a Budding Grove. Bd. III: The Guermantes Way. Bd. IV: Sodom and Gomorrah. Bd. V: The Captive / The Fugitive. Bd. VI: Time Regained / A Guide to Proust. London: Chatto & Windus, 1992.
2002 Christopher Prendergast (Hrsg., Ltg. der komm. Neuübers. auf der Grundl. der frz. Textfassung von Tadié): In Search of Lost Time. Bd. I: The Way by Swann’s (Übers. Lydia Davis). Bd. II: In the Shadow of Young Girls in Flower (Übers. James Grieve). Bd. III: The Guermantes Way (Übers. Mark Treharne). Bd. IV: Sodom and Gomorrah (Übers. John Sturrock). Bd. V: The Prisoner / The Fugitive (»The Prisoner«: Übers. Carol Clark / »The Fugitive«: Übers. Peter Collier). Bd. VI: Finding Time Again (Übers. Ian Patterson). London: Allen Lane, 2002. London: Penguin, 2003. [In den USA erschien Bd. I bei Viking unter dem Titel »Swann’s Way«.]
2013 William C. Carter (Hrsg., komm und überarb. Fassung der Übers. von 1922–31/32): In Search of Lost Time. Bd. I: Swann’s Way. New Haven: Yale University Press, 2013. Bd. II: In the Shadows of Young Girls in Flower. Ebd. 2015.
Umschlag-Vorderseite des ersten Teilbandes (von zwei) von Bd. I in der spanischen Übersetzung von 1920. Auf der Innenklappe befindet sich die Ankündigung von Bd. II.
Ins Spanische
Im Januar 1920 schreibt Proust an Gallimard, er solle dem peruanischen Schriftsteller Ventura García Calderón (1886–1959), damals Chefredakteur der Zeitschrift Hispania, keine Fotos mehr schicken, denn er habe schon mehrere – ein Hinweis, dass Proust sich aktiv um eine spanischsprachige Lesergemeinde bemüht hat. Dafür mag ein Grund gewesen sein, dass Proust nicht nur mit dem in Venezuela geborenen Reynaldo Hahn eng befreundet war, sondern zu seinem Bekanntenkreis noch weitere Ibero-Amerikaner zählte, wie den aus Peru stammenden Geliebten Montesquious, Gabriel Yturri (1860–1905), den in Kuba geborenen Schriftsteller José-Maria de Heredia (1842–1905), den in Mexiko geborenen Schriftsteller Ramon Fernandez (1894–1944) und den Maler Antonio de La Gandara (1862–1917), der einen mexikanischen Vater hatte und zwar in Paris lebte, jedoch bis zu seinem vierunddreißigsten Lebensjahr die mexikanische Staatsbürgerschaft beibehielt – ähnlich wie Ramon Fernandez, der sich auch erst mit dreiunddreißig nationalisierte. Einen weiteren Ausdruck findet Prousts Faible für die spanischsprachige Welt in seinem Aktien-Portefolio, das sich stark um südamerikanische Werte gruppierte45. Die Übersetzung von Du côté de chez Swann als Por el camino de Swann durch Pedro Salinas (1891–1951), die 1921 zweibändig im Verlag CALPE, Madrid, erschien (Druckvermerk 1920; gelegentlich irrtümlich José Ortega y Gasset zugeschrieben), dürfte dann auch die erste Übersetzung eines kompletten Bandes der Recherche überhaupt gewesen sein; der zweite und der dritte Band folgten 1922 bzw. 1931 unter dem Gesamttitel En busca del tiempo perdido. Es ist unklar, warum der Proust-begeisterte Salinas sich mitten in der Arbeit am dritten Band aus dem Projekt zurückzog und den zweiten Band von Guermantes dem Schriftsteller José María Quiroga Plá (1902–55) überließ, und vor allem, warum die CALPE nun ebenfalls das Projekt einstellte – freilich legt ein Blick auf die englische Übersetzungsgeschichte den Verdacht nahe, dass auch hier die Schere im Kopf der Schere des Zensors vorausgeeilt ist. So dauerte es vierzehn weitere Jahre, bis schließlich der in Buenos Aires angesiedelte Verleger Santiago Rueda den argentinischen Übersetzer Marcelo Menasché mit der Übersetzung der restlichen vier Bände für seinen erst 1939 gegründeten Verlag beauftragte – ein Raubdruck des zweiten Bandes, der 1937 in Chile beim Verlag Zig-Zag erschien, hatte das anhaltende Interesse in der spanischsprachigen Welt an Proust hinlänglich verdeutlicht, der vor allem in Chile und in Argentinien lebhaft diskutiert wurde. Santiago Rueda legte auch die ersten drei Bände neu auf und gab so 1944–46 die erste spanische Gesamtausgabe heraus (1946 auch als einbändige Dünndruckausgabe). Sie wurde in Argentinien lobend aufgenommen, in Spanien dagegen sah sich Menasché mit seiner Neigung zu einem argentinischen Spanisch heftiger Kritik ausgesetzt, obwohl ja unter der Knute des Franco-Faschismus an eine europäische kastilianische Ausgabe vorerst gar nicht zu denken war. Erst 1952, nachdem die Boykott-Maßnahmen gegen Franco-Spanien ihre Wirkung zu zeigen begannen und das Regime eine vorsichtige Öffnung nach Westen wagte (1953 wurde der erste US-Stützpunkt in Spanien errichtet), konnte eine Übersetzung im kastilianischen Spanisch der letzten vier Bände von dem spanischen Schriftsteller und multilingualen Übersetzer (Lampedusa, Pasternak) Fernando Gutiérrez (1911–84) erscheinen. Sie wird zwar vom internationalen Fachpublikum als deutlich besser bewertet als die Übersetzung von Menasché, hat diese aber nicht aus der Gunst der südamerikanischen Leserschaft verdrängen können.
In den Jahren 2000–05 publizierte der spanische Verlag Valdemar eine Neuübersetzung von Mauro Armiño, und 2000–09 der mexikanisch-uruguayische Verlag Lumen eine weitere Neuübersetzung von Carlos Manzano. Während sich Armiños Übersetzung durch eine penible Originaltreue auszeichnet – anders als die alte Übersetzung von Salinas, der, wie auch Scott-Moncrieff, nicht davor zurückschreckte, proustischer als Proust zu sein –, bemüht sich Manzano um eine Hispanisierung des Textes, indem er barocke Traditionen der spanischen Syntax aufnimmt, um Prousts komplexen Satzbau im Kastilianischen nachvollziehen zu können. Eine dritte Neuübersetzung durch die argentinische Autorin Estela Cantó (1916–94), die eine dem argentinischen Spanisch vertrautere Sprache zu finden sucht, indem sie die typisch kastilianischen Ausdrucksweisen Pedro Salinas’ vermeidet, ohne sich jedoch, wie Menasché es gelegentlich tut, mit »Rioplatismen« als Argentinierin ausweisen zu wollen, erschien in Buenos Aires im Losada-Verlag in den Jahren 2000–10. Allerdings ist nicht bekannt, wann Cantó – die 1994 gestorben ist – ihre Übersetzung angefertigt hat und also, auf welcher Textgrundlage; verschiedene Details deuten jedoch darauf hin, dass zumindest die ersten Teile ihrer Übersetzung noch auf dem Clarac/Ferré-Text beruhen. Craig46 betont in seiner Besprechung für La Nación, dass die drei neuen Übersetzungen von Cantó, Armiño und Manzona jene Wörtlichkeit vermeiden, zu der die Übersetzung ins Spanische aus dem so nahe verwandten Französisch einlädt und die die Übersetzungen von Menasché, Gutierrez und de la Serna kennzeichnet, und dass sie zudem auch davor zurückschrecken, Prousts Syntax »begradigen« zu wollen, wie es die Übersetzung von Consuelo Berges aus den Sechzigern noch für geraten hielt.
Eine detaillierte Darstellung sowie eine umfangreiche Bibliographie der in Europa bislang kaum wahrgenommenen Proust-Rezeption im spanischsprachigen Amerika gibt Herbert E. Craigs Marcel Proust and Spanish America (s. S. 82).
Spanisch
1920 Pedro Salinas (Übers. Bd. I–III) / José María Quiroga Plá (Mitarb. an Bd. III): En busca del tiempo perdido. Bd. I. Madrid/Barcelona: Espasa-Calpe, 1920. Bd. II. Ebd. 1922. Bd. III. Ebd. 1931. [Die restlichen vier Bände von Marcelo Menasché für Rueda (Buenos Aires, Argentinien), 1945–46; von Fernando Gutiérrez für José Janés (Spanien), 1952; von Consuelo Berges für Alianza Editorial (Madrid, Spanien), 1967–69.
1981 Julio Gómez de la Serna (Übers.): En busca del tiempo perdido. 2 Bde. Madrid: Aguilar, 1981. [Bd. I und II der dreibändigen Gesamtausgabe.]
2000 Mauro Armiño (Übers. und Komm.): A la busca del tiempo perdido. 3 Bde. Madrid: Valdemar, 2000–05.
Spanisch (Argentinien)
2000 Estela Cantó (Übers.): En busca del tiempo perdido. Buenos Aires: Losada, 2000–10. [Beruht vermutl. noch auf dem Clarac/Ferré-Text. Cantó starb 1994.]
Spanisch (Kuba)
2008 Hugo Vidal Obregón (Übers. Bd. I) / Jacques-François Bonaldi (Übers. Bd. II): Sodoma y Gomorra. 2 Bde. Havanna: Arte y Literatura, 2008.
Spanisch (Ecuador)
1974 Ana Bergholtz Mujica (Übers.): Por el camino de Swann. 2 Bde. Guayaquil: Cromograf, 1974/75.
1994 Mario Campaña Avilés (Übers.): El tiempo recobrado. Quito: Libresa, 1994.
Spanisch (Kolumbien)
2007 Daniel Quintero (Übers.): A la sombra de las muchachas en flor. Bogotá: Yoyo Libros, 2007.
Spanisch (Uruguay)
1990 Carlos Manzano (Übers.): En busca del tiempo perdido. Montevideo: Lumen, 1990 ff.