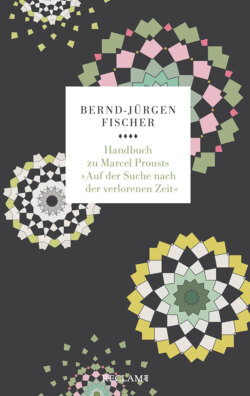Читать книгу Handbuch zu Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« - Bernd-Jürgen Fischer - Страница 9
ОглавлениеDie Titelseite der Grasset-Ausgabe von 1913 mit dem Etikett der Nouvelle Revue Française
Die Erstausgabe
»Die Recherche hat etwas von ›Es war Milady‹ an sich«
(Gérard Genette, Figures III, Paris: Seuil, 1972, S. 97).
Swann Ende Oktober legte Proust nach einer Empfehlung seines Förderers, dem Herausgeber des Figaro, Gaston Calmette, der bereits 1912 Auszüge aus Swann vorabgedruckt hatte, sein damals noch zweibändig konzipiertes Romanmanuskript (Le Temps perdu und Le Temps retrouvé) mit dem Arbeitstitel Les Intermittances du cœur dem bekannten Literaturverleger Eugène Fasquelle (1863–1952) vor, bei dem auch zahlreiche Autoren aus Prousts Freundeskreis publizierten. Im Dezember desselben Jahres lehnte Fasquelle jedoch ab, vermutlich aufgrund eines umfangreichen internen Lektoratsberichts des Dichters Jacques Normand (1848–1931; Pseudonym »Jacques Madeleine«), der unter anderem schrieb: »Am Ende von siebenhundertzwölf Seiten dieses Manuskripts (siebenhundertzwölf mindestens, denn viele Seiten sind mit a, b, c, d versehen) – nach unendlicher Verzweiflung darüber, in unauslotbaren Verwicklungen zu ertrinken und nervenzerrüttender Ungeduld darüber, niemals an die Oberfläche aufsteigen zu können – hat man keine, aber auch nicht die leiseste Ahnung, worum es eigentlich geht. Wozu das Ganze? Was soll es bedeuten? Wohin soll es führen? – Unmöglich, das zu ergründen. Unmöglich, dazu etwas zu sagen. […] Aber insgesamt und auch hinsichtlich der Bestandteile kommt man nicht umhin, hier ein höchst ungewöhnliches intellektuelles Phänomen zu konstatieren.« (Übers. nach Compagnon, Swann, S. 446–450; der Brief wurde erstmals 1966 publiziert.) Ein kleines Juwel aus dieser Rezension möchte ich dem Leser nicht vorenthalten: Madeleine zitiert eine Passage aus WZ, S. 355 f.: »›In der Armee … hatte ich einen Freund, an den mich dieser Herr [Bréchot] ein wenig erinnerte. Ganz egal über was, was soll ich sagen, über dies Glas hier zum Beispiel, da kann er sich stundenlang die Lippen fusselig reden, na ja, vielleicht nicht über dies Glas hier, das war dumm von mir; aber etwa über die Schlacht von Waterloo, über was immer Sie wollen, lässt er so ganz nebenher Sachen vom Stapel, auf die Sie niemals gekommen wären‹« und kommentiert: »Fürchtet der Autor nicht, dass wir das auf ihn anwenden könnten?«
Parallel zu Fasquelle hatte Proust sein Manuskript auch an Gaston Gallimard (1881–1975) geschickt, den Proust 1908 in der Normandie kennengelernt hatte; Gallimard war Leiter des 1911 von André Gide und seinem Freundeskreis gegründeten avantgardistischen Verlags Les Éditions de la Nouvelle Revue Française, der den von Proust bevorzugten Rahmen für sein Werk geliefert hätte. Doch die NRF lehnte ebenfalls Ende Dezember ab, auf Anraten Gides, der sich aber 1914 eines Besseren besann und Proust am 11. Januar einen Entschuldigungsbrief schickte, der in der Proust-Gemeinde einige Verwirrung stiftete, denn 1928 wurde noch nicht jener Brief publiziert, den Proust erhalten hatte, sondern Gides Kladden-Entwurf. Darin schreibt er: »Die Ablehnung dieses Buches [Swann] wird der größte Fehler bleiben, den die NRF je begangen hat – und (da ich die zweifelhafte Ehre habe, dafür weitgehend verantwortlich zu sein) für mich ein Gram, der quälendste Gewissensbiss meines Lebens. […] Ich hatte Sie für einen von der ›Côté de chez Verdurin‹ gehalten, einen Snob, einen Salonhelden – etwas, was man in unserer Revue nicht ausstehen kann.« Diese Passage findet sich auch in dem Brief, den Proust tatsächlich erhielt, der aber erst 1963 publiziert wurde (s. Corr. XIII, S. 51 ff.). Der folgende Passus aus der Kladden-Veröffentlichung von 1928, der den Anstoß gegeben haben dürfte für den ›Vertèbres-Wirbel‹ (s. dazu MPE, »Wirbel« I und II), fehlt aber in dem eigentlichen Brief: »Das Unglück wollte es, dass meine Aufmerksamkeit sogleich in die Tasse Kamomillen-Tee [sic] auf S. 62 fiel, und dann S. 64 über den Satz stolperte (der einzige des Buches, den ich mir nicht recht erklären kann – bislang, denn ich wollte nicht warten, bis ich es zu Ende gelesen habe, um Ihnen zu schreiben), in dem von einer Stirn die Rede ist, durch die die Wirbel hindurchscheinen.« (Corr. XIII, S. 50 f.). Womöglich hat Gide ihn ja zwischen Entwurf und Reinschrift begriffen.
Nach diesen Misserfolgen ließ ein Freund Prousts, der Schriftsteller Louis de Robert (1871–1937), dem Leiter Alfred Humblot (1865?–1920) des Verlages von Paul Ollendorff (1851–1920) das Manuskript zukommen; um den 10. Februar 1913 schreibt Humblot an Robert: »Lieber Freund, ich mag ja total vernagelt sein, aber mir will nicht in den Kopf, wie ein anständiger Mensch dreißig Seiten darauf verwenden kann zu beschreiben, wie er sich in seinem Bett dreht und wälzt, bevor er Schlaf findet. Da kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen […].« (Übers. nach Robert, Comment débuta Marcel Proust, 1925, S. 13.)
Im Rückblick waren diese ganzen Ablehnungen womöglich ein Glücksfall für Proust und die Leser der Suche, denn die etablierten Verlage hätten wohl kaum die endlosen Änderungen und vor allem Erweiterungen in den Fahnen widerspruchslos hingenommen, die Proust dann schließlich bei Grasset vornahm – allerdings auf eigene Kosten, wie den ganzen Druck des ersten Bandes: Im Februar 1913 hatte Proust seinen Bekannten René Blum (1878–1942), der mit Bernard Grasset (1881–1955) befreundet war, gebeten, diesem das Manuskript des ersten Bandes anzubieten – das ganze Projekt, dessen Gesamttitel jetzt die bekannte Form angenommen hatte, war inzwischen auf drei Bände angeschwollen. Grasset willigte am 11. 3. 1913 ein, Swann auf Kosten des Autors zu verlegen. Nach dem großen Erfolg dieses ersten Bandes nach seinem Erscheinen am 14. November15 1913 hätte Grasset natürlich gern seinen Autor an sich gebunden, aber der Ausbruch des Ersten Weltkrieges machte ihm einen Strich durch die Rechnung: Grasset wurde eingezogen, und sein recht kleines Verlagshaus lag damit brach. Zudem war die Beziehung zwischen Proust und Grasset ohnehin nicht von Zuneigung geprägt. Dies gab der NRF Gelegenheit, nachdem sie ihren Irrtum eingesehen hatte, Proust zu umwerben und schließlich Grasset abspenstig zu machen, der, von Typhus geschwächt und nach langem Hin und Her, 1916 mit Bitternis einem Auflösungsvertrag zustimmte. Die NRF kaufte die Fahnen für den zweiten Band auf, soweit sie schon hergestellt waren, sowie die Restauflage von 206 Stück des ersten Bandes, die sie anschließend mit einem Aufkleber über dem Grasset-Druckvermerk und in ihrem eigenen Umschlag ab 1917 vertrieb.
Mädchenblüte Die Papierknappheit der Kriegsjahre wie auch Prousts ständige Änderungswünsche führten dazu, dass der zweite Band auch bei dem neuen Verleger erst am 30. November 1918 gedruckt vorlag – und noch ein weiteres halbes Jahr warten musste, bis er erscheinen konnte. Über die Gründe für diese Verzögerung lässt sich nur spekulieren: da der öffentliche Diskurs Ende 1918 so sehr vom Ende des Ersten Weltkrieges am 11. November 1918 in Anspruch genommen war, dürfte Gallimard gefürchtet haben, dass seine Neuerscheinung nicht die gewünschte Aufmerksamkeit finden könnte. Einen weiteren Hinweis liefert Prousts Brief an Berthe Lemaire aus dem Dezember 1918, in dem er die winzige Schrift beklagt (»Fliegenfüße«, »kann und wird keiner lesen«) und schreibt: »auch meine finanziellen Schwierigkeiten werden mich vor einem nicht zurückschrecken lassen: einem ›Nachdruck‹ auf meine Kosten« (s. Briefwechsel Proust–Gallimard, 1989, S. 147).
Nach dem Erscheinen – in unveränderter Form – am 20. Juni 1919 schließlich wurde das Buch jedoch praktisch umgehend mit dem Prix Goncourt honoriert: es lag wohl doch an Prousts Augen (»selbst die, die gute Augen haben, werden es nicht lesen – all die Arbeit für so ein Ergebnis!«, ebd.).
Neben der regulären Ausgabe erschien 1920 noch eine Luxus-Ausgabe zu 300 statt drei Francs, der »als Lockmittel« jeweils zwei der sogenannten »Placards« beigelegt waren, Collagen aus den Grasset-Fahnen, die Gallimard übernommen hatte, und Ausschnitten aus Prousts Kladden (»Cahiers«). Diese Placards, die von der Sekretärin Mademoiselle Rallet der Nouvelle Revue Française angefertigt worden waren, hatten dem Verlag als Manuskript-Vorlage für den zweiten Band gedient. Für die Sonderausgabe war eine Auflage von einundfünfzig Exemplaren ins Auge gefasst worden; von den demnach einhundertundzwei verteilten Placards sind bislang allerdings erst wenige wieder aufgetaucht, darunter mehrere, die sich jetzt in der Sammlung Speck befinden.
Guermantes, Sodom 1920, 1921 und 1922 erschienen die Folgebände Le Côté de Guermantes I, Le Côté de Guermantes II suivi de Sodome et Gomorrhe I sowie Sodome et Gomorrhe II. Proust hatte gehofft, dass die beiden Guermantes-Bände gleichzeitig mit den »beiden Bände von Sodom I« (das spätere Sodom I plus Sodom II) erscheinen könnten (s. Briefwechsel Proust–Gallimard, S. 242 und auch S. 232 f.), doch durch diese Rechnung machte nach Meinung Prousts der Verleger einen Strich, nach Meinung des Verlegers das Druckhaus: »Die Setzer machen Schwierigkeiten mit Texten, die schwierig zu lesen sind. Die Arbeiter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren« (Gallimard am 24. Januar 1921 an Proust). Gallimard war deshalb auf Verlangen des Druckhauses dazu übergegangen, Prousts Manuskripte abtippen zu lassen und ihm diese »Dactylographien« zur Korrektur zu schicken; die Korrektur der Fahnen sollte dann im Verlagshaus nach diesen korrigierten Typoskripten vorgenommen und diese Fahnen Proust nur noch zu einer letzten Durchsicht geschickt werden. Natürlich expandierte Proust wie gewohnt, so dass Gallimard nun diese Ergänzungen abtippen und wiederum an Proust zur Durchsicht schicken musste – die Korrespondenz zwischen Gallimard und Proust in den Jahren 1920/21 vermittelt einen Eindruck von dem entstandenen Chaos. Die Erstausgabe war dementsprechend von Fehlern durchsetzt: »Bei Guermantes I ist es so katastrophal, dass ich schon überlegt habe, Sie zu bitten, den Band erst im Februar zusammen mit Guermantes II herauszubringen, damit es nicht so auffällt. […] Monsieur Breton glaubt, es gelesen zu haben, Jacques Rivière glaubt, es gelesen zu haben. Und beide haben nicht gemerkt, dass man jedesmal, wenn ich von Bergottes Romanen spreche, ›Bergsons Romane‹ gedruckt hat.« Die Fehlerliste, die Proust für den Verlag zusammenstellte, umfasste 23 Seiten (Corr. XIX, S. 438 f.). Der Ton in der Korrespondenz mit Gallimard blieb trotz aller Ärgernisse freundlich und höflich, doch in der Gefangenen machte Proust seiner Frustration Luft: »[Gisèle] log nicht auf die gleiche Art wie Albertine, und auch nicht auf die gleiche Art wie Andrée, aber ihre jeweiligen Lügen waren, trotz ihrer großen Vielfalt, derart ineinander verschachtelt, dass die kleine Bande die undurchdringliche Solidität gewisser Handelshäuser wie beispielsweise Buch- oder Zeitungsverlage aufwies, bei denen der unglückliche Autor […]« – zur Fortsetzung siehe Die Gefangene, S. 239.
Wann und warum der Entschluss gefasst wurde, das erste Kapitel des ursprünglichen Sodom I als Sodom I an Guermantes II anzubinden und das restliche Sodom I in Sodom II umzubenennen (damit dann auch das ursprüngliche Sodom II in Sodom III), lässt sich nicht mehr rekonstruieren; in einem Brief Prousts an Gallimard von Ende Juni 1920 findet sich die Bemerkung: »Die Côté de Guermantes II will ich in einem Band mit Sodome et Gomorrhe I erscheinen lassen. Das ist eine bessere Aufteilung. Es ist im übrigen auch das, was vereinbart wurde«, während Ende Februar noch von »den zwei Bänden Sodome et Gomorrhe I« die Rede war, also offenbar der alten Einteilung (Briefwechsel Proust–Gallimard, S. 250 bzw. 242).
Die Gefangene, Die Entflohene, Die wiedergefundene Zeit Im Januar 1922 beschloss Proust, den ursprünglich geplanten Band Sodom III in zwei Teilbände Sodom III und Sodom IV aufzuspalten, auch auf die Gefahr hin, dass die Einzelbände recht dünn werden könnten: »man sollte in meinem Fall […] nicht die Behauptung herausfordern […]: ›Er lässt arg nach‹« (Briefwechsel Proust – Gallimard, S. 573; 22. Juni 1922). Im Juli 1922 schlug Proust für diese beiden Teile die Untertitel La Prisonnière und La Fugitive vor (a. a. O., S. 551 f.), wobei sich aber das Problem ergab, dass bei der Nouvelle Revue Française gerade die Übersetzung eines Romans von Rabindranath Tagore unter ebendiesem Titel erschienen war, und »ohne Fugitive keine Prisonnière« (ebd.). Ende September fragte Gallimard deshalb bei Proust an, ob er denn wirklich den vorgesehenen Titel beibehalten wolle, und Proust antwortete (Briefwechsel Proust–Gallimard, S. 621): »seit der Titel La Fugitive im Verschwinden begriffen ist, ist die Symmetrie [zur Gefangenen] dahin«. In der ersten Maschinenabschrift des Manuskripts zum ursprünglichen (ungeteilten) Sodom III findet sich dann die handschriftlich eingetragene Überschrift: »Albertine disparue / Chapitre I«, und in der zweiten Maschinenabschrift, die den Titel La Fugitive trägt, ähnlich der Vermerk: »Hier beginnt Albertine disparue« (NAF 16748; s. auch Tadié, Recherche IV, S. 1043, zu page 3, der die Handschrift offenbar Marcel Proust zuschreibt).
Nach Prousts Tod nahmen sich Prousts Bruder Robert und der NRF-Redakteur Jacques Rivière der nachgelassenen Manuskripte an und bereiteten sie zur Publikation vor; das Manuskript zur Gefangenen lag Gallimard bereits fertig vor, soweit man bei Prousts Manuskripten von ›fertig‹ reden konnte (»keiner der beiden Teile ist ›fertig‹ im eigentlichen Sinn von ›fertig‹«, Briefwechsel Proust–Gallimard, S. 551), zu den letzten beiden Bänden jedoch existierten nur Prousts sogenannte Reinschriften (»Papyrollen«) und zahllose lose Zettel. Bei der Zusammenstellung der Texte wurden deshalb zahlreiche Irrtümer begangen und auch Auslassungen vorgenommen, weshalb Gallimard, der inzwischen die Nouvelle Revue Française übernommen hatte, 1954 eine dreibändige kritische Neuedition unter der Herausgeberschaft von Pierre Clarac und André Ferré in der Reihe Bibliothèque de la Pléiade unternahm. Infolge des so neugeweckten Interesses und auch nach dem Tod von Prousts Nichte Adrienne »Suzy« Mante-Proust tauchte jedoch eine solche Menge neuen Materials auf, dass abermals eine Überarbeitung vor allem der letzten Bände erforderlich wurde. Diese Aufgabe übernahm Jean-Yves Tadié mit der vierbändigen, umfangreich kommentierten Ausgabe bei Gallimard 1987–89, die unserer Übersetzung im wesentlichen zugrunde liegt.
»Albertine disparue« Zu der Hinterlassenschaft von Suzy Mante-Proust gehörte auch eine stark gekürzte und im übrigen wenig veränderte Fassung des sechsten Bandes, das sog. Mauriac-Typoskript, das 1987 von Nathalie Mauriac-Dyer, einer Enkelin von Suzy Mante-Proust, unter dem Titel Albertine disparue bei Grasset publiziert wurde. Der Stellenwert dieses Textes ist umstritten. Helbling (Albertine, 2001) argumentiert, dass es sich eventuell um eine Fassung für einen Vorabdruck in der Reihe Les Œuvres libres handelt, der an den oben erwähnten Vorabdruck Précaution inutile aus der Gefangenen in dieser Serie anschließen würde und mit dem nicht im aufgefundenen Manuskript vorkommenden Satz »Mademoiselle Albertine est disparue« endet, während in der tradierten Fassung dieser – kaum verzichtbare – Satz nicht am Ende der Gefangenen, sondern am Anfang der Entflohenen steht. Auch die Länge des gekürzten Textes, die derjenigen der beiden anderen Œuvres libres-Vorveröffentlichungen gleichkommt, spricht für diese These. Andere Stimmen, wie etwa Nathalie Mauriac-Dyer, neigen eher zu der Auffassung, dass Proust eine völlige Umstrukturierung des Romanendes geplant habe. Eine für Gaston Gallimard bestimmte Notiz am Rande des Mauriac-Typoskripts weckt zumindest Zweifel an Helblings These. In der Reihe Le Livre de poche hat Mauriac-Dyer die gekürzte Fassung unter dem Titel Albertine disparue an die Prisonnière angeschlossen und diesem Band einen Band mit der tradierten Textfassung unter dem Titel La Fugitive folgen lassen. Eine Übersetzung der gekürzten Fassung des sechsten Bandes findet sich unter dem Titel Die Flucht in Hanno Helblings Sammelband Albertine.