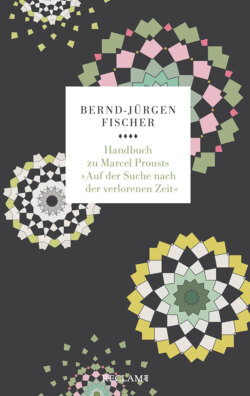Читать книгу Handbuch zu Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« - Bernd-Jürgen Fischer - Страница 5
ОглавлениеI KURZBIOGRAPHIE
»Er hat etwas von einem verdorbenen Bernardin de Saint-Pierre und einem naiven Petronius an sich.« (Anatole France in seinem Vorwort zu Prousts Les Plaisirs et les Jours.)
Proust mit sechzehn und Lavallière.
Foto von Paul Nadar, März 1887.
Biographien
Das Leben Prousts wurde im Laufe der letzten fünfzig Jahre gründlich erforscht und in zahlreichen Biographien mehr oder weniger umfassend beschrieben. Ich beschränke mich deshalb hier auf die Kerndaten. Für umfangreichere Information sei der Leser vor allem auf die werkorientierte Biographie von Tadié (1996) verwiesen, die zwar etwas trocken ist, dafür aber auf ihren über 1000 Seiten kein Detail auslässt. Nicht minder sorgfältig recherchiert, mit einem Schwergewicht auf Prousts künstlerischen Kontakten, ist William C. Carters Biographie Marcel Proust. A Life (2000), die durch ihren diskursiven Stil besticht. Den gleichen Schwerpunkt gibt Mary Ann Caws ihrer überblicksartigen Biographie Marcel Proust von 2005. Angenehm lesbar, allerdings auch wenig zuverlässig, ist die autorenzentrierte Biographie von Painter (Bd. I: 1959; Bd. II: 1965), die noch von dem Verständnis der Suche als einer verklausulierten Biographie ausgeht und deshalb Prousts Leben gelegentlich aus seinem Werk zu rekonstruieren scheint, um dann das Werk aus seinem Leben heraus zu erhellen. Dieser bei Proust oft schwierigen Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion verleiht Adam Watt Gewicht in seiner Biographie Proust von 2013. Eine unterhaltsame und dabei sorgfältig recherchierte Biographie stammt von Ghislain de Diesbach (1991), die sich allerdings allzu sehr auf das gesellschaftliche Leben Prousts kapriziert; sie ist bislang nur auf Französisch und auf Spanisch erhältlich. Ronald Hayman bemüht sich in seiner Proust-Biographie (1990), vor allem anhand der Korrespondenz den inneren Zustand zu rekonstruieren, der für Proust überhaupt erst den Ansatz zur Suche ermöglichte. Dabei ist ihm der Aspekt der Homosexualität besonders wichtig, ohne dass er allerdings über die Ebene des Altbekannten nennenswert hinausgelangte; zudem verwechselt er gern, wie schon Painter, den Erzähler der Suche mit ihrem Autor. Die leicht lesbare Biographie von Edmund White (1999) betrachtet Prousts Leben ebenfalls unter dem homosexuellen Aspekt, ohne dabei jedoch zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Henri Bonnets lesenswerter Essay von 1959, Marcel Proust de 1907 à 1914, der allerdings außerhalb Frankreichs wenig bekannt ist, stellt die Genese des Werkes in den Vordergrund.
In eine eigene Klasse von Biographien gehören sicherlich die Erinnerungen von Céleste Albaret, die als ehemalige Haushälterin Prousts und zugleich die Françoise des Romans von einer ganz eigenen Warte auf das Leben und Werk Prousts blickt. Der weit entfernte Zeitpunkt (1974), von dem aus sie zurückblickt, lässt freilich gelegentlich Zweifel aufkommen, ob nicht auch früher Gehörtes zu später Erinnertem geworden ist. Eher als Kuriosum seien hier auch die Erinnerungen Avec Marcel Proust (1966) von Marcel Plantevignes (1889–1966) erwähnt, den Proust 1908 in Cabourg kennen- und allem Anschein nach auch lieben lernte. In seinem Buch stellt er sich mehr oder weniger als Prousts Ideenlieferant für die Suche dar; wohl nicht ohne Grund nannte Proust ihn »Le Chevalier Fantaisie«.
Für eine rasche Orientierung bildet Michel-Thiriets Marcel Proust Lexikon (1987, erw. 1992) ein nützliches Hilfsmittel. Einen enzyklopädisch aufgebauten Zugang zu Leben und Werk Prousts bietet der Dictionnaire Marcel Proust von Bouillaguet und Rogers (2004), der bei der Übersetzung aus dem Französischen durch Luzius Keller und Melanie Walz unter dem Titel Marcel Proust Enzyklopädie (2009) obendrein einige wesentliche Erweiterungen erfahren hat. Für ganz Eilige sei schließlich noch auf den kompakten Überblick über Leben und Werk von K. Biermann (2005) hingewiesen sowie auf die CD Suchers Leidenschaften. Marcel Proust. Eine Einführung in Leben und Werk, gelesen von Gerd Wameling und C. Bernd Sucher (Argon, 2012).
Eine Sammlung von 14 Essays über die Freunde und Bekannten Prousts erschien 2010 bei Gallimard. Eine Biographie von Prousts Vater erschien 2003 unter dem Titel Le Dr Adrien Proust, eine Biographie seiner Mutter 2004 unter dem Titel Madame Proust. Einem besonderen Aspekt des Lebens Prousts geht 2014 Rubén Gallo nach, der überraschend viele Lateinamerikaner in Prousts Umfeld entdeckt.
1943 Ramon Fernandez: À la gloire de Marcel Proust. Paris: Éditions de la Nouvelle Revue Critique, 1943. [Mit Faksimiles und Fotografien Prousts, seiner Familie und seines Umfeldes.]
1949 André Maurois: À la recherche de Marcel Proust. Paris: Hachette, 1949. [Dt.: Auf den Spuren von Marcel Proust. Übers. von Ruth Uecker-Lutz. Hamburg: Claassen, 1956. Neuausg. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1971.]
1949 Léon Tauman: Marcel Proust. Une vie et une synthèse. Paris: Librairie Armand Colin, 1949.
1953 Claude Mauriac (Hrsg.): Marcel Proust par lui-même. Paris: Éditions du Seuil, 1953. [Dt.: Marcel Proust in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Übers. von Eva Rechel-Mertens. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1958.]
1959 Henri Bonnet: Marcel Proust de 1907 à 1914. Essai de biographie critique. Avec un supplément bibliographique. Paris: Nizet, 1959.
1959 George Painter: Marcel Proust. A Biography. London: Chatto & Windus, 1959.
1984 Pierre-Louis Rey: Marcel Proust. Sa vie, son œuvre. Paris: Birr, 1984. [Dt.: Marcel Proust – Eine Bildbiographie. München: Heyne, 1990.]
1987 Philippe Michel-Thiriet: Quid de Marcel Proust. Paris: Laffont, 1987. [Dt.: Das Marcel Proust Lexikon. Übers. von Rolf Wintermeyer. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992.]
1991 Alain Buisine: Proust. Une journée particulière. Samedi 27 novembre 1909. Paris: Lattès, 1991. [Coll. Une journée particulière.]
1991 Ghislain de Diesbach: Proust. Paris: Perrin, 1991.
1992 Renate Wiggershaus: Marcel Proust. Leben und Werk in Texten und Bildern. Frankfurt a. M. / Leipzig: Insel-Verlag, 1992.
1994 Roger Duchêne: L’Impossible Marcel Proust. Paris: Laffont, 1994.
1994 Michel Erman: Marcel Proust. Paris: Fayard, 1994.
1996 Jean-Yves Tadié: Marcel Proust. Paris: Gallimard, 1996. [Dt.: Marcel Proust. Übers. von Max Looser. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2008.]
1999 Edmund White: Marcel Proust. New York: Viking Press, 1999. (Penguin Lives Series.). [Dt.: Proust. Übers. von Monika Noll. Hildesheim: Claassen, 2001]
2000 William C. Carter: Marcel Proust. A Life. New Haven / London: Yale University Press, 2000.
2001 Ronald Hayman: Proust. A Biography. London: Heinemann, 1990. [Dt.: Marcel Proust. Die Geschichte seines Lebens. Übers. von Max Looser. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2001.]
2003 Mary Ann Caws: Marcel Proust. Woodstock [u. a.]: Overlook Press, 2003.
2003 Daniel Panzac: Le Dr Adrien Proust, père méconnu, précurseur oublié. Paris: L’Harmattan, 2003.
2004 Évelyne Bloch-Dano: Madame Proust. Paris: Grasset & Fasquelle, 2004. [Dt.: Madame Proust. Übers. von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz. Berlin: Classen, 2006.]
2004 Annick Bouillaguet / Brian G. Rogers (Hrsg.): Dictionnaire Marcel Proust. Paris: Champion, 2004. [Dt.: Luzius Keller (Hrsg.): Marcel Proust Enzyklopädie. Übers. von Luzius Keller und Melanie Walz. Hamburg: Hoffmann und Campe, 2009.]
2005 Karlheinrich Biermann: Marcel Proust. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 2005.
2010 Jean-Yves Tadié (Hrsg.): Proust et ses amis. Paris: Gallimard, 2010.
2013 Adam Watt: Marcel Proust. London: Reaktion Books, 2013.
2014 Rubén Gallo: Proust’s Latin Americans. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 2014.
2017 Andreas Isenschmid: Marcel Proust (Leben in Bildern). Berlin/München: Deutscher Kunstverlag, 2017.
Erinnerungen
1923 Robert de Montesquiou: Les Pas effacés. Mémoires. Paris: Émile-Paul, 1923.
1925 Élisabeth de Clermont-Tonnerre: Robert de Montesquiou et Marcel Proust. Paris: Flammarion, 1925.
1925 Louis de Robert: s. Briefe.
1926 Robert Dreyfus: Souvenirs sur Marcel Proust (accompagnés de lettres inédites). Paris: Grasset, 1926.
1928 La Princesse [Marthe] Bibesco: Au bal avec Marcel Proust. Paris: Gallimard, 1928. (Les Cahiers Marcel Proust. 4.) [Dt.: Begegnungen mit Marcel Proust. Übers. von Eva Rechel-Mertens. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1972.]
1928 Jacques-Émile Blanche: Mes modèles. Paris: Stock, 1928.
1929 Lucien Daudet: s. Briefe.
1929 Élisabeth de Gramont: Les marronniers en fleurs. Mémoires II. Paris: Grasset, 1929.
1930 Robert de Billy: s. Briefe.
1932 Daniel Halévy: Pays parisiens. Paris: Grasset, 1932.
1933 Reynaldo Hahn: Notes. Journal d’un musicien. Paris: Plon, 1933.
1934 Gustave Schlumberger: Mes souvenirs, 1844–1928. Paris: Plon, 1934.
1935 Jean Cocteau: Portraits-souvenirs 1900–1914. Paris: Grasset, 1935.
1935 Marie Scheikévitch: Souvenirs d’un temps disparue. Paris: Plon, 1935.
1937 Reynaldo Hahn: L’Oreille au guet. Paris: Gallimard, 1937.
1939 Maurice Sachs: Au temps du Bœuf sur le Toit. Paris: Grasset, 1939
1946/48/49 Maurice Sachs: Le Sabbat. Souvenir d’une jeunesse orageuse. Paris: Corréa, 1946. – Chronique joyeuse et scandaleuse. Ebd. 1948. – La chasse à courre. Ebd. 1949. [Dt.: Der Sabbat. Eine Chronique scandaleuse. Übers. von Herbert Schlüter. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1970.]
1947 Fernand Gregh: L’Âge d’or. Souvenirs d’enfance et de jeunesse. Paris: Grasset, 1947.
1947 François Mauriac: Du côté de chez Proust. Paris: La Table Ronde, 1947.
1949 Paul Morand: s. Briefe.
1953 Edmond Jaloux: Avec Marcel Proust. Suivi de 17 lettres inédites. Paris: La Palatine, 1953.
1958 Fernand Gregh: s. Briefe.
1966 Marcel Plantevignes: Avec Marcel Proust. Causeries-Souvenirs sur Cabourg et le Boulevard Haussmann. Avec une préface du Maître Gustave Pimienta. Paris: Nizet, 1966.
1972 Maurice Duplay: Mon ami Marcel Proust. Souvenirs intimes. Paris: Gallimard, 1972. (Cahiers Marcel Proust. 5.)
1974 Céleste Albaret: Monsieur Proust. Souvenirs recueillis par Georges Belmont. Paris: Laffont, 1973. [Dt.: Monsieur Proust. Übers. von Margret Carroux. München: Kindler, 1974.]
1992 Léon Daudet: Souvenirs et polémiques. Hrsg. von Bernard Oudin. Paris: Laffont, 1992.
1992 Daniel Halévy: s. Briefe.
Herkunft
Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust wurde am 10. Juli 1871 als erster Sohn des Arztes Adrien Proust und dessen Gattin Jeanne, geb. Weil, in dem noblen Pariser Viertel Auteuil (Teil des 16. Arrondissements) geboren, im Haus seines Großonkels mütterlicherseits, Louis Weil.
Die Seite von Illiers Die Familie Proust stammte aus der etwa 100 km südwestlich von Paris gelegenen Kleinstadt Illiers (ca. 3000 Einwohner, Dép. Eure-et-Loir), wo der Großvater Marcels, Valentin Proust, ein Lebensmittel- und Kurzwarengeschäft am Marktplatz betrieb; dieser Großvater starb bereits 1855, vor Marcels Geburt. Die Großmutter, Virginie, geb. Torcheux, betrieb das Geschäft weiter und wohnte bis zu ihrem Tod 1889 an Urämie in Illiers.
Bei ihren Besuchen in Illiers stiegen die Prousts jedoch nicht bei Marcels Großmutter ab, sondern bei der Schwester Élisabeth seines Vaters, die mit dem Besitzer des größten Modegeschäfts am Ort, Jules Amiot, verheiratet war und in der Rue du Saint-Esprit wohnte; Élisabeth dürfte in vielen Hinsichten ein Vorbild für die Tante Léonie in Combray geliefert haben, auch wenn sich die Verwandtschaftsverhältnisse etwas verschoben haben: Die Mutter von Léonie tritt als Großtante Marcels auf, nicht als seine Großmutter.
Die Amiots beschäftigten eine Haushälterin, Ernestine Gallou, ein Vorbild zumindest für die Françoise in Combray. Jules Amiot pflanzte als hingebungsvoller Botanik-Liebhaber in Illiers nach dem Vorbild des Bois de Boulogne den öffentlich zugänglichen englischen Garten »Pré Catelan«, der sicherlich für Swanns Parkgrundstück Pate gestanden hat.
Der Vater Prousts, Adrien, hatte sich als Arzt auf Seuchenbekämpfung spezialisiert und erwarb sich in dieser Funktion weltweite Anerkennung. So beriet er den Schah von Persien und den Großwesir des Osmanischen Reiches in Fragen der Volkshygiene und insbesondere bei der Bekämpfung der Cholera.
Die Seite von Auteuil Der Großvater väterlicherseits von Marcels Mutter Jeanne, Baruch Weil, war vor 1800 aus dem Elsass (Niedernai) in das damals außerhalb der Stadt gelegene Dorf Auteuil bei Paris gezogen und hatte dort eine Porzellanmanufaktur gegründet, die die Grundlage für das nicht unerhebliche Vermögen der Weils bildete, das der Vater von Jeanne, Nathé Weil, als Börsenmakler noch zu mehren verstand. Marcel machte von dieser Seite her erhebliche Erbschaften, die ihm nicht nur in seinem Roman ein Leben auf großem Fuß ermöglichten. Nathés Bruder Lazard, genannt Louis, war ebenfalls ein äußerst erfolgreicher Geschäftsmann; seine Knopffabrik beschäftigte zeitweilig 5000 Arbeiter. Er kaufte sich in Auteuil das Haus, in dem Proust später geboren wurde, und lebte dort ein vergnügtes Leben, das in seiner Familie durchaus Missfallen erregte, insbesondere sein Zusammenleben mit der als Kurtisane beschriebenen Laure Hayman, die Proust bei seinem Onkel kennenlernte und die wie Odette in der Rue La Pérouse wohnte. Proust erbte von Onkel Louis eine Sammlung von Schauspielerinnen-Fotografien, über deren genaueren Charakter sich nur Vermutungen anstellen lassen – Elstirs Porträt der androgynen Miss Sacripant soll jedoch eine Fotografie der amerikanischen Sängerin Marie van Zandt zugrunde liegen, die diese Prousts Vater zueignete.
Der Großvater mütterlicherseits von Jeanne, Nathanael Bernkastel, war ebenfalls um Anfang des 19. Jahrhunderts aus Trier nach Paris gezogen und hatte sich dort als Kaufmann einen ansehnlichen Wohlstand erworben. In der Familie Bernkastel wurde noch viel Deutsch gesprochen, das insbesondere Jeannes Mutter, Adèle Bernkastel, noch beherrschte; so gibt es einen Brief von Proust an diese Großmutter, in dem er gar nicht mal schlecht auf Deutsch und in deutscher Schreibschrift seine Glückwünsche zu ihrem Geburtstag übermittelt (Abb. S. 286). Auch sein Brief an Ernst Robert Curtius vom 7./8. März 1922 lässt vermuten, dass seine Deutschkenntnisse genügten, um sich zumindest einen Eindruck von Curtius’ Aufsatz über Proust im Neuen Merkur verschaffen zu können, den er am 28. Februar erhalten hatte. Bei seiner Prüfung im März 1895 für die »Licence ès lettres« (etwa: Magisterprüfung) galt zudem Deutsch als Prousts zweite Sprache.
Adèle, die in mehreren literarischen Salons verkehrte, hat zweifellos ihre Vorlieben für Madame de Sévigné, Saint-Simon und George Sand an ihre Tochter weitergegeben, die eine gründliche humanistische Erziehung genießen durfte. Marcel konnte so in einem liberalen, gleichermaßen natur- wie geisteswissenschaftlich interessierten und anregenden Haushalt aufwachsen.
Der katholische Adrien Proust und die jüdische Jeanne Weil heirateten am 3. September 1870 standesamtlich. Der Ehe entspross noch ein zweiter Sohn, Robert (1873–1935), der wie sein Vater Arzt wurde. Beide Kinder wurden katholisch getauft. Nach Marcels Tod kümmerte sich Robert um die hinterlassenen Manuskripte und edierte zusammen mit Jacques Rivière die letzten drei Bände der Recherche.
Die Tochter von Robert Proust mit Marthe Dubois-Amiot, Adrienne, gen. Suzy, verh. Mante, war eine glühende Verehrerin ihres Onkels Marcel und seines literarischen Werkes; sie erbte nach dem Tod ihres Vaters ein umfangreiches Konvolut an Manuskripten und Briefen, das sie sorgfältig hütete und von dem große Teile, wie insbesondere das sog. Mauriac-Typoskript (vgl. S. 278 f.), eine Überarbeitung von Albertine disparue, erst nach ihrem Tod 1986 ans Tageslicht kamen. Nicht zuletzt diese Entdeckungen ließen die Neuausgabe der Recherche durch Jean-Yves Tadié wünschenwert erscheinen.
Die Tochter Louise Neuberger der Cousine Laure Lazarus von Prousts Mutter Jeanne (Tochter der Schwester Adèle von Jeannes Vater Nathé) heiratete 1892 den französischen Philosophen Henri Bergson, bei dessen Hochzeit Proust den Trauzeugen abgab. Proust und Bergson hatten sich bereits 1890 kennengelernt, waren aber allem Anschein nach an einem Gedankenaustausch nicht weiter interessiert, wenn auch Bergson 1904 Prousts Übersetzung von Ruskins Bible of Amiens der Académie in äußerst lobenden Tönen vorstellte. Die Mutter seiner Großmutter Adèle Weil war zudem eine Schwester der Großmutter von Valentine Peigné-Crémieux (1855–76), die mit dem erfolgreichen orientalistischen Gleyre- und Gérôme-Schüler Jean-Jules Lecomte du Nouÿ (1842–1923) verheiratet war, allerdings noch im Jahr der Eheschließung starb. Von du Nouÿ stammt das bekannte Porträt von Marcels Vater Adrien, das wohl nur dieser Verwandtschaft, die der Maler weiterhin pflegte, zu verdanken sein dürfte, denn ansonsten sind von ihm an Porträts nur solche seiner zweiten Frau Caroline Evrard (1851–92) bekannt. Über die Familie Weil war Proust zudem auch mit Karl Marx verschwägert, jedoch nur so weitläufig, dass er es selbst nicht wusste: eine der Ururgroßmütter von Prousts Großvater Nathé Weil war eine Schwester einer Ururgroßmutter von Karl Marx. Die Eltern der beiden Schwestern und damit die letzten gemeinsamen Vorfahren von Marcel Proust (sieben Generationen zurück) und Karl Marx (fünf Generationen zurück) waren Aaron Moïse Ezechiel Lwow (in deutschen Urkunden häufig »Lemberg« oder »Lemberger«, in französischen Urkunden meist »Levouf«; 1660–1712) und Bat Samuel Cohen (gest. 1700). Zu weiteren Details s. den Stammbaum in Kap. VIII.
Ausbildung und Beruf
Proust besuchte zusammen mit Jacques Bizet, dem Sohn des Komponisten Georges Bizet, die Grundschule und anschließend das renommierte Lycée Condorcet im 9. Arrondissement, wo die beiden zusammen mit Daniel Halévy, dem Sohn des Librettisten Ludovic Halévy, und Robert Dreyfus einen engen Freundeskreis bildeten. Sein Lehrer Alphonse Darlu, der in der Oberstufe des Condorcet Philosophie unterrichtete und einen spiritualistischen Rationalismus vertrat, wurde von Proust außerordentlich geschätzt und dürfte einen nachhaltigen Einfluss auf ihn ausgeübt haben. Am Condorcet lernte Proust neben dem obligatorischen Latein auch Altgriechisch immerhin so weit, dass er Übersetzungen aus dem Französischen ins Altgriechische anfertigen konnte.
Geneviève Straus, die Mutter von Jacques Bizet und Tochter des Komponisten Fromental Halévy, öffnet Proust ihren berühmten Salon und gibt ihm so Gelegenheit, bedeutende Künstler seiner Zeit zu treffen, wie ihm auch das Condorcet Gelegenheit gab, viele Sprösslinge bedeutender Familien kennenzulernen. Am Condorcet lernte Proust auch Horace Finaly kennen, der wie sein Vater, der äußerst vermögende Bankier Hugo Finaly, Finanzfachmann wurde und Proust bei seinen Geldanlagen beriet.
In seinen späteren Schuljahren engagierte Proust sich zusammen mit seinen Freunden für verschiedene hektographierte Schülerzeitschriften mit literarischem Anspruch – Le Lundi, La Revue de seconde, La Revue lilas, La Revue verte –, die es zwar jeweils nur auf wenige Nummern brachten, aber die literarischen Interessen des Freundeskreises formten, der sich in der Folgezeit immer wieder mit ähnlichen Projekten befasste.
Um der Wehrpflicht zu entgehen, die fünf Jahre betrug, meldete sich Proust 1889 freiwillig für ein Jahr zum Militär. Er leistete seinen Dienst in Orléans ab, nahm sich ein Zimmer und lebte nur pro forma in der Kaserne. Aufgrund seiner schwachen Gesundheit wurde er vom Morgenappell und den anstrengendsten Übungen freigestellt, wie auch später von Wehrübungen. Prousts militärische Laufbahn war vielleicht kein Gewinn für Frankreich, aber sicherlich für Proust selbst, der bei einem Diner des Präfekten des Dép. Loiret den späteren Diplomaten Robert de Billy (1869–1953) kennenlernte, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband, die sich in einem umfangreichen Briefwechsel niederschlug.
Nach dem Militärdienst schrieb sich Proust an der juristischen Fakultät und an der École libre des sciences politiques ein, wo er zwar ausgewählte Vorlesungen mit Interesse anhörte, das Studium jedoch niemals ernstlich aufnahm: »Etwas Grauenvolleres als den Anwaltsberuf habe ich mir selbst in den Tagen meiner größten Verzweiflung nicht vorstellen können« (Brief vom 28. 9. 1893 an den Vater, Corr. I, S. 238). Immerhin besuchte er in der juristischen Fakultät die Vorlesungen von Paul Desjardins (1859–1940), der ihn auf Ruskin aufmerksam machte, und an der École libre lernte er den symbolistischen Dichter Gabriel Trarieux (1870–1940) kennen, der ihm die Bekanntschaft mit André Gide vermittelte. 1892 erwarb er sein Diplom als Lizentiat in Jura. 1894/95 hörte Proust verschiedene philosophische Vorlesungen an der Sorbonne, insbes. die von Victor Egger und von Charles Secrétan, und bestand im März 1895 seine Prüfung zum Lizentiat in Philosophie.
Neben seinem lustlosen Studium beschäftigt sich Proust vor allem mit der Zeitschrift Le Banquet, die Ferdinand Gregh 1892 gegründet hatte und an der seine alten Schulkameraden Bizet, Halévy, Dreyfus und Robert de Flers sowie Gabriel Trarieux beteiligt waren; sie erschien ein Jahr lang, mit 8 Heften insgesamt, in denen sich jedoch bereits Studien Prousts befinden, die dann später in mehr oder weniger veränderter Form in Les Plaisirs et les Jours Eingang fanden und schon die Hand des zukünftigen Meisters spüren lassen. Dennoch fühlte sich die Redaktion bemüßigt, sich in einem Hinweis von Prousts wohlwollendem Blick auf das mondäne Leben zu distanzieren – was einigermaßen überflüssig war, denn nach dem nächsten Heft war die Kasse leer. Während dieser Zeit entwickelte sich eine enge Beziehung zwischen Proust und dem Marquis Robert de Flers (1872–1927), der in der Folgezeit Karriere als Journalist und Bühnenautor machte.
Nach vielen unrealistischen Überlegungen hinsichtlich einer diplomatischen Laufbahn oder einer Verwaltungslaufbahn nahm Proust schließlich im Juni 1895 eine Stelle als Bibliothekar bei der bedeutenden Bibliothèque Mazarine an, sieht aber diese Stelle offenbar als eine Fortsetzung seines Studiums: »Er war der am wenigsten ›mitarbeitende‹ Mitarbeiter von allen und nahm einen Urlaub nach dem anderen« (André Maurois, À la recherche de Marcel Proust, S. 82); schließlich wurde ihm im Dezember desselben Jahres ein einjähriger Urlaub bewilligt. 1900 wurde überraschenderweise sein Fehlen bemerkt und sein Dienst beendet.
Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs Anfang August 1914 rückten die deutschen Truppen binnen weniger Wochen bis auf wenige Kilometer an Paris heran. Proust wurde Zeuge der Bombardierung der Stadt durch Zeppeline und des Abwehrkampfes am nächtlichen Himmel. Anfang September brachte er sich dann aber doch, wie viele seiner Freunde zuvor, nach Cabourg an der normannischen Küste in Sicherheit, wo er sich an der Betreuung von Verwundeten in Hospitälern beteiligte. Dass er selbst trotz Kampfeswillen nicht kriegsverwendungsfähig war, war ihm klar, jedoch nicht der Militärbürokratie, die den dreiundvierzigjährigen Asthmatiker einziehen wollte – bis ihn 1915 zwei Militärärzte besuchten und »musterten«. Sein Bruder Robert arbeitete in Feldlazaretts, mehrere seiner engsten Freunde wie Reynaldo Hahn kämpften als Freiwillige an der Front, und die täglichen Gefallenenlisten in den Zeitungen berührten ihn unmittelbar: »durch die schreckliche Gewöhnung an die tägliche Angst hat der Krieg uns eine neue Fähigkeit verliehen, nämlich die, uns für Unbekannte leiden lassen zu können« (Brief an die Prinzessin Soutzo vom 29./30. 10. 1917; Corr. XVI, S. 272). Der Tod des nahen Freundes Robert d’Humières 1915, der ihm bei der Ruskin-Übersetzung assistiert hatte, und vor allem des angebeteten Freundes Bertrand de Fénelon schon in den ersten Kriegsmonaten, im Dezember 1914, stürzte Proust in eine tiefe Depression, die unübersehbar Ausdruck in seiner Behandlung der Weltkriegserfahrung in Le Temps retrouvé gefunden hat. Die Zusammenführung des Obszönen und des Erhabenen, die Koinzidenz von Prostitution und Heldentum in dem Orden, den Saint-Loup im Bordell verliert, das Abgleiten der Erotik in die »Darkrooms« der Métroschächte bei Fliegerangriffen zeigen, in welch hohem Maße Proust die »Grande Guerre« als die Perversion der christlichen Zivilisation wahrgenommen hat: der Feuersturm von Sodom wird parodistisch zum Brutofen für Homosexualität verkehrt, die Selbstzerstörung des Abendlandes – wie der Erste Weltkrieg jedenfalls von Prousts Zeitgenossen wahrgenommen wurde, die vom zweiten noch nichts wussten – findet ihren metaphorischen Ausdruck in der masochistischen Flagellation Charlus’ in Jupiens Bordell.1
Proust war bereits 1913 mit dem ersten Band der Recherche für den äußerst renommierten und elitären Prix Goncourt vorgeschlagen worden, der jedoch an Marc Elder für Le Peuple de la mer ging. Mit dem zweiten Band dann war Proust erfolgreicher: bei der Nominierung für 1919 stimmten sechs Mitglieder der Jury für sein Werk, die anderen vier dagegen für Roland Dorgelès’ (d. i. Roland Lécavelé, 1885–1973) Les Croix de bois (dt. Die hölzernen Kreuze, Übers. Tony Kellen und Erhard Wittek, Horw-Luzern/Stuttgart/Leipzig: Montana-Verlag, 1930; von Tucholsky euphorisch besprochen). Die Entscheidung der Académie Goncourt wurde in der Presse scharf angegriffen, zum Teil mit absurden Argumenten (»ein Talent von jenseits des Grabes«), im wesentlichen aber mit der Begründung, dass in einer Zeit, die noch immer ihre Toten zähle, eine Auseinandersetzung mit der gesamteuropäischen Katastrophe des Weltkrieges angemessener und notwendiger sei als die mit den Problemen halbseidener Damen der Belle Époque oder spätpubertärer Jugendlicher im Luxusurlaub: »Diese Collage ruheloser Grübeleien … steht im Missklang mit dem neuerwachten klassischen Geist, den die Partei der Intelligenz für allein verträglich mit der Größe unserer siegreichen Nation erachtet« (beide Zitate von dem bis dahin mit Proust befreundeten Jean de Pierrefeu am 12. 12. 1919 immerhin im Journal des débats, einem liberal-konservativen Wochenmagazin, das hohes Ansehen nicht nur bei dem »Parti de l’Intelligence«2 genoss); Proust geißelt dann übrigens dieses verengte Verständnis von Literatur in einer Passage der Recherche (WZ, S. 268–271 und 278 f.) ausgiebig. Auf kurze Sicht jedoch gab das Publikum den Nörglern recht: Die Croix de bois erzielten bis Mitte 1920 eine viermal so hohe Auflage wie die Jeunes filles en fleurs (79 779 gegenüber 19 600). Auf lange Sicht haben sich die Verhältnisse bekanntlich umgekehrt, jedoch wird auch Dorgelès’ Buch noch immer aufgelegt, so 2014 bei Magnard, und 1988 erschien eine Überarbeitung der deutschen Übersetzung von 1930 bei Kiepenheuer.
Gesundheit
Der Eukalyptus-Zerstäuber, den Proust mit in die Bibliothèque Mazarine nahm, weil ihn der Staub irritierte, hat ihn sicherlich einige Sympathien seiner Kollegen gekostet, lässt aber auch seine bürgerliche Laufbahn in einem milderen Licht erscheinen; Proust war wirklich von schwacher Konstitution. Schon als Zehnjähriger litt er an Asthmaanfällen, die ihn zunehmend in seinem gesellschaftlichen Leben beschränkten, aus dem er sich ab 1906 dann auch weitgehend zurückzog. Um die durch Atemnot bedingte Schlaflosigkeit zu bekämpfen, experimentierte er mit allen möglichen Arzneien und Drogen herum, die ihm womöglich kreative Träume bescherten, die sich dann auch in der Suche wiederfinden, aber seine Konstitution nur weiter untergraben haben dürften. Berühmt-berüchtigt sind seine »fumigations« mit Legras-Pulver geworden, bei denen er sein Schlafzimmer mit Dämpfen zunebelte, die ihm Luft verschaffen sollten.
Oben »doute«, 966 Vorkommen; unten »amour«, 933 Vorkommen (Seitenzahl des Typoskripts meiner Übersetzung der Recherche aufgetragen über der Nummer des Vorkommens des jeweiligen Wortes).
Der Arzt Dr. Pierre Merklen hatte 1904 Prousts Asthma als nervös bedingt diagnostiziert. Proust verbrachte daraufhin von Anfang Dezember 1905 bis Mitte Januar 1906 sechs Wochen im Sanatorium des Neurologen Dr. Paul-Auguste Sollier (1861–1933) in Boulogne-sur-Seine zur Behandlung seiner »Neurasthenie«, jedoch nach seiner eigenen Einschätzung ohne nennenswerten Erfolg. Dennoch dürfte dieser Aufenthalt in anderer Hinsicht Früchte getragen haben, denn Solliers Therapie baute nicht nur auf Isolation, sondern auch auf der Auslösung »unwillentlicher Erinnerungen« auf. Proust mag hier also auf ein entscheidendes Konzept für die Umgestaltung des Jean Santeuil zur Recherche gestoßen sein: vgl. dazu etwa die Titel von Solliers Monographien Les Troubles de la Mémoire (1892) oder Le Problème de la Mémoire (1900). Auf den Zusammenhang zwischen Prousts zentralem Thema und Solliers Spezialgebiet haben wohl als erste Bogousslavsky und Walusinski3 hingewiesen. Besonderen Einfluss dürfte aber die zur Konzeption der Recherche zeitlich nahe Schrift Le doute (1909) von Sollier ausgeübt haben, denn das Konzept des Zweifels zieht sich wie ein roter Faden durch die Recherche: das Wort »doute« tritt ungefähr ebenso häufig auf wie das Wort »amour«, jedoch mit unübertroffener Regelmäßigkeit: die Liebe zwar kommt und geht, der Zweifel aber besteht.
Zu Erwähnungen Solliers durch Proust vgl. insbes. jene in den Carnets S. 51, wo er die Pfiffe der Lokomotive aus dem Auftakt zu Combray in Verbindung mit dem Aufenthalt bei Sollier bringt, sowie etliche in der Correspondance.
Aus heutiger Sicht deutet das Auftreten der Asthmaanfälle vor allem im Frühjahr und insbesondere in Parks und Gärten auf eine Pollenallergie hin, die meist mit einer Hausstauballergie einhergeht; unter diesem Aspekt war Prousts Entschluss, 1910 sein Schlafzimmer am Boulevard Haussmann zur Geräuschdämmung mit Korktapeten ausschlagen zu lassen, ohne Zweifel kontraindiziert.
Seine letzten Lebensjahre verbrachte Proust vorwiegend schreibend im Bett. Kurz nach der Fertigstellung des Manuskripts zu seinem Hauptwerk À la recherche du temps perdu starb er am 18. November 1922 in seiner Wohnung in Paris an Lungenentzündung. Die geeigneten Antibiotika standen erst ab 1935 zur Verfügung.
Liebschaften
Prousts erste Jugendliebe war den Quellen zufolge Marie Bénardaky (1874–1949), zweifellos ein Vorbild für Gilberte, die in der Nähe der Champs-Élysées (Rue de Chaillot) wohnte, wo er ihr 1886 begegnete, mit der er dort Barlauf spielte und die er in einer Widmung von 1918 für Jacques de Lacretelle als »eine der beiden großen Lieben meines Lebens« bezeichnete – ohne allerdings die zweite zu benennen. Aber Marie schien nicht viel von ihm wissen zu wollen.
Vermutlich im Frühjahr 1888 schrieb Proust einen Brief an seinen Schulfreund Jacques Bizet, der darauf schließen lässt, dass Proust ihm zuvor einen Antrag gemacht hatte, der Jacques wohl nicht willkommen war (»Ich finde es traurig, die Frucht nicht zu pflücken, die wir schon bald nicht mehr werden pflücken können. Dann wäre es schon … die verbotene Frucht. Aber jedenfalls findest Du sie ja jetzt schon vergiftet«; Corr. I, S. 104). Jacques wurde später Taxiunternehmer in Monaco und vermittelte Proust den Fahrer Alfred Agostinelli, der später noch eine erhebliche Rolle in Prousts Leben spielte.
Im Oktober 1888 reichte Proust bei der von ihm mitgegründeten Schülerzeitschrift La Revue lilas ein kräftig homoerotisch getöntes Prosagedicht Glaukos ein (Übers. in: Nachgelassenes), das als zu skandalös abgewiesen wurde und Daniel Halévy gemeint haben dürfte: Man muss nicht nur die Bravour bewundern, mit der der damals siebzehnjährige Schüler die übliche Verstellung verweigerte, sondern auch die Gelassenheit, mit der die Adressaten die offenbar unerwünschten Anträge auf sich beruhen ließen.
Eine Freundschaft, mit der Proust offenbar große Hoffnungen verband, war die zu Willie Heath, einem jungen Engländer, den Proust im Frühjahr 1893 im Bois de Boulogne kennenlernte und der bereits ein halbes Jahr später, am 3. Oktober 1893, an Ruhr starb. In der Widmung »Meinem Freund Willie Heath« von Les Plaisirs et les Jours schreibt Proust: »Wir träumten davon, wir hatten uns geradezu fest vorgenommen, immer inniger in einem Kreis großherziger, auserlesener Frauen und Männer zusammenzuleben, von Dummheit, Laster und Bosheit weit genug entfernt, um uns vor den Pfeilen ihrer Vulgarität sicher zu fühlen.«
Im Herbst 1901 lernte Proust den Comte Bertrand de Salignac-Fénelon (1878–1914) durch den gemeinsamen Bekannten Antoine Bibesco kennen. Offenbar entwickelt sich zwischen den beiden schnell ein enges Freundschaftsgefühl: Die Szene aus Guermantes, in der Saint-Loup über die Bänke im Restaurant steigt, um Marcel einen Mantel zu besorgen, hat ihr Vorbild im Restaurant Larue, wo Bertrand sich entsprechend verhielt. 1902 jedoch kam das Erwachen: Die beiden unternahmen eine gemeinsame Reise durch Holland, die Proust sich wohl recht sentimental vorgestellt hatte, von der er jedoch äußerst deprimiert an seine Mutter berichtete. Fénelon ging kurz darauf als Attaché nach Konstantinopel, meldete sich dann als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg und fand 1914 den Tod. Proust betrauerte ihn zutiefst.
Alfred Agostinelli (1888–1914) schließlich, der letzte in diesem Reigen tragischer Liebesaffären, war Proust von seinem Kollegen Odilon Albaret, dem Gatten von Prousts Haushälterin Céleste Albaret und Chauffeur bei Jacques Bizets monegassischem Taxi- und Mietwagen-Unternehmen, als Fahrer vermittelt worden. 1907 und 1908 machten Proust und Agostinelli zahlreiche Ausflüge vor allem in die Normandie und die Bretagne, die in Prousts Figaro-Artikel »Reiseeindrücke im Automobil«4 ihren Niederschlag gefunden haben. Im Sommer 1913 stellte Proust Agostinelli abermals ein, diesmal als Sekretär, der seine Manuskripte abtippen sollte; Agostinelli wohnte in dieser Zeit zusammen mit seiner (übrigens als hässlich verschrienen) angeblichen Frau Anna Square in der Wohnung Prousts, der zudem Anna eine Beschäftigung am Théâtre des Variétés beschaffen sollte. Im Dezember jedoch kehrten die beiden Knall auf Fall Proust und Paris den Rücken, und Alfred meldete sich als »Marcel Swann« bei einer Pilotenschule in Antibes an. Proust setzte alle Hebel in Bewegung, um ihn zur Rückkehr zu bewegen, aber vergebens. Nachdem Agostinelli mit 26 Jahren seinen Pilotenschein erworben hatte, versprach Proust, ihm ein Flugzeug zu kaufen, in das Verse aus Baudelaires Le Cygne eingraviert werden sollten. Bevor es dazu kommen konnte, stürzte er jedoch schon bei seinem zweiten selbständigen Flug ab. Seine von den Fischen übel zugerichtete Leiche wurde erst eine Woche später gefunden. Proust war von Alfreds Tod so sehr erschüttert, dass er sich mit Selbstmordgedanken trug. An André Gide schrieb er: das »Maß ist übervoll geworden durch den Tod eines jungen Freundes, den ich wohl mehr geliebt haben mag als alle anderen« (Corr. XIII, S. 245).
Als Lebensgefährte Prousts wird häufig Reynaldo Hahn (s. unten) genannt, und sicherlich war diese lebenslange Freundschaft von zärtlicher Zuneigung geprägt, wie die etwas infantile Turtel-Sprache der Briefe Prousts an Hahn ausweist. Die frühen Briefe geben allerdings Anlass zu der Vermutung, dass die Beziehung zumindest in ihrer Anfangsphase auch sexuelle Aspekte aufwies. So schreibt Proust am 16. Oktober 1894 in wohl eindeutig zweideutiger Absicht an Hahn: »Ihre kleine Gans, die dabei ist, im Stall zu spielen, trägt mir ihre ehrerbietigsten Grüße an den kleinen Meister auf, als dessen respektvolle Diener wir uns zu bezeichnen wagen.« Über die körperlichen Aspekte von Prousts Liebesleben gehen allerhand Gerüchte um, denen Céleste Albaret in ihren Erinnerungen allerdings energisch entgegentritt. Unbestritten sind aber wohl zahlreiche Ausflüge in das Männerbordell, das Albert de Cuziat in der Rue de l’Arcade seit 1916 betrieb. Die dort gesammelten Erfahrungen haben sich – eventuell nur zum Teil – in dem Hotel Jupiens niedergeschlagen, in dem Marcel in Le Temps retrouvé vorgeblich unwissentlich landet. Proust war bereits seit 1911 mit de Cuziat gut bekannt, dessen umfangreiche Kenntnisse aristokratischer Genealogien er schätzte.
Etwas unklar ist in dieser Hinsicht Prousts Verhältnis zu der Schauspielerin Louisa de Mornand, der Geliebten seines Freundes Louis d’Albufera. Louis hatte Proust offenbar in Verdacht, mit Louisa angebändelt zu haben, was dieser aber im Juni 1903 in einem Gedicht an Albufera (in: Cahiers Marcel Proust 10, S. 141–143) weit von sich weist. Ein Gedicht an Louisa selbst vom April 1904 beweist allerdings eine verdächtige Vertrautheit Prousts mit ihrem Boudoir (siehe Cahiers Marcel Proust 10, S. 127 f.) – ein Verdacht, den sie 1928 in einem Interview mit der Zeitschrift Candide allem Anschein nach bestätigt –, wogegen dann allerdings wieder Prousts Brief an Louisa vom 9. Juli 1903 zu sprechen scheint: »glauben Sie nicht, dass dies eine indiskrete, anmaßende und fehlgeleitete Art sei, Ihnen den Hof zu machen. Nicht nur, dass das sinnlos wäre, denn Sie würden mich schnellstens davonjagen, ich würde auch lieber eher sterben, als die Augen zu der bewunderten Frau eines Freundes zu erheben …« (Corr. III, S. 366); aber danach mag ja noch viel passiert sein!
Bekanntschaften
Nicht ganz ohne Grund hatte André Gide Proust als einen »mondain amateur« eingeschätzt (Brief vom 11. 1. 1914, s. auch unten): Schulfreunde führten ihn in die Salons ihrer Mütter ein, wo er offenbar mühelos neue Freundschaften schloss, die ihn in weitere Salons einführten, und so weiter. Der Kreis der Freunde und Bekannten wuchs damit ins Uferlose, so dass hier nur die wichtigsten Persönlichkeiten hervorgehoben werden können; einen deutlich umfangreicheren Überblick, der aber trotz der 188 Einträge noch immer eine Auswahl darstellt, gibt Michel-Thiriets Marcel Proust Lexikon. Für das volle Spektrum muss auf Tadiés Biographie verwiesen werden.
Ein entscheidender Schritt in Prousts Leben war sicherlich der in den exklusiven Salon der Madame Madeleine Lemaire (1845–1928) in der Rue de Monceau, denn dort schloss er 1893 engere Bekanntschaft mit Robert de Montesquiou und 1894 mit Reynaldo Hahn, den beiden zentralen Personen in seinem geistigen Leben (Montesquiou hatte bereits bei Prousts Eltern gesellschaftlich verkehrt). Madame Lemaire hatte Proust vermutlich im Salon der Madame Straus kennengelernt, der Mutter seines Schulfreundes Jacques Bizet. Madame Lemaire war Malerin und deshalb mit der Kunstszene wohlvertraut, und zudem eine Freundin der Princesse Mathilde, die ihr den Zugang zu höchsten Adelskreisen eröffnete.
Comte Robert de Montesquiou-Fezensac (1855–1921) war ein unvergleichlicher Repräsentant dieser Salon-Szene; er entstammte einem alten, vermögenden Adelsgeschlecht und kehrte dieses auch gern heraus; ein Dandy und Snob, aber gut aussehend und intelligent, stellte er eine Art Leitfigur für die Jugend des Adels und des gehobenen Bürgertums dar. Proust bewunderte vor allem sein sicheres künstlerisches Urteil und apostrophierte ihn in einer Rezension als einen »Lehrer des Schönen«; seine symbolistischen Gedichte kursierten in den mondänen Kreisen, fanden darüber hinaus aber kaum Verbreitung und wurden nach seinem Tod weitgehend vergessen. Seine Autobiographie Les Pas effacés (1923) bildet jedoch eine wichtige Informationsquelle über seine Zeit. Als 1919 der zweite Band der Recherche erschien, erkannte Montesquiou sich in dem Baron de Charlus wieder und war nicht amüsiert (siehe Corr. XVIII, S. 468 ff.) – die Beziehung litt entsprechend, trotz Prousts Beteuerung, dass er vielmehr den Baron Doäzan im Auge gehabt habe (siehe Corr. XX, S. 194 f.). Dennoch kann man wohl mit François Mauriac und Jacques-Émile Blanche sagen, dass die Recherche ohne den Einfluss und das Vorbild Montesquious nicht geworden wäre, was sie ist.
Durch Robert de Montesquiou lernte Proust zahlreiche Mitglieder des französischen Adels kennen, die dann auch die eine oder andere Spur in der Recherche hinterlassen haben: nach dem Erscheinen des jeweils nächsten Bandes war es ein beliebtes Pariser Ratespiel, zu ermitteln, wer wohl wer sei. Die wichtigsten von Robert vermittelten Bekanntschaften waren die mit Boni de Castellane, Élisabeth de Clermont-Tonnerre und mit Maurice Barrès.
Der Marquis Boniface (»Boni«) de Castellane (1867–1932) war eine kaum weniger schillernde Figur als Montesquiou, warf allerdings noch ungehemmter mit Geld um sich als dieser. Dank seiner Ehe mit der Amerikanerin Anna Gould, der Erbin eines Eisenbahnmagnaten, schienen die Mittel unerschöpflich: am 2. Juli 1896 etwa gaben die Castellanes im Bois de Boulogne ein Fest für 3000 Gäste.5 Nach dem Bau eines Palastes aus rosa Marmor an der Avenue du Bois sahen die Dinge allerdings anders aus. Anna ließ sich 1906 von ihm scheiden, und Boni musste sich dazu bequemen, seine teuer erworbene Expertise mit erlesenen Sammlerstücken als Antiquitätenhändler für den Broterwerb zu nutzen.
Die Kochbuch-Autorin Duchesse Élisabeth de Clermont-Tonnerre (1875–1954) lernte Proust 1903 kennen; sie wurde bald zu einer seiner engsten Vertrauten. Élisabeth stand dem Dichterinnenkreis um Nathalie Barney nahe, der seinerseits Sappho nahegestanden haben soll und zu dem insbes. Lucie Delarue-Mardrus gehörte, die Frau des 1001 Nacht-Übersetzers Joseph-Charles Mardrus.
Den Politiker und Schriftsteller Maurice Barrès (1862–1923) schließlich lernte Proust 1891 vermutlich durch Montesquiou kennen; mit seinen nationalistischen Überzeugungen, die er in Wort und Schrift zum Ausdruck brachte, konnte Proust wohl nicht viel anfangen; dafür bewunderte er aber seinen leicht fließenden, durchrhythmisierten Stil. Barrès ist sicherlich neben Alphonse Daudet und Anatole France ein Leihgeber für den »style Bergotte«.
Reynaldo Hahn (1874–1947),6 ein empfindsamer, feinfühliger Sänger, Pianist und Komponist, der Proust bis an dessen Lebensende in einer zärtlichen Freundschaft verbunden blieb, war in gewisser Weise die Gegenfigur zu dem exaltierten, exzentrischen und extrovertierten Montesquiou. Hahn wurde in Caracas als Sohn einer baskischen Venezolanerin und eines jüdischen Kaufmanns aus Hamburg geboren, verließ aber bereits 1878 zusammen mit seiner Familie Venezuela in Richtung Paris. Dennoch sprach er fließend Spanisch »mit einem ausgesprochen heimatlichen Akzent« (so der kubanische Schriftsteller Alejo Carpentier, der Hahn in den Dreißigern besuchte, am 16. August 1951 in der venezolanischen Tageszeitung El Nacional). Im Salon Lemaire spielte Hahn Lieder von Schubert, Schumann, Gounod sowie eigene Vertonungen von Gedichten Verlaines am Klavier; sein umfangreiches Œuvre wird noch heute zumindest in Frankreich hoch geschätzt. Hahn machte Proust mit der Musik von Saint-Saëns bekannt, dessen Sonate in d-Moll für Geige und Klavier mit Hahn am Piano im Salon Lemaire in Prousts Gegenwart aufgeführt wurde; die »kleine Phrase« daraus wurde zu einem Leitmotiv ihrer Freundschaft. In Ruskins Todesjahr und vermutlich anlässlich dieses Todes am 20. Januar 1900 unternahmen Proust und seine Mutter im Mai eine Reise nach Venedig, wo sie sich mit Reynaldo Hahn und dessen Cousine Marie Nordlinger trafen, mit der Proust seine Begeisterung für Ruskin teilte und die ihm später bei seinen Ruskin-Übersetzungen assistierte. Hahn komponierte 1902 ein Stück Les Muses pleurant la mort de Ruskin (BnF VM7-17879) und widmete es Proust. Diese Venedigreise hat sicherlich in der Venedigreise Marcels in der Entflohenen ihre kunsthistorischen Spuren hinterlassen (im Herbst desselben Jahres unternahm Proust eine weitere Reise nach Venedig, diesmal allein). 1895 lernte Proust durch Reynaldo Hahn Sarah Bernhardt kennen, mit der dieser befreundet war und deren Biographie er 1930 verfasste (La Grande Sarah). Ebenfalls durch Reynaldo Hahn wurde Proust 1910 mit Jean Cocteau bekannt gemacht, der zusammen mit Federico (»Coco«) de Madrazo y Ochoa das Libretto zu Hahns Ballett Le Diable bleu verfasste, aber auch an den Szenarien für die Ballets Russes beteiligt war, was es Proust ermöglichte, auch Diaghilev und Nijinsky zu treffen. Durch Hahns Schwester Marie de Madrazo ließ Proust Erkundigungen zu Stoffmotiven bei ihrem Neffen einholen, dem Damenschneider und Stoffdesigner Mariano Fortuny (1871–1949). Zur Verwandtschaft Hahns mit der weitverzweigten, auch im Prado gut vertretenen spanischen Maler-Dynastie de Madrazo, die Proust zum Teil kennenlernte – insbes. auch Coco (= Frédéric = Federico) de Madrazo y Ochoa, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verband – s. den Stammbaum in Kap. VIII.7
Die folgenreichste Bekanntschaft, die Proust durch Hahn 1894 vermittelt wurde, war aber zweifellos die mit Alphonse Daudet, dessen Werke Proust schon von Jugend an bewundert hatte; Bergotte dürfte einige seiner literarischen Charakteristika von Daudet geerbt haben. 1919 war Daudets Sohn Léon maßgeblich daran beteiligt, dass Proust den Prix Goncourt (s. unten) erhielt. Mit beiden Söhnen, Léon und Lucien, verband Proust eine lebenslange Freundschaft, trotz des aktiven Antisemitismus des Journalisten Léon. Die Freundschaft mit ihm führte 1900 zu der Bekanntschaft mit Gaston Calmette, dem Herausgeber des Figaro, der Proust nachdrücklich förderte und dem der erste Band der Recherche gewidmet ist. Die Freundschaft mit dem sieben Jahre jüngeren Maler und Schriftsteller Lucien nahm recht bald deutlich amouröse Züge an, was den Kritiker Jean Lorrain vom Journal dazu veranlasste, von einer »besonderen Freundschaft« zu sprechen; Proust forderte ihn daraufhin zum Duell mit Pistolen: »Niemand wurde verletzt, und die Sekundanten erklärten den Streit für beigelegt« (Le Figaro, 2. 2. 1897). Nach dem Erscheinen von Swann schrieb Lucien eine hingerissene Rezension für den Figaro.
Im Salon von Madame Straus hatte Proust neben Madame Lemaire 1891 auch Jacques-Émile Blanche (1861–1942) kennengelernt, einen erfolgreichen Gesellschaftsmaler, der 1892 das allgemein bekannte Porträt von Proust anfertigte. Die Familie Blanche lebte in Auteuil, was Proust Gelegenheit zu häufigen Besuchen gab; Émiles Vater, der berühmte Neurologe Antoine, betrieb in Auteuil eine Nervenheilanstalt, in der er neben anderen Künstlern und Schriftstellern auch Maupassant in dessen letzten Lebenstagen behandelte. Die Freundschaft zwischen Proust und Jacques-Émile Blanche hatte eher sporadischen Charakter; so ruhte von 1893 bis 1914, immerhin 21 Jahre lang, jeglicher Kontakt zwischen den beiden. 1918 verfasste Proust ein Vorwort zu Émiles De David à Degas, das zu heftigen Meinungsverschiedenheiten führte, auf die Émile dann in der Widmung des Folgebandes Dates einging. In seinem Buch Mes Modèles (1928) erinnert sich Émile ausführlich an Proust und seine Beziehung zu ihm.
Dem gleichen Salon verdankte Proust die Bekanntschaft mit der Urenkelin Laure-Marie (1859–1936) des Marquis de Sade, die 1879 den Comte Adhéaume de Chevigné heiratete und der der junge Proust im Frühjahr 1892 bei ihren Spaziergängen aufzulauern pflegte. Als sie sich bei der Lektüre von Guermantes in dieser Szene und in dem Vogelprofil (»das zähe Huhn, das ich einst für einen Paradiesvogel hielt«, Corr. XX, S. 349) der Herzogin von Guermantes wiedererkannte, brach sie die Beziehung zu Proust ab: »Als ich zwanzig war, wollte sie mich nicht lieben; muss sie sich jetzt, wo ich vierzig bin und aus ihr das Beste der Herzogin von Guermantes gemacht habe, weigern, mich zu lesen?«8
Einen weiteren Ausgangspunkt für interessante Bekanntschaften bildete die aus Rumänien stammende Chopin-Interpretin Princesse Rachel Bassaraba de Brancovan (1847–1923), die Proust während seines Urlaubs in Évian 1893 kennenlernte. Ihre eine Tochter, Hélène (1878–1929), der Proust eine tiefe Zuneigung entgegenbrachte und der er 1906 das Vorwort zu Sésame et les Lys widmete, heiratete 1898 den Prince Alexandre de Caraman-Chimay, die andere, Anna (1876–1933), den Comte de Noailles. Anna wiederum machte Proust mit ihren Cousins bekannt, den Princes Antoine und Emmanuel Bibesco, zu denen sich eine enge Freundschaft entwickelte, die gelegentlich auch als »intim« beschrieben wird. Vierter im Bunde war Prousts stets angehimmelter Schulfreund Bertrand de Fénelon, den die Bibesco-Brüder aber schon vorher kannten. Die Mutter der beiden Brüder, die ebenfalls aus Rumänien stammende Hélène Bibesco (1855–1902), unterhielt einen Salon, in dem die künstlerische Elite verkehrte, nicht zuletzt der von Proust geschätzte Autor Pierre Loti (1850–1923). Die Sprachschnitzer des Hoteldirektors in Balbec, der aus Rumänien stammt, mag Proust zum Teil auch Rachel de Brancovan oder Hélène Bibesco abgelauscht haben.
Enger noch als Prousts Verhältnis zu Hélène, deren Charme ihn bezauberte, war das zu Anna de Noailles, deren Dichtungen er bewunderte und deren Gedichtband Les Éblouissements er 1907 in der Literaturbeilage des Figaro in den höchsten Tönen lobend besprach. Umgekehrt bezeugt ein umfangreicher Briefwechsel das lebhafte Interesse, das Anna an Prousts Arbeit schon während der Entstehung von Contre Saint-Beuve und später an der Recherche nahm. Über Anna de Noailles lernte Proust 1902 den halbjüdischen Duc Armand de Guiche (1879–1962) kennen, mit dem er sich häufig in Restaurants traf und der später als Physiker reüssierte, sowie den Duc Louis d’Albufera (1877–1953), genannt »Albu«, der sich vor allem für Autos, Reisen und Frauen interessierte, aber dennoch an Proust hing, bis er nach dem Erscheinen von Sodome et Gomorrhe 1922 sich und seine Geliebte Louisa de Mornand in Saint-Loup und Rachel wiederzuerkennen meinte. Prousts Versöhnungsversuchen war kein Erfolg beschieden.
1889, während seines Militärdienstes, wurde Proust in den berühmten Salon der Bankierstochter Léontine Arman de Caillavet (1844–1910) eingeführt – von wem, ist nicht bekannt –, in dem »Tout Paris« verkehrte (Maler, Politiker, Schauspieler, Schriftsteller, jedoch keine Musiker), freundete sich mit dem Sohn Gaston (1869–1915) an, der Redakteur des Figaro war und im Ersten Weltkrieg fiel, und lernte endlich einen seit früher Jugend glühend verehrten Autor kennen, Anatole France (1844–1924), den Geliebten von Madame Arman, dem Proust im ersten Teil des zweiten Bandes in der Person Bergottes ein liebevoll-ironisches Denkmal errichtete. Anatole France schrieb 1896 zwar das Vorwort zu Prousts Les Plaisirs et le Jours, schien aber kein tiefergehendes Interesse an dieser Bekanntschaft zu haben.
André Gide (1869–1951) lernte Proust 1891 durch seinen Studienkollegen Gabriel Trarieux kennen. Gide arbeitete ab 1893 bei der avantgardistischen Literaturzeitschrift La Revue blanche und leitete ab 1911 mit anderen die Nouvelle Revue Française, eine Funktion, in der er noch eine besondere Rolle für die Recherche spielen sollte; dazu s. weiter unten den Abschnitt zur Erstausgabe (S. 71). Die Beziehung zwischen dem heimlichen Homosexuellen Proust und dem bekennenden Homosexuellen Gide beschränkte sich bis 1921 auf das Geschäftliche, bis die Publikation von Sodome et Gomorrhe I das gemeinsame Interessengebiet offenbarte. Von da an besuchte Gide Proust öfter, um seine Darstellung des Themas mit ihm zu diskutieren. Gide seinerseits hatte eine Verteidigungsschrift der Homosexualität verfasst, betitelt Corydon, die er 1920 privat drucken ließ (publiziert 1924).
Eine wichtige Bekanntschaft schließlich, die einmal nicht über Dritte vermittelt wurde, ist die mit den Kunstmäzenen Violet (1874–1962) und Sydney Schiff (1868–1944). Violet, geb. Beddington, war eine englische Übersetzerin französischer Literatur, die der englische Romanautor Sydney Schiff 1911 in zweiter Ehe heiratete. 1919 schrieb Sydney an Proust, um ihm seine Bewunderung für Swann auszudrücken, widmete ihm seinen Roman Richard Kurt und bat ihn, in seiner Literaturzeitschrift Art and Letters einen Auszug aus dem zweiten Band vorabdrucken zu dürfen, was Proust aber so kurz vor dessen Erscheinen ablehnte. Die Korrespondenz zwischen quasi Unbekannten, die sich – soweit erhalten – wie ein Briefwechsel zwischen uralten Freunden liest, riss bis zu Prousts Tod nicht ab. In der Spargelzeit 1919 begegneten sie sich schließlich persönlich in Paris und diskutierten eine Nacht hindurch in Prousts Wohnung. Erstaunlicherweise klärte sich dennoch nicht der Irrtum Prousts auf, dass »Stephen Hudson«, der Name, unter dem Richard Kurt erschienen war, das Pseudonym von Violet und nicht von Sydney Schiff sei, was Prousts Briefen an die Schiffs gelegentlich eine unfreiwillige Komik verleiht. Im Mai 1920 und im Mai 1922 kamen sie noch einmal in Paris zusammen, wenn auch nur kurz. Das Treffen 1920 erfolgte anlässlich eines Diners, das die Schiffs zu Ehren Strawinskys nach der Uraufführung von dessen Oper Le Renard gaben; bei dieser Gelegenheit war auch das legendäre Schweigen zwischen Proust (im Pelz) und Joyce (im Vollrausch) zu hören, als die beiden Großmeister der Sprache einander nichts zu sagen wussten.9
Curriculum vitae
In der folgenden Übersicht über die wichtigsten Lebens- und Publikationsdaten sind am Ende jedes Jahres-Absatzes die Veröffentlichungen aus dem jeweiligen Jahr aufgelistet.
1871 10. Juli: Geburt von Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust.
1873 24. Mai: Geburt von Marcel Prousts einzigem Geschwister Robert.
1878 Osterferien in Illiers.
1881 Proust hat seinen ersten Asthmaanfall. Im Herbst der erste Theaterbesuch.
1882 Oktober: Eintritt in die Quinta des Lycée Condorcet.
1886 Proust beantwortet das erste Mal einen der berühmten Fragebögen (s. unten, S. 52–56) und liest Augustin Thierrys Aux temps mérovingiens. Im September Aufenthalt in Illiers. Oktober: Er muss die Sekunda wiederholen, weil er im Vorjahr zu lange gefehlt hat.
1887 Proust spielt mit Marie de Bérnadaky in den Champs-Élysées. Im Oktober Versetzung in die Unterprima, wo er einen Aufsatz über Racine verfasst: »Racine leidenschaftlich zu lieben wäre ganz einfach die tiefste, zärtlichste, schmerzlichste, die aufrichtigste Empfindung …« Zusammen mit Daniel Halévy gründet er die monatliche, hektographierte Schülerzeitschrift Le Lundi. Revue artistique et litteraire, von der dreizehn Nummern erscheinen.
1888 Im Oktober Versetzung in die Philosophieklasse (Oberprima). Proust liest Barrès, Renan, Leconte de Lisle, Loti und belegt den Philosophie-Kurs von Alphonse Darlu, mit dem er auch später noch in Verbindung blieb, und schreibt im Unterricht Liebesbriefe an seine Klassenkameraden Jacques Bizet und Daniel Halévy.
1889 Ernest Renan widmet ihm sein Buch La vie de Jésus. Seine Großmutter väterlicherseits stirbt. Im Juli Gymnasial-Abschluss (»bachelier ès lettres«). Ab November Wehrdienst in Orléans – den Proust »freiwillig« leistete, um den unfreiwilligen zu vermeiden.
1890 Im Januar stirbt seine Großmutter mütterlicherseits an Urämie. Im November Beendigung des Wehrdienstes. Proust schreibt sich in die Faculté de droit de Paris und in die École libre des sciences politiques ein. Er lernt Maupassant kennen.
1891 Urlaube in Cabourg und in Trouville. Er lernt Oscar Wilde, André Gide und Maurice Barrès kennen und schreibt Betrachtungen und Novellen für Le Mensuel.
1892 Proust und seine Schulfreunde Fernand Gregh, Robert Dreyfus, Daniel Halévy und Horace Finaly gründen die literarische Zeitschrift Le Banquet, in der er im wesentlichen die Texte aus der späteren Sammlung Les Plaisirs et les Jours (1896) publiziert. Er beantwortet den zweiten Fragebogen (s. unten, S. 52–56); im Juli fertigt Jacques-Émile Blanche sein berühmtes Porträt an.
1893 Veröffentlichungen in Le Banquet, das allerdings im gleichen Jahr eingestellt wird. Proust lernt Robert de Montesquiou kennen und beginnt seine Mitarbeit bei der Revue blanche. L’Indifférent, ein entfernter Vorläufer zu Un amour de Swann, entsteht in dieser Zeit, wird aber erst 1896 veröffentlicht. Urlaube in Sankt Moritz, Évian und Trouville. Er schließt sein Jura-Studium erfolgreich ab (»licence en droit«).
– Violante ou la mondanité, in Le Banquet.
– La Conférence parlementaire de la rue Serpente, in Le Banquet.
– Mondanité de Bouvard et Pécuchet, in La Revue blanche.
– Mélancholique villégiature de Mme de Breyves, in La Revue blanche.
– Avant la nuit, in La Revue blanche.
– Souvenir, in La Revue blanche.
1894 Beginn der Dreyfus-Affäre. Proust lernt Reynaldo Hahn und Lucien Daudet kennen.
– Mensonges, Gedicht mit Musik von Léon Delafosse, bei Heugel.
– Une fête littéraire à Versailles, in Le Gaulois.
– Bouvard et Pécuchet II: Mélomanie (publ. 1919 in Les Plaisirs et les Jours).
1895 Proust schließt sein Philosophie-Studium erfolgreich ab (»licence ès lettres«) und nimmt eine Stellung bei der Bibliothèque Mazarine an. Urlaub im Sommer in Bad Kreuznach mit seiner Mutter, im August in Dieppe mit Reynaldo Hahn, wo er Saint-Saëns kennenlernt. Im September Aufenthalte, ebenfalls mit Reynaldo Hahn, auf der Belle-Île-en-mer und in Beg-Meil. Er beginnt die Arbeit an Jean Santeuil.
– Portraits de peintres, in Le Gaulois.
– La Mort de Baldassare Silvande, in La Revue hebdomadaire.
– Figures parisiennes: Camille Saint-Saëns, in Le Gaulois.
1896 Prousts Onkel Louis Weil stirbt an Lungenentzündung, wie später Proust selbst, der die Symptome wiedererkennt. Beginn der Freundschaft mit Lucien Daudet. Mit Contre l’obscurité erteilt Proust dem Symbolismus und Mallarmé eine Absage. Urlaube in Mont-Dore (Auvergne) und in Fontainebleau. Proust liest Dumas, Balzac, Sainte-Beuve, Rousseau, Shakespeare, Goethe, Eliot und lernt Marie Nordlinger kennen.
– Les Plaisirs et les Jours, bei Calmann-Lévy.
– Contre l’obscurité, in La Revue blanche.
1897 Duell mit Jacques Lorrain. Ein zweiter Urlaub in Bad Kreuznach mit der Mutter gilt heute als zweifelhaft.
– Silhouette d’artiste, in La Revue d’art dramatique.
– Sur M. Alphonse Daudet, in La Presse.
– Adieux, in La Presse.
1898 Die Dreyfus-Affäre gelangt mit Zolas J’accuse auf ihren Höhepunkt; am Tag nach dem Erscheinen unterzeichnet Proust eine Petition für die Revision des Verfahrens; stattdessen findet ein Verfahren gegen Zola statt. Seine Mutter durchleidet eine Krebsoperation; er begleitet sie anschließend nach Trouville. Im Oktober Reise nach Amsterdam zur Rembrandt-Ausstellung. Im November besichtigt er das Haus Moreaus, das zu einem Museum umgewandelt wurde.
– Robert de Flers, in La Revue d’art dramatique.
1899 Proust gibt den Jean Santeuil auf und widmet sich ganz seinen Ruskin-Studien und der Übersetzung von dessen The Bible of Amiens. Urlaub in Évian. Er lernt Hauptmann Picquart kennen und freundet sich mit Antoine Bibesco an. Urlaub mit seinen Eltern in Évian.
– Lettres de Perse et d’ailleurs, in La Presse.
1900 Ruskin stirbt; Proust veröffentlicht mehrere Artikel über ihn. Er gibt seine Stelle in der Bibliothèque Mazarine auf und fährt mit seiner Mutter nach Padua und Venedig, wo er Marie Nordlinger und Reynaldo Hahn trifft. Im Herbst fährt er noch einmal, jetzt allein, nach Venedig, während seine Familie vom Boulevard Malesherbes Nr. 9 in die Rue de Courcelles Nr. 45 umzieht; diese zweite Venedigreise wird heute allerdings angezweifelt.
– John Ruskin, in La Chronique des arts et de la curiosité (27. Januar).
– Pèlerinages ruskiniens en France, in Le Figaro (13. Februar).
– Ruskin et Notre-Dame d’Amiens, in Mercure de France (April).
– John Ruskin (I), (II), in La Gazette des beaux-arts (1. April, 1. August).
1901 Mit Léon Yeatman nach Amiens und nach Abbeville. Im Dezember bietet Proust dem Verlag Ollendorff seine Übersetzung von Ruskins Bible of Amiens an.
1902 Wiederaufnahme der Arbeit an Jean Santeuil. Proust hört Tristan und Isolde. Charles Haas stirbt. Kurze Reisen nach Amboise, Chartres und Brügge, wo er die Ausstellung flämischer Malerei der Renaissance besichtigt; später eine Reise mit Bertrand de Fénelon nach Brügge und dann allein weiter nach Holland, wo er in Haarlem die Gemälde von Frans Hals besichtigt und in Den Haag zum ersten Mal Vermeers Ansicht von Delft sieht. Im Dezember verabschiedet sich Fénelon zu Prousts großem Schmerz nach Konstantinopel.
1903 Robert Proust heiratet Marthe Dubois-Amiot, die sich nach Marcels und Roberts Tod um eine Vernichtung des Angedenkens an ihren verhassten Schwager bemühen wird. Proust lernt den Herzog von Guiche, den Prinzen Léon Radziwill und den Marquis von Albufera kennen. Urlaube in Trouville, in Burgund und mit den Eltern in Évian; Ausflüge mit dem Auto nach Laon, Senlis und Coucy-le-Château. Tod des Vaters.
– Auszüge aus La Bible d’Amiens, in La Renaissance latine.
– Un salon historique. Le Salon de S.A.I. la princesse Mathilde, in Le Figaro.
– Le Salon de Mme Lemaire, in Le Figaro.
– Le Salon de la princesse de Polignac, in Le Figaro.
1904 Beginn der Übersetzung von Ruskins Sesame and Lilies gemeinsam mit Marie Nordlinger, worin er auch Maeterlincks Le double jardin zitiert. Beim Mercure de France erscheint La Bible d’Amiens. Nach einer Reise durch die Bretagne und die Normandie und einer Kreuzfahrt entlang der bretonischen Küste und nach Guernsey erscheint im Figaro Prousts Betrachtung La Mort des cathédrales.
– Le Salon de la comtesse d’Haussonville, in Le Figaro.
– Fête chez Montesquiou à Neuilly, in Le Figaro.
– Le Salon de la comtesse Potocka, in Le Figaro.
1905 Proust verfasst das äußerst einfühlsame Vorwort zu Sésame et les Lys und eine weitere Studie über Robert de Montesquiou, Un professeur de beauté. Er beginnt, Saint-Simon und Homer zu lesen. Anfang September begleitet er seine Mutter nach Évian, die jedoch in einem Nottransport nach Paris zurückgebracht werden muss, wo sie Ende September stirbt. Sein Beitrittsgesuch zum Cercle de l’Union wird abgelehnt. Er begibt sich von Anfang Dezember bis Ende Januar in das Sanatorium des Charcot-Schülers Paul Sollier (1861–1938): »Meine Kur hat mich nur noch kränker gemacht.«
– La vie à Paris: la comtesse de Guerne, in Le Figaro.
– Sur la lecture, in La Renaissance latine.
– Un professeur de beauté, in Les Arts et la vie.
1906 Sésame et les Lys erscheint im Verlag des Mercure de France. Proust hält sich von Anfang August bis Ende Dezember im Hôtel des Réservoirs in Versailles auf. Danach wohnt er bis September 1908 in der Wohnung seines verstorbenen Großonkels Georges Weil am Boulevard Haussmann Nr. 102. Er liest André Gide, Francis Jammes und Dickens.
1907 Verschiedene Studien über die Dichterin Anna de Noailles, über den Salon der Prinzessin von Polignac und über die Mémoires der Madame de Boigne, von denen Teile auch in die Recherche eingeflossen sind. Er liest über Carpaccio. Im Sommer unternimmt Proust von Trouville aus verschiedene Ausflüge mit dem Automobil in die Bretagne und die Normandie, die sich im November im Figaro in dem Artikel Impressions de route en automobile niederschlagen, der bereits »Balbec« als Ausgangspunkt nimmt und mit einer Vorform des »Martinville-Aufsatzes« in Combray beginnt, die dann in Le Côté de Guermantes als »spätere Überarbeitung« ausgegeben wird. Bei diesen Fahrten hatte Alfred Agostinelli als Chauffeur fungiert, der ihm von dem Autovermieter zur Verfügung gestellt worden war.
– Sentiments filiaux d’un parricide, in Le Figaro.
– Une grand-mère, in Le Figaro.
1908 Proust beginnt mit dem Essay Contre la méthode de Sainte-Beuve, der sich jedoch zunehmend zur Novelle entwickelt. Im Frühjahr wird er in den Polo-Club aufgenommen. Im Sommer lernt er in Cabourg Marcel Plantevigne kennen und sieht mit ihm im Hotel eine Kinovorführung, die er jedoch als »Kasperltheater«10 abtut. In den Monaten September bis November wohnt Proust erneut im Hôtel des Réservoirs in Versailles, danach zieht er endgültig in die Wohnung am Boulevard Haussmann 102 ein, obwohl es ihm dort eigentlich zu laut ist (teppichklopfende Nachbarn; siehe Lettres à sa voisine, 2013). Er liest die Memoiren von Chateaubriand.
– Serie von Pastiches von Balzac, Goncourt, Michelet, Faguet, Flaubert, Sainte-Beuve, Renan für den Figaro.
1909 Er gibt das Zwitterprojekt des essayistisch-novellistischen Sainte-Beuve auf und beginnt mit einem eigentlichen Roman, den ersten Entwürfen zu Combray und zu Le Temps retrouvé. Im Herbst hat er bereits 200 Seiten beisammen und veranschlagt seinen zukünftigen Roman Le Temps perdu auf drei Bände.
– L’affaire Lemoine, par Henri de Régnier, in Le Figaro.
1910 Urlaub in Cabourg, wo Proust an Un amour de Swann arbeitet und die Grundlagen für Le Côté de Guermantes entwirft. Er lernt Jean Cocteau kennen. Lektüre von Henri Bergsons Matière et mémoire und Thomas Hardys A Pair of Blue Eyes (1873; frz. Deux Yeux bleus, 1913).
1911 Proust macht in Begleitung seines Sekretärs Albert Nahmias Urlaub in Cabourg, wo er eine Maschinenabschrift seines Textes herstellen lässt, die den Titel Les Intermittances du cœur, Le temps perdu, 1ère parti trägt. In Paris hört er Wagner und Pelléas et Mélisande am »Theatrophon« (Drahtfunk). Zur Jahreswende erleidet er empfindliche Spekulationsverluste an der Börse.
1912 Er legt seinen Roman erst dem Verlag Fasquelle und dann der Nouvelle Revue Française vor, die beide ablehnen. Im Figaro erscheinen Auszüge aus Combray. Cocteau liest ihm aus seinem La Danse de Sophocle vor. Erneut schwere Spekulationsverluste.
– Zwei Auszüge aus Combray, in Le Figaro.
– L’Église de village, in Le Figaro.
1913 Der Verlag Ollendorff lehnt den Roman ab; am 11. März schließt Proust mit Grasset einen Vertrag zu Selbstkosten. Sein früherer Chauffeur und jetzt angebeteter (»je l’adorais«; Corr. XIV, S. 358) Sekretär Alfred Agostinelli zieht am 30. Mai mit seiner Verlobten Anna Square in Prousts Wohnung ein. Vorveröffentlichungen im Figaro aus Un amour de Swann und aus Le Côté de Guermantes. Proust korrigiert nacheinander fünf Fahnensätze für den ersten Band, in dem zwei weitere Bände angekündigt werden. Am 12. November publiziert Le Temps (datiert 13. November) ein Interview von Élie-Joseph Bois mit Proust, in dem das »morgige« Erscheinen von Du côté de chez Swann im Buchhandel angekündigt wird. Proust überwirft sich mit Agostinelli, der am 1. Dezember zu seiner Familie in Nizza zurückgeht und in Antibes seine Pilotenausbildung fortsetzt. Proust versucht, ihn zur Rückkehr nach Paris überreden zu lassen und ihn mit finanziellen Angeboten zurückzulocken. Erneut schwere Spekulationsverluste.
– Auszüge aus Du côté de chez Swann in Gil Blas, Le Temps und Les Annales.
1914 Proust bereitet den zweiten Band für Grasset vor, der Mitte des Jahres die Fahnen fertig hat. Am 30. Mai verunglückt Agostinelli tödlich mit einem Schulflugzeug. Proust führt die Figur Albertines in sein Manuskript ein und arbeitet an den Teilen von Sodome et Gomorrhe, die später La Prisonnière und Albertine disparue werden; dabei erweitert er auch Vinteuils Sonate zu einem Quartett und später einem Septett. Céleste Albaret zieht als Haushälterin in Prousts Wohnung ein. Im September fährt Proust mit seinem neuen Kammerdiener Ernst Forssgren nach Cabourg. Am 3. August erklärt Deutschland Frankreich den Krieg; am 17. Dezember fällt Bertrand de Fénelon an der Front, Proust erfährt davon jedoch erst am 15. März 1915.
– Vorabdrucke aus dem geplanten zweiten Band in La Nouvelle Revue Française.
1915 Der kriegsbedingte Stillstand bei Grasset gibt Proust Gelegenheit, das Kapitel über Sodom und Gomorrha wie auch die Albertine-Episode zu eigenständigen Bänden auszuarbeiten.
1916 Proust wechselt zu Gallimard. Er vertieft seine Bekanntschaft mit Jean Cocteau und mit Paul Morand und beginnt, wieder auszugehen, unter anderem auch in Le Cuziats Männerbordell. Die dort gesammelten Erfahrungen wie auch die Eindrücke von Paris während des Krieges werden in Le Temps retrouvé eingearbeitet.
1917 Sodome et Gomorrhe und Le Temps retrouvé werden weiter ausgearbeitet. Die Fahnen für À l’ombre des jeunes filles en fleurs und für eine Neuauflage von Du côté de chez Swann werden korrigiert. Diners bei Larue und im Ritz mit der Prinzessin Soutzo. Am 27. Dezember bewundert er von einem Balkon des Ritz aus den Luftkampf über Paris.
1918 Proust engagiert den Schweizer Henri Rochat, einen ehemaligen Angestellten des Ritz, als Sekretär. Er lernt François Mauriac bei einem Empfang bei Francis Jammes kennen. Am 30. November (Druckvermerk) liegt À l’ombre des jeunes filles en fleurs vor. Proust konsultiert den anerkannten Neurologen Joseph Babinski (1857–1932) wegen einer Gesichtslähmung und wegen Sprachstörungen.
1919 Das Haus des verstorbenen Großonkels Georges Weil am Boulevard Haussmann 102, in dem er seit 1906 gewohnt hatte, wird von der Erbengemeinschaft verkauft, und Proust muss ausziehen; er findet Unterschlupf im Haus der Schauspielerin Réjane in der Rue Laurent-Pichat Nr. 8bis. Da ihm die Wohnung zu laut ist (Toilettenspülung des Nachbarn) und sich auch ungünstig auf sein Asthma auswirkt (zu nahe am Bois de Boulogne), zieht Proust nach drei Monaten weiter in die Rue Hamelin Nr. 44. Pastiches et mélanges erscheint sowie die Neuauflage von Du côté de chez Swann. Am 10. November wird Proust der Prix Goncourt verliehen.
– Mme de Villeparisis à Venise, in Le Matin vom 11. Dezember.
– À Venise, in Feuillets d’Art vom 15. Dezember.
1920 Le Côté de Guermantes I erscheint im Oktober bei Gallimard; im gleichen Jahr erscheint auch der aufschlussreiche Essay À propos du style de Flaubert. Proust wird zum Ritter der Ehrenlegion ernannt.
– Pour un ami: remarques sur le style, in La Revue de Paris.
1921 Le Côté de Guermantes II suivi de Sodome et Gomorrhe I erscheint im Mai bei Gallimard; ein Vorabdruck Jalousie aus Sodome et Gomorrhe II erscheint im November in der seit Juli bestehenden Reihe Les Œuvres libres bei Fayard. Der nutzlose Sekretär Henri Rochat wird nach Argentinien komplimentiert. Besuch der Ausstellung holländischer Maler im Jeu de Paume, wo auch Vermeers Ansicht von Delft gezeigt wird. Im Herbst kränkelt Proust besorgniserregend aufgrund eines Irrtums seines Apothekers.
– À propos de Baudelaire, in der Nouvelle Revue Française.
1922 Yvonne Albaret, eine Nichte der Haushälterin Céleste Albaret, übernimmt die Maschinenabschrift der Manuskripte für La Prisonnière und La Fugitive. Anfang des Frühjahrs verkündet Proust Céleste, dass er soeben das Wort »Fin« geschrieben habe. Sodome et Gomorrhe II erscheint (Druckvermerk 10. November). Beginn des Briefwechsels mit Ernst Robert Curtius. Am 18. Mai findet nach der Uraufführung von Strawinskys Renard die verunglückte Begegnung zwischen Proust und James Joyce sowie Igor Strawinsky bei einem Diner des Ehepaars Schiff statt. Im September erscheint der erste Band, Swann’s Way, von Scott-Moncrieffs Übersetzung Remembrance of Things Past der Recherche, doch Proust ist mit den Titeln unzufrieden. Im Oktober erkrankt er an einer Bronchitis, die sich zu einer Lungenentzündung auswächst, an der Proust am 18. November stirbt. Er wird auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise in der Section 85 beigesetzt.
– Vorabdrucke aus La Prisonnière in der Nouvelle Revue Française.
1923 La Prisonnière (Druckvermerk 14. November).
– Vorabdruck Précaution inutile im Februar aus La Prisonnière in der Reihe Les Œuvres libres.
1926 Albertine disparue (Druckvermerk 30. November 1925).
1927 Le Temps retrouvé (Druckvermerk 22. September).
1927 Chroniques. Eine Sammlung kleinerer Schriften, hrsg. von Robert Proust.
1929–36 Erste Gesamtausgabe in der Reihe »À la gerbe«, in 18 Bänden, bei Gallimard.
1952 Jean Santeuil (s. unten).
1954 Erste kommentierte Ausgabe von À la Recherche du temps perdu, hrsg. von Pierre Clarac und André Ferré, bei Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade).
1954 Contre Sainte-Beuve (s. unten).
1971–89 Kommentierte Gesamtausgabe in sechs Bänden, hrsg. von Pierre Clarac und Yves Sandre (Jean Santeuil précédé de Les Plaisirs et les Jours sowie Contre Sainte-Beuve précédé de Pastiches et mélanges suivi de Essais et articles) bzw. von Jean-Yves Tadié (À la recherche du temps perdu, 4 Bde.), bei Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade).
1988–2007 Erste deutsche kommentierte Gesamtausgabe, hrsg. von Luzius Keller bei Suhrkamp.
1991 Écrits de jeunesse, 1887–1895, hrsg. von Anne Borrel beim Institut Marcel Proust International (nicht in den frz. und dt. Gesamtausgaben berücksichtigt).