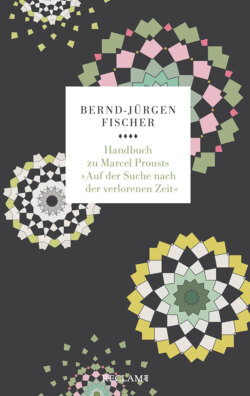Читать книгу Handbuch zu Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« - Bernd-Jürgen Fischer - Страница 6
ОглавлениеII FRÜHE WERKE
Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge Prousts Veröffentlichungen aus den Jahren 1892–96 sind 1896 unter dem Titel Les Plaisirs et les Jours gesammelt erschienen (s. unten) und die aus den Jahren 1900–07 in Pastiches et mélanges 1919 (s. unten). Prousts zahlreiche Literatur- und Theaterkritiken aus der Zeit 1882–1922 finden sich gesammelt im dritten Teil des Bandes Contre Sainte-Beuve, précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade) 1971 (dt. Essays). Unveröffentlichtes oder nur in Schülerzeitschriften erschienenes Material aus Prousts Jugendtagen gab das Institut Marcel Proust International 1991 unter dem Titel Écrits de jeunesse 1887–1895 heraus.
Der Fragebogen Auch wenn es sich dabei nicht eigentlich um ein »Werk« handelt, ist der »Proust Questionnaire« doch zu bekannt und vor allem zu informativ, als dass man ihn hier übergehen könnte. Es handelt sich eigentlich um eine Salon-Spielerei, die um 1860 in England in Mode kam und dann auf den Kontinent überschwappte. Proust wurde zum ersten Mal 1886 mit einem solchen Fragenkatalog für das »Album to Record Thoughts, Feelings, &c« von Antoinette Faure konfrontiert (der Tochter des späteren Staatspräsidenten), wobei er die englischen Fragen auf Französisch beantwortete. 1891 oder 1892 wurde der Bogen Proust abermals in geringfügig veränderter Form für das Album »Les Confidences de Salon« vorgelegt, diesmal mit den Fragen auf Französisch. Hier die beiden Bögen in Zusammenfassung, wobei die Fragen von 1886 von denen von 1891/92 durch einen Schrägstrich getrennt sind, soweit sie voneinander abweichen:
| Frage | Antwort 1886 | Antwort 1891/92 |
| Ihre bevorzugte Tugend. | Alle Tugenden, die nicht für eine Sekte spezifisch sind, die universellen. | |
| Der wesentlichste Aspekt Ihrer Persönlichkeit. | ––– | Das Bedürfnis, geliebt zu werden; genauer gesagt, vielmehr das Bedürfnis, gestreichelt und verwöhnt zu werden, als das nach Bewunderung. |
| Die Qualität, die ich mir bei einem Mann wünsche. | Intelligenz, ein Sinn für Moral. | Männliche Tugenden, und Offenheit in der Freundschaft. |
| Die Qualität, die ich mir bei einer Frau wünsche. | Sanftmut, Natürlichkeit, Intelligenz. | Weiblicher Charme. |
| Was gefällt mir am besten an meinen Freunden. | Wenn sie zärtlich zu mir sind, wenn ihre Persönlichkeit wundervoll genug ist, um den Wert dieser Zuneigung hoch zu veranschlagen. | |
| Mein größter Fehler. | Dass ich nicht weiß, was ich will; meine Willensschwäche. | |
| Meine Lieblingsbeschäftigung. | Das Lesen, Träumen, Gedichte, Geschichte, Theater. | Zu lieben. |
| Mein Traum vom Glück. | Nahe bei denen zu leben, die ich liebe, und mit dem Charme der Natur; mit einer Menge Bücher und Partituren, nicht weit von einem Theater. | Ich fürchte, er ist nicht groß genug, ich wage es nicht, davon zu sprechen, ich habe Angst, ihn zu zerstören, wenn ich von ihm spreche. |
| Was wäre mein größtes Unglück? | Von Maman getrennt zu sein. | Meine Mutter oder meine Großmutter nicht gekannt zu haben. |
| Wer ich gern wäre. | Da ich mir die Frage nicht zu stellen brauche, ziehe ich es vor, sie nicht zu beantworten. Ansonsten wäre ich gern Plinius der Jüngere gewesen. | Ich selbst, wie mich die Leute, die ich bewundere, gern hätten. |
| Das Land, in dem ich am liebsten leben würde. | In einem idealen Land, oder vielmehr, in einem Land meines Ideals. | Ein Land, in dem gewisse Dinge, die mir gefielen, wahr würden wie von Zauberhand, und wo Zuneigung immer erwidert würde. |
| Meine Lieblingsfarbe. | Ich liebe sie alle. | Die Schönheit liegt nicht in den Farben, sondern in ihrer Harmonie. |
| Meine Lieblingsblume. | Weiß nicht. | Ihre/Seine [»la sienne«] – und danach alle. |
| Mein Lieblingsvogel. | Die Schwalbe. | |
| Meine bevorzugten Prosa-Autoren. | George Sand, Auguste Thierry. | Zur Zeit Anatole France und Pierre Loti. |
| Meine bevorzugten Poeten. | Musset. | Baudelaire und Alfred de Vigny. |
| Meine fiktiven Heroen. | Die Helden poetischer Romane, solche, die eher ein Ideal als ein Modell sind. | Hamlet. |
| Meine fiktiven Heroinen. | Jene, die mehr als nur Frauen sind, ohne dabei ihr Geschlecht zu verleugnen, alles, was poetisch zart, rein, schön in allen Gattungen ist. | Beatrice. |
| Meine Lieblings-Komponisten. | Mozart, Gounod. | Beethoven, Wagner, Schumann. |
| Meine Lieblingsmaler. | Meisonnier. | Leonardo da Vinci. Rembrandt. |
| Meine Heroen in der Wirklichkeit. | Ein Mittelding aus Sokrates, Perikles, Mahomet, Musset, Plinius dem Jüngeren. Auguste Thierry. | Monsieur Darlu, Monsieur Boutroux. |
| Meine Heroinen in der Wirklichkeit / in der Geschichte. | Eine geniale Frau, die das Leben einer gewöhnlichen Frau lebt. | Kleopatra. |
| Meine bevorzugten Namen. | ––– | Ich habe immer nur einen auf einmal. |
| Was ich vor allem verabscheue. | Leute, die nicht spüren, was gut ist, die von der Süße der Zuneigung nichts wissen. | Was schlecht an mir ist. |
| Historische Gestalten, die ich am meisten verachte. | ––– | Dafür bin ich nicht gebildet genug. |
| Die militärische Leistung, die ich am meisten bewundere. | Mein Wehrdienst. | |
| Das Talent, das ich am liebsten besäße. | Wille, und Verführungskraft. | |
| Wie ich sterben möchte. | Gebessert – und geliebt. | |
| Ihr gegenwärtiger seelischer Zustand? | ––– | Überdruss daran, dauernd an mich denken zu müssen, um diese Fragen zu beantworten. |
| Fehler, mit denen ich die größte Nachsicht habe. | Das Privatleben von Genies. | Solche, die ich verstehen kann. |
| Mein bevorzugtes Motto. | Eines, das sich nicht zusammenfassen lässt, weil sein einfachster Ausdruck das Schöne, das Gute, das Große in der Natur ist. | Ich hätte zu viel Angst, dass es mir Unglück bringt. |
L’Indifférent (1. März 1896 in: La Vie Contemporaine; dt. Der Gleichgültige, in: Freuden und Tage, S. 242–257) Es handelt sich hierbei um eine kleine Novelle, in Prousts Worten eine »nouvelle imbécile« (Corr. X, S. 197), die bald nach ihrem Erscheinen wieder vergessen worden war, bis Proust sich im November 1910 an sie erinnerte und Robert de Flers fragte, ob er ihren Abdruck noch habe, da er sie jetzt brauche. Es handelt sich um die Skizze einer zur Manie gewordenen Liebe, wie wir ihr dann in Eine Liebe von Swann breit ausgeführt wiederbegegnen, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen: in L’Indifférent ist es eine große Dame, »Madeleine«, die sich in einen Mann verliebt, der von ihr nichts wissen will – und weil er von ihr nichts wissen will. Wie Kolb in seinem Vorwort hervorhebt, ist es eben diese von Proust beschriebene »berühmte Maxime der Koketterie« des »wenn ich dich nicht liebe, wirst du mich lieben«11, was auch die Beziehung zwischen Swann und Odette, Marcel und der Herzogin von Guermantes, Marcel und Albertine, Saint-Loup und Rachel überschattet. Daneben finden sich auch etliche Einzelheiten aus Un amour de Swann bereits in dieser Novelle, wie etwa die »catléya« oder die Fetischisierung eines Gemäldes, das in den Augen des/der Verliebten der/dem Geliebten ähnelt; auch der Namenwahl »Madeleine« dürfte das gleiche Sündenmotiv zugrunde liegen, das die »Petite Madeleine« in Combray so attraktiv macht. – Diese frühe Fingerübung in der Psychologie der Liebe geriet abermals in Vergessenheit, bis Philip Kolb sie 1978 wieder ausfindig machte und bei der Nouvelle Revue Française erneut publizierte.
Les Plaisirs et les Jours (1896 bei Calmann-Lévy; dt. Freuden und Tage) Eine Zusammenstellung früherer Publikationen in den Zeitschriften Le Banquet und La Revue blanche aus den Jahren 1892–96, die von Madeleine Lemaire illustriert und von Reynaldo Hahn mit vier Stücken für Klavier ausgestattet wurde; mit einem Vorwort von Anatole France. Diese in nur kleiner Auflage hergestellte Liebhaberausgabe blieb praktisch unverkauft. 1924 erschien bei Gallimard eine reine Textausgabe. Der Titel des künstlerisch aufgemachten Buches, dessen Texte eine hedonistische Gesellschaft am Ende ihrer Zeit skizzieren und in dessen geistigem Zentrum die schönen Künste stehen, lehnt sich ironisch an Hesiods griechisches Lehrgedicht Erga kai hemerai an (8./7. Jh. vor Chr.; dt. Werke und Tage; frz. Les Travaux et les jours, Übers. Leconte de Lisle), das auf der einen Seite eine Theorie der Weltzeitalter und des unaufhaltsamen Niedergangs entwickelt, jedoch auf der anderen Seite auch die tägliche Problematik der bäuerlichen Überlebenskunst diskutiert.
Jean Santeuil Während eines Urlaubs 1895 in der Bretagne nahm Proust jenen »deutschen Bildungsroman« in Angriff, den er bereits 1893 in Violante ou la mondanité (dt. Violante oder die mondäne Welt; EA in Le Banquet, Wiederaufnahme in Les Plaisirs et les Jours) angekündigt hatte. Das Manuskript wurde unter den Papieren von Prousts Nichte Adrienne gen. Suzy Mante-Proust aufgefunden und 1952 von Bernard de Fallois unter dem Titel Jean Santeuil, dem Namen der Hauptperson, bei Gallimard herausgegeben. Das Romanprojekt erzählt in der dritten Person in einer Mischung aus Autobiographie und Fiktion von der Jugend Jeans, die er in einem Zustand naturekstatischen Egozentrismus verbringt, verliert sich dann jedoch zunehmend ins Fragmentarische, als es gilt, den Protagonisten in die Welt hinauszuführen und ihn mit deren Wahrnehmung der Wirklichkeit zu konfrontieren. Während sich das Ich des im Ich befangenen jungen Jean noch von außen vom Standpunkt einer dritten Person beschreiben ließ, wird die Er-Form zunehmend problematisch, als es darum geht, das Abbild der Außenwelt in der Innenwelt des Protagonisten zu betrachten. 1899 gab Proust das Projekt auf, benutzte es jedoch als Ideenreservoir bei der Arbeit an der Suche; zahlreiche Schlüsselmotive sind aus dem Romanfragment in wenig veränderter Form übernommen, so der Gutenachtkuss, die Weißdornblüten, der Besuch in einer Garnisonsstadt, das Herzogspaar, die Dreyfusaffäre, sowie zahlreiche Skizzen zum Thema Liebe und Eifersucht. Vor allem aber zeichnet sich in Jean Santeuil bereits Prousts Unterscheidung von zwei Formen von Erinnerung ab, der willentlichen und der unwillentlichen, eine Entdeckung, der er in Contre Sainte-Beuve weiter nachgehen und die er in der Suche endgültig ausarbeiten wird.
Eine deutsche Übersetzung von Eva Rechel-Mertens erschien 1965 unter dem Titel Jean Santeuil bei Suhrkamp; eine Überarbeitung dieser Übersetzung durch Luzius Keller erschien 1992 im selben Verlag.
La Bible d’Amiens (1904, Mercure de France) Auf Ruskin ist Proust vermutlich von seinem Professor an der École libre des sciences, Paul Desjardins, aufmerksam gemacht geworden, der ab 1893 Übersetzungen von Auszügen aus Ruskins Werken publizierte. Als Proust 1899 Urlaub in Évian am Fuß der Alpen machte, überkam ihn ein so dringendes Bedürfnis, »die Berge mit den Augen dieses großen Mannes zu sehen« (Corr. II, S. 357), dass er seinen Urlaub abbrach, um sich in Paris in Robert de La Sizerannes Studie Ruskin et la religion de la beauté (1897) vertiefen zu können. Noch im selben Jahr nahm Proust dann die Übersetzung der Bible of Amiens (1884) in Angriff, die 1903 abgeschlossen wurde. Der Text wird begleitet von einem umfangreichen Vorwort Prousts, das von seiner eingehenden Auseinandersetzung mit der Architektur der Gotik zeugt, von der auch zahlreiche Partien in der Suche profitiert haben; insbesondere das Strukturkonzept, das Proust bei Jean Santeuil noch gefehlt hatte, das des Romans als Kathedrale, hat die Suche sicherlich der Auseinandersetzung mit Ruskins Werk zu verdanken. Wie sehr es Proust aber verstanden hat, bei aller Assimilation doch die Distanz zu Ruskin (und zu sich selbst) zu wahren, zeigt übrigens sein brillanter Ruskin-Pastiche »La Bénédiction du sanglier« aus dem Nachlass (vermutl. 1908; in: La Nouvelle Revue Française, 1. Okt. 1953; dt. »Die Segnung des Ebers«, in: Nachgeahmtes und Vermischtes).
Sésame et les Lys (1906, Mercure de France) Anfang 1904 begann Proust in Zusammenarbeit mit Marie Nordlinger mit der Übersetzung von Ruskins Sesame and Lilies (1865), zwei Vorträgen, deren erster, Of Kings’ Treasuries, vom richtigen Umgang mit Büchern handelt, während der zweite, Of Queens’ Gardens, die Mädchenerziehung zum Thema hat. In der Auseinandersetzung mit dem ersten Thema gab Proust der Übersetzung als Vorwort einen Essay Sur la lecture mit, den er 1905 in La Renaissance latine vorveröffentlicht hatte und 1919 mit geringen Veränderungen unter dem Titel Journées de lecture (dt. Tage des Lesens) in die Sammlung Pastiches et mélanges aufnahm. (Dieser Titel ist etwas irreführend, da Prousts Rezension von 1907 der Memoiren der Madame de Boigne den gleichen Titel trägt.) Darin finden sich bereits die Erinnerungen an Lektüreerlebnisse, die dann auch Eingang in Combray gefunden haben. Ein Faksimile der Handschrift wurde zusammen mit begleitenden Essays und einer Transkription 2004 unter dem Titel Sur la lecture – Tage des Lesens von Jürgen Ritte und Reiner Speck bei Suhrkamp herausgegeben.
Pastiches et mélanges (1919, Gallimard; dt. Nachgeahmtes und Vermischtes) Eine Sammlung von Pastiches um die Lemoine-Affäre, die 1908 und 1909 im Figaro erschienen, einem neuen Pastiche zum gleichen Thema im Stil von Saint-Simon, den Essays »Tage des Lesens« und »Sohnesgefühle eines Muttermörders« von 1905 bzw. 1907 sowie verschiedenen Artikeln zu Ruskin und zur Sakralarchitektur aus den Jahren 1900–04. Die deutsche Übersetzung wurde noch um fünf Pastiches aus dem Nachlass vermehrt. Während die Ruskin-Texte Prousts eigenständige Auseinandersetzung mit seinem Autor unter Beweis stellen, wirken die Pastiches wie Sprechübungen für die verschiedenen Stimmen, mit denen Proust in der Suche einzelne Personen ausstattet: den ›Klang‹ Sainte-Beuves etwa findet man bei Madame de Villeparisis wieder, Renans bei Legrandin, Saint-Simons bei Charlus und Ruskins bei Marcel während seines Venedig-Besuchs in der Entflohenen.
Contre Sainte-Beuve (1954, Gallimard; dt. Gegen Sainte-Beuve) 1908 begann Proust, vermutlich angeregt durch Romain Rollands Roman Jean Christophe, sich näher mit dem Dichter und vor allem Kritiker Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804–69) auseinanderzusetzen, dessen Methode, ein Werk von der Biographie des Autors her zu beurteilen, wie Norpois es mit Bergotte in der Suche machen wird, ihm zutiefst suspekt war. Proust hält diesem Supremat des Verstandes die eigentliche Qualität der Literatur entgegen, das Gefühl direkt anzusprechen, und entwickelt in diesem Zusammenhang das Konzept einer »Erinnerung des Gefühls«, die geeignet ist, die Vergangenheit wieder zum Leben zu erwecken, in Gegensatz zu der lediglich sezierenden »Erinnerung des Verstandes«. Zur Erläuterung dieser Unterscheidung treten hier bereits die aus der Suche vertrauten Erinnerungsauslöser auf, der Stolperstein in einem Hof, der Klang eines scheppernden Löffels, die in Tee getunkte Madeleine (hier noch »pain grillé« oder »biscotte«, die womöglich auf eine Erinnerung an Wagners Zwieback zurückgehen12). Proust bot im August 1909 dem Mercure de France eine erste Fassung an, der jedoch ablehnte. Danach scheint Proust das Interesse an dem Projekt verloren zu haben; zahlreiche Notizen und Entwürfe, die den verwendeten Namen nach zu urteilen für das Sainte-Beuve-Projekt gedacht waren, wurden nicht mehr eingearbeitet und später für die Suche verwendet, insbesondere der Abschnitt »La Race des tantes« für SG I. Aus diesen Übernahmen erklären sich auch die gelegentlich überraschenden Umbenennungen von Personen der Suche (z. B. General Beaucerfeuil als Beauserfeuil, dann als Saint-Joseph und schließlich Monserfeuil) als übersehene Korrekturen bei der Neuverwendung.
Der Text wurde, wie schon der für Jean Santeuil, in den Papieren von Suzy Mante-Proust entdeckt und 1954 bei Gallimard publiziert. Da es sich nicht eigentlich um ein Manuskript handelt, sondern um eine Sammlung von Fragmenten, erschien 1971 eine Neufassung durch Pierre Clarac und Yves Sandre, die in anderer Weise mit dem Material umgeht. Einen eigenen Weg, der die beiden französischen Ansätze zu vereinbaren sucht, geht die von M. B. Bertini und L. Keller edierte und von Helmut Scheffel übersetzte deutsche Ausgabe unter dem Titel Gegen Sainte-Beuve bei Suhrkamp 1997.
Die Pastiches Proust war sein Leben lang von einem unbändigen Nachahmungstrieb beseelt. Mit seinen nach allen Erinnerungen offenbar äußerst gelungenen Imitationen prominenter Mitglieder der Gesellschaft machte er sich bei Soireen nicht nur Freunde: So war Robert de Montesquiou gründlich verschnupft, als man ihm hinterbrachte, dass er selbst das Opfer von Prousts Witz geworden sei. Dieser Spaß am überkonturierten Konterfei zeigte sich schon früh in Prousts schriftstellerischer Tätigkeit: Bereits mit siebzehn Jahren reicht er bei der Schülerzeitung La Revue Lilas einen Pastiche des Literaturkritikers Jules Lemaître ein. Er verfertigt Zeichnungen im Stil Manets oder Dethomas’, schreibt (an Freunde) Briefe im Stil der Gräfin von Greffulhe oder auch in der Sprache der Bibel, verfasst Gedichte im Stil von Boisrobert oder Mallarmé, und in einer Artikelserie über die »Lemoine-Affäre« (dt. in Nachgeahmtes) ahmt er Autoren wie Balzac, Maeterlinck, Goncourt, Saint-Simon und sogar Ruskin nach und übt in der Stimme Sainte-Beuves Kritik an seinen eigenen Flaubert- und Chateaubriand-Pastiches. In die Suche sind etliche Miniaturen eingegangen, so eine Passage über Goethe im Stil Goethes (WG, S. 344 f.), ein Proust-Pastiche, dieser allerdings von Albertine (G, S. 170–173), und in WZ ein längerer Bericht der Goncourts von einer Soiree bei den Verdurins (S. 24–35). In einem Brief vom Mai 1922 (Corr. XXI, S. 187–189) an den Kritiker Paul Souday schließlich verfertigt Proust seinen letzten Pastiche: als Kritik in des Kritikers eigenem Stil an seiner Kritik an Proust.
Gedichte Von seinem siebzehnten Lebensjahr an vergnügte Proust sich damit, Gedichte für Freunde und Bekannte oder für den Vortrag in Salons zu verfassen. Eine kommentierte Sammlung dieser Werke gaben Claude Francis und Fernande Gontier 1982 bei Gallimard heraus (Cahiers Marcel Proust, 10). Übersetzungen erschienen auf Englisch, Italienisch und Spanisch; eine deutsche Übersetzung (Marcel Proust, Les Poèmes – Die Gedichte, frz./dt.) erschien 2018 bei Reclam.
Zeichnungen Proust bereicherte zuweilen seine Kladden (Cahiers) wie auch seine Briefe an Freunde mit Zeichnungen, meist schlichten Kritzeleien, manchmal aber auch genial hingeworfenen Skizzen wie etwa die »Studie für einen lachenden Montesquiou«. Eine leider immer noch nicht vollständige Sammlung dieser Werke – auf Auktionen erscheint doch von Zeit zu Zeit ein neuer Fund und verschwindet gleich wieder – gab Philippe Sollers 1999 bei Gallimard unter dem Titel L’Œil de Proust – Les dessins de Marcel Proust heraus (darin S. 76 das Montesquiou-Porträt).