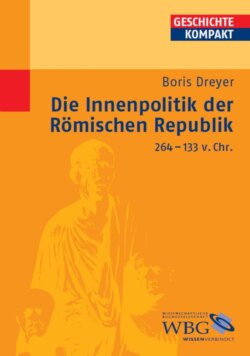Читать книгу Die Innenpolitik der Römischen Republik 264-133 v.Chr. - Boris Dreyer - Страница 10
c) Zu den Quellen
ОглавлениеDie Überlieferung für die frühe und „klassische“ Geschichte Roms ist reichhaltig – wenigstens gemessen an dem, was sonst aus dem Bereich der Alten Geschichte auf uns gekommen ist.
Livius
Zu nennen wäre insbesondere das Historienwerk Ab Urbe condita („Seit der Gründung Roms“) des Titus Livius, der in der augusteischen Zeit, also nach dem Untergang der Republik, lebte und in 142 Büchern die römische Geschichte von 753 bis 9 v. Chr. geschrieben hat.
Diese 142 Bücher wurden in der Zeit von 27 v. Chr. bis 17 n. Chr. verfasst. Das bedeutet, dass der Autor circa 3 bis 4 Bücher pro Jahr geschrieben hatte, mithin nicht viel Zeit für die Forschung aufbringen konnte.
Polybios
Das Werk des Livius ist heute nur zu einem Bruchteil erhalten. Den Verlust ersetzen byzantinische Zusammenfassungen in nur mäßigem Umfang. Die Überlieferung bricht nach den ersten zehn Büchern (290 v. Chr.) ab und setzt mit der Auseinandersetzung Roms gegen Hannibal wieder ein (20. Buch, 220 v. Chr.). Die Originalüberlieferung ist vom 20. Buch bis zum 45. Buch fast lückenlos. Für die Ereignisse im Osten ab 200 v. Chr. hat Livius (ab Buch 30) den Historiker Polybios benutzt, der eine Geschichte der antiken Mittelmeerwelt (der Oikumene) verfasste, die den Aufstieg Roms zur Vormacht im Mittelmeerraum in 40 Büchern zwischen 220 und 145 v. Chr. abhandelte. In seinem Vorspann (prokataskeué) schilderte er zusätzlich die Ereignisse ab 264 v. Chr.
Obgleich Polybios die Geschehnisse im Westen des Mittelmeers und diejenigen in Rom ausgiebig behandelte, nutzte Livius das reichhaltigere Material römischer Provenienz, während er für den Osten die Darstellung des Polybios übernahm. Diese Bereiche gehören zum besten Material, das bei Livius erhalten ist. Da Polybios bis auf die Bücher 1–5 nur in Fragmenten unterschiedlicher Qualität (aus spätantiker oder byzantinischer Zeit) vorliegt, ist Livius, soweit er auf Polybios beruht, das Wertvollste (neben den dokumentarischen Quellen, die meist nur lokale Umstände schildern), was wir aus der Zeit zwischen 287/264 und 133 besitzen.
Lateinische Quellen und ihr Wert
Für die Geschehnisse im Westen einschließlich Italien griff Livius auf lateinische Quellen zurück. Demnach war seine Darstellung auch über die Frühzeit Roms von dem Wert seiner Quellen abhängt, die Livius aus Zeitmangel nicht auf den Wahrheitsgehalt prüfen konnte. Und es gibt Anlass am historischen Wert des Dargestellten zu zweifeln, wie folgendes Beispiel beweisen soll.
Livius schreibt zu Beginn des 6. Buches, im Anschluss an die Schilderung der Brandschatzung Roms durch die Gallier 387 v. Chr.:
Q
Zum Buch des Livius
(Liv. 6,1,1–3)
„Ich habe die Geschichte der Römer von der Gründung der Stadt bis zu ihrer Einnahme, zunächst unter Königen, dann unter Konsuln, Diktatoren, Decemvirn und Konsulartribunen, draußen im Kriege, daheim die inneren Auseinandersetzungen, in fünf Büchern dargestellt. Diese Dinge sind schon durch ihr allzu hohes Alter in Dunkel gehüllt wie Gegenstände, die man aus großer räumlicher Entfernung kaum erkennen kann, vor allem aber, weil man in diesen Zeiten nur ganz kurz und selten etwas aufgeschrieben hat, was doch die einzig zuverlässige Art ist, die Erinnerung an das historische Geschehen zu bewahren, und weil dies, selbst wenn es etwas derartiges in den Aufzeichnungen der Pontifices und anderen öffentlichen und privaten Dokumenten gegeben hat, beim Brand der Stadt zum großen Teil untergegangen ist. Deutlicher und sicherer wird sich im Folgenden die Geschichte daheim und im Felde von der zweiten Gründung der Stadt an darstellen lassen, nachdem diese gleichsam aus den Wurzeln üppiger und fruchtbarer wieder emporgewachsen war.“
Wenn alles vor 387 v. Chr. verbrannt ist und Livius dennoch in 10 Büchern über die Geschichte Roms bis 291 v. Chr., als seine Darstellung abbricht, eine ganze Menge zu berichten weiß, fragt man sich, woher er und die anderen Historiker, die über die Frühzeit und die Klassische Zeit Roms berichteten, diese Informationen bezogen.
Dionysios-Diodor-Trogus-Dio
Der Grieche Dionysios von Halikarnass beschrieb die frühe Geschichte Roms in seinen Antiquitates, die zwar mitunter eine Alternative zu anderen Versionen liefern, aber letztendlich für die inneren Zustände Roms auf der Annalistik oder öffentlichen Dokumenten basieren, zu denen Dionysios im ersten vorchristlichen Jahrhundert noch Zugang hatte.
Diodors Bibliotheke ist in der Zeit Caesars entstanden. Der Wert seiner Darstellung bemisst sich nach dem Wert seiner Quellen. Immerhin hatte Diodor eine glückliche Hand bei der Auswahl seiner Hauptquelle, die nicht mehr erhalten ist. Leider liegt seine Darstellung nur bis zum Jahr 301 v. Chr. vor, danach nur noch in byzantinischen Exzerpten.
Unklar bleiben die Quellen einer weiteren Universalgeschichte dieser Zeit aus der Hand des Trogus, dessen Werk wiederum nur in späten Exzerpten oder in der unzuverlässigen Zusammenfassung von Justin aus der Hohen Kaiserzeit erhalten ist.
Bemerkenswert sind weiter die umfangreich, wenn auch nicht immer im Original erhaltenen Passagen zur frührömischen und klassischen römischen Geschichte von Cassius Dio in griechischer Sprache. Dieser war ein hoch dekorierter und erfolgreicher Politiker und Statthalter der Severerzeit (Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr.), der durch die Ausschreibung annalistischer Traditionen oft interessante Alternativen zur Darstellung des Polybios für die Zeit nach 264 v. Chr. bietet. Die Version Dios macht deutlich, dass zumindest die ältere annalistische Tradition nicht „über einen Kamm“ geschoren und einhellig verdammt werden sollte, vielmehr auch schon im 3. Jahrhundert einigen, wenn auch im Einzelnen schwer zu qualifizierenden Wert besitzen kann.
Wertvolle Informationen bieten die Viten über wichtige römische Persönlichkeiten, Politiker und Feldherrn aus der Feder des belesenen Plutarch aus Chaironeia (in Griechenland) im 2. Jahrhundert n. Chr., die wir sonst nicht mehr fassen können. Wichtige Biographien sind etwa die des Q. Fabius Maximus Verucosus „Cunctator“, Marcus Claudius Marcellus, M. Porcius Cato, Titus Quinctius Flamininus, L. Aemilius Paullus, Tiberius und Gaius Gracchus.
Annalistik
Die historiographische Überlieferung der römischen Geschichte vom 8. bis 4. Jahrhundert v. Chr. beruht fast ausschließlich, diejenige der Zeit danach zu einem beträchtlichen Teil auf der sogenannten Annalistik. Man spricht von der älteren Annalistik aus der hohen und der späten Republik und der jüngeren Annalistik aus der Zeit Sullas und des Augustus. Genauere Angaben über Werkumfang und Lebenszeit der einzenen Autoren sind oft nicht möglich. Zu den bekannteren gehören Valerius Antias, Q. Aulus Quadrigarius, Licinius Macer und Q. Aulus Tubero.
Zurückzuführen ist diese Gattung auf die Festkalender (fasti; etwa fasti Capitolini) der Oberpriester (pontifices maximi), die vor dem Haus der Priester (regia) aufgestellt und dann archiviert wurden. An diese fasti wurde eine Jahresliste mit sogenannten eponymen Magistraten gehängt. Für die ältere Zeit hat man aber bei den erhaltenen Verzeichnissen mit annalistischen Interpolationen wenigstens bis um 450 v. Chr. zu rechnen. Nach den eponymen Magistraten wurden in Rom die Jahre gezählt. Man schrieb wichtige Ereignisse oder göttliche Vorzeichen zur Erinnerung dazu, damit keine kultischen Feste durch weltliche Angelegenheiten (etwa durch Gerichtstage) entweiht würden (fasti = dies, quibus fas est, lege agere = „Tage, an denen es recht ist, Gericht zu halten“).
Die hinzugeschriebenen Ereignisse wurden immer ausführlicher und erhielten am Ende des 4. Jahrhunderts den Charakter einer Chronik. Diese jahresweise Anfügung von Ereignissen an die Konsuln (daher Annalen, von annus = Jahr) wurde bis 125 v. Chr. (133?) fortgeführt und dann in 80 Büchern Annales maximi von dem pontifex maximus Scaevola ediert. Danach wurde auf eine Weiterführung verzichtet.
Denn mittlerweile hatten sich Historiker der jahresweisen Darstellung angenommen, nachdem die Literatur in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr. auch in Rom Fuß gefasst hatte.
Cato der Ältere
Diese Historiker schrieben zunächst griechisch, wie Fabius Pictor und Cincius Alimentus. Daneben hat Cato der Ältere (Censorius) sein Werk Origines (Ursprünge) auf Latein geschrieben. Ihr Charakteristikum ist gerade nicht die annalistische Anordnung der Taten einzelner Geschlechter. Vielmehr war das Programm des Cato, die Taten des römischen Volkes ohne die herkömmliche Ausrichtung auf die Bewährung einzelner Vertreter des Adels, der Nobilität, also res sine nominibus, zu schildern. Um die Jahrhundertmitte begannen auch die (älteren) Annalisten lateinisch zu schreiben.
Cicero
Eine besondere Erwähnung verdienen noch – neben den Rechtskommentaren der römischen Kaiserzeit – die Reden, Denkschriften, Briefe und philosophischen Schriften Ciceros. Sein in den Exkursen ausgebreitetes Wissen über die römische Vergangenheit (wenn auch schwerpunktmäßig für die Zeit ab 133), das durch eine konservative Sicht geprägt ist, ist eine wichtige Informationsquelle.
Weitere Quellen und Indizien
Die sogenannten monumenta privata, deren Bedeutung Polybios (6,53ff.) bei der Bestattung hervorhebt – dann wurde zum Ruhm des gerade Verstorbenen und seines Geschlechts aus diesen „Privatarchiven“ vorgetragen – sind kaum erhalten, können also nicht wirklich die Lücken füllen.
So ist man für die Rekonstruktion der römischen Geschichte der sogenannten Klassischen Republik auf Einzelnachrichten verschiedenster Provenienz (zum Teil nur mit punktueller Aussagekraft) angewiesen:
Glücklicherweise lassen immer mehr dokumentarische Quellen Rückschlüsse auf die Innenpolitik Roms und die Handlungen der Senatoren zu, wenn sie auch in der Regel nicht lateinischer Provenienz sind. Vielmehr stammen sie aus den griechischen Städten des östlichen Mittelmeers, die sich gegen Ende des 3. Jahrhunderts mit der zunehmenden römischen Suprematie konfrontiert sahen.
Darüber hinaus bringen archäologische Untersuchungen Erkenntnisse über die Zustände in Rom. Weiter lassen sprachgeschichtliche Erwägungen, wie die Bedeutungsgeschichte und die Rekonstruktion älterer Konnotationen, Folgerungen zu. Gleiches gilt für die Namenskunde (Orts- und Personennamen). Institutionenkunde und Rechtsgeschichte erlauben Rückschlüsse von der historischen Zeit auf die Frühzeit und den Beginn der Klassischen Phase, zum Beispiel hinsichtlich der Funktionsweise der römischen Volksversammlungen beziehungsweise des Familien- und Erbrechts. Dasselbe gilt für die tradierten Riten und Kulte.