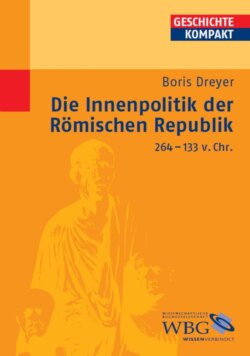Читать книгу Die Innenpolitik der Römischen Republik 264-133 v.Chr. - Boris Dreyer - Страница 18
f) Die zweite Phase
ОглавлениеGallierkatastrophe
Wegen des Versagens bei der Gallierkatastrophe im Jahre 387 v. Chr. hatten die Patrizier allen Kredit verspielt, der die Rechtfertigung für die Privilegien lieferte. Daher musste die Basis der Führung erweitert werden. Die Patrizier waren klug genug, rechtzeitig, wenn auch nur Schritt für Schritt nachzugeben, um nicht ganz von der Entwicklung hinweggefegt zu werden.
leges Liciniae Sextiae
Die Führer der plebs wurden zu den Senatssitzungen hinzugezogen – erst später mit vollem Stimmrecht. Unter den zwei Konsuln (von consalire = zusammenspringen), die nach der Überlieferung 367 v. Chr. im Rahmen von zwei Plebisziten (sogenannte leges Liciniae Sextiae: die Anträge der Volkstribune hatten damals noch keine Gesetzeskraft!) entstanden sein sollen, durfte nunmehr ein Plebejer sein. In dieser Zeit sollen auch die zunächst rein patrizische Gerichtsmagistratur mit der alten Bezeichnung des Praetor (urbanus) geschaffen und den plebejischen die kurulischen (patrizischen) Aedilen beigestellt worden sein.
An diesen Regelungen, die auf einen Ausgleich der Stände zielten, ist zu erkennen, dass zu dieser Zeit die zentrale Motivation der Vertreter der aufstrebenden Plebejerfamilien für ihren Protest im politischen Bereich lag. Sie waren bereits (als größere Grundbesitzer) wirtschaftlich potent und wegen ihrer Klientel (ihrer Anhängerschaft) einflussreich.
Die römische Tradition will allerdings einem der genannten Plebiszite wirtschaftliche und soziale Motive zuordnen, die jedoch ebenso wie die dort formulierten, einer späteren Zeit angehörenden Besitzregelungen (an ager occupatorius ein Höchstmaß von 500 iugera = 125 ha) anachronistisch sind.
Annuität und Kollegialität
Mit dem Zugang zum Konsulat war zugleich ausgemacht, dass die Plebejer im Senat auch ein Stimmrecht erhielten. An der Obermagistratur sind zwei fundamentale Prinzipien für die römischen Magistrate der „klassischen Zeit“ zu studieren, das der Annuität und der Kollegialität.
Konsul/imperium
Folgende Aufgaben hatten die Konsuln zu versehen: Sie führten das Bürgeraufgebot zu Felde, das fortan aus vier Legionen, später aus vier Legionen bestand, die auf die Konsuln aufgeteilt wurden. Sie leiteten die Zenturiatskomitien und die Senatssitzungen. Ihre Amtsgewalt (imperium) war ungeteilt und ihr veto legte alle Amtshandlungen – einschließlich derjenigen des Kollegen – lahm. Dies konnte sonst nur noch der Volkstribun (nach der Legalisierung seiner Befugnisse im Jahre 287 v. Chr.). Generell waren die kontrollierenden Elemente stärker als die Exekutive im institutionellen Gefüge Roms.
Das „imperium ist die Amtsgewalt der höchsten römischen Magistrate und Inbegriff absoluter magistratischer Gewalt. Nach der Lehre Mommsens ist das imperium die unbeschränkte, alle militärischen, jurisdiktionellen, politischen und sonstigen Kompetenzen einschließende Vollgewalt des obersten Magistrats“ (Jochen Bleicken).
Praetor/potestas
Die gerichtlichen Aufgaben wurden dem Praetor zugewiesen, der auch über die imperium-Gewalt verfügte. Er unterstand den Konsuln aber infolge des vergleichsweise eng umgrenzten Aufgabenfeldes (minor potestas) als Richter oder später als Provinzstatthalter. Die übrigen niederen Magistrate hatten kein imperium. Diese reihten sich wiederum in eine Hierarchie durch ihre unterschiedliche potestas (zum cursus honorum siehe unten) ein.
Nobilität
Auch auf den übrigen politischen Feldern und zuletzt unter den Priesterstellen (pontifices/augures) wurden den (reichen) Plebejern bis zum Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. der Zugang gewährt. Allmählich konnte auf diese Weise durch Symbiose eine neue Führungsschicht, die Nobilität (nobiles), aus Patriziat und reichen Plebejern entstehen.