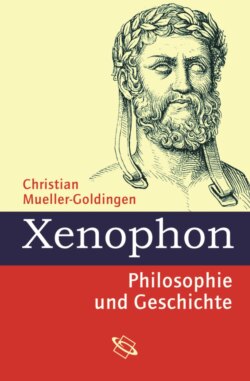Читать книгу Xenophon - Christian Müller-Goldingen - Страница 11
3. „Hieron“
ОглавлениеWie hat nun Xenophon dieses Thema, den Umgang mit der Macht, den richtigen Gebrauch von höherem Wissen, die verantwortungsvolle Haltung gegenüber einer Mehrheit von regierten Bürgern, ansonsten in seinem Werk diskutiert?
Um diese Fragen zu klären, bietet sich an zweiter Stelle der „Hieron“ an; dieser Dialog zwischen Simonides als dem Weisen und dem aufgeklärten Hieron gehört zu den späten Werken Xenophons. Entstanden wohl 360, ist er der gleichen Phase wie die späte „Kyrupädie“ (366-61) und der „Agesilaos“ (359) zuzurechnen. Dies lässt aber auch folgendes erkennen: Xenophon hat sich, wohl nach der Aufhebung der Verbannung in Athen, mit dem Problem der Macht aus verschiedenen Perspektiven und in mehreren Anläufen auseinander gesetzt. Er hat im „Hieron“ grundsätzlich die Frage diskutiert, ob sich absolute und korrupte Macht in eine gute Monarchie transformieren lasse, ob es rational reflektierte Möglichkeiten gibt, der Vernunft in einem von beiden Seiten, vom Volk und vom Herrscher, intrigant geführten Mächtespiel den Primat einzuräumen.
Dies war neu. Zwar hatte es bereits vor Xenophon die Konstellation Weiser – Herrscher in der Literatur gegeben – man denke an das Gespräch zwischen Solon und Kroisos bei Herodot -, aber die literarische Auseinandersetzung mit der Frage, wie ein Tyrann sozusagen kraft der eigenen Möglichkeiten zur Einsicht geführt werden könne, dass eine wohlwollende und offene Monarchie eine bessere Alternative darstelle, hatte keinen Vorläufer. Auch nicht bei Platon: Dieser hatte, wie bekannt, im „Staat“ den großen Versuch einer Analyse der Tyrannis unternommen; er hatte die Gefahren einer solchen Alleinherrschaft diskutiert. Bei Platon fehlte jedoch der Versuch, Möglichkeiten einer Transformation einer Tyrannenherrschaft in eine aufgeklärte Monarchie zu diskutieren.
Der xenophontische Dialog zwischen Simonides und Hieron war teils historisch, teilweise fiktiv. Historisch insofern, als der Autor auf historische Begebenheiten zurückgriff; Simonides war am Hof Hierons verkehrt, er hatte Oden auf den Herrscher von Syrakus verfasst. Er hatte seinen Neffen Bakchylides am Hofe von Syrakus eingeführt. Fiktiv war das Ganze insofern, als Xenophon seine eigenen Ideen und seine Vorstellungen von einer guten Herrschaft in dieses Gespräch eingebracht hatte. Das Ganze war sozusagen im Geist dieser beiden Personen geschrieben. Auf der einen Seite stand der „griechische Voltaire“ (G.E.Lessing), auf der anderen ein Mann, der es selbst fertig brachte, auf die Bedingungen der eigenen Herrschaft in einer aufgeklärten Weise zu reflektieren und der sich von dem Weisen belehren ließ.
So betrachtet, lieferte dieser Dialog auch das nötige Potential für einen Fürstenspiegel6. Nicht nur, dass Xenophon Wege zu zeigen versuchte, auf denen man durch Belehrung und rationale Aufklärung aus der selbstverschuldeten Isolation als Herrscher finden konnte. Xenophon gab auch Hinweise, wie der annähernd ideale Monarch auszusehen und wie er in einer bürgerfreundlichen Art und Weise mit seiner Macht umzugehen habe.
Im Einzelnen: Der Dialog zwischen dem weisen Simonides und dem Herrscher Hieron begann mit einem Paradox: Simonides kam zu Hieron, weil er von ihm wissen wollte, was den Lebenswandel des Tyrannen von dem des Privatmannes unterscheide. Der Weise trat somit nicht als die Autorität in Erscheinung, die überlegenes Wissen für sich reklamieren konnte; er schlüpfte in die Rolle dessen, der Belehrung und Wissen von einem anderen suchte. Damit war die aus Herodot bekannte Konstellation, wo Kroisos den weisen Solon befragte, in gewisser Weise umgekehrt. - Der xenophontische Hieron war bereits aufgeklärt; er verfügte über herrschaftliches Wissen, er konnte dieses im Dialog mit dem weisen Dichter ausspielen. Man könnte es auch anders formulieren: Diese Begegnung war auch ein Zusammentreffen zwischen zwei weisen Personen. So betrachtet, stellte sich für die Leser die Frage, warum denn eigentlich ausgerechnet Simonides Hieron aufsuchen sollte, warum der Weise sich an den Herrscher wandte, um belehrt zu werden. Nun: Xenophon scheint besonders an dieser paradoxen Situation gelegen zu haben. Er erfand das alte Repertoire, die Begegnung zwischen Herrscher und Weisem, in diesem Dialog sozusagen neu.
Gleichzeitig eröffnete sich dadurch die Möglichkeit, unter einer überraschenden Perspektive das alte Problem, wie sich denn Macht und Moral zueinander verhalten, neu zu behandeln. Der „Hieron“ ist auch eine sokratische Schrift, in der alte Topoi unter sokratischen Gesichtspunkten beleuchtet wurden und in der es um die Frage ging, inwiefern ein Herrscher in seinem Handeln sich an einer Instanz wie dem Gewissen zu orientieren habe – eine Frage, die bereits Antisthenes in seinen politischen Dialogen, insbesondere im „Menexenos“ und „Archelaos“, ferner Platon, aber auch Xenophon in seiner „Kyrupädie“ traktiert hatten.
Die Sokratiker waren von der Frage nach dem idealen Herrscher fasziniert; andernfalls wäre kaum zu erklären, warum eine derartige Fülle von Dialogen zu politischen Fragestellungen, über das Persönlichkeitsbild eines solchen Regenten, aber auch über negative Beispiele wie den makedonischen König Archelaos entstand. Das Wesen der Macht versuchte man auf diese Weise ebenfalls zu ergründen. Xenophon spielte in diesem Konzert der philosophischen und staatstheoretischen Literatur kräftig mit. Sein „Hieron“ ließ sich aber auch lesen wie ein großer Versuch, nicht nur das Geheimnis von Macht zu ergründen, sondern auch herauszufinden, welche inneren Konflikte ein Herrscher, der letzten Endes einsam ist und der in der Regel keinen Freundeskreis kennt, sondern nur Schmeichler und Feinde, zu bewältigen habe. Dieser Dialog handelte auch und besonders von der Psychologie von Macht, von den Maßnahmen und Schwierigkeiten, als Tyrann eine Art inneres Gleichgewicht zu finden und von der Verführung durch Macht, der in der Regel die Außenstehenden sowie das Volk unterliegen. - Wenn Xenophon in der „Kyrupädie“ die positiven Seiten einer Alleinherrschaft, die Charakteristika eines guten Monarchen, aber auch die Probleme, die sich aus der Organisation eines Flächenstaates ergeben, beleuchtet hatte, so orientierte er sich im „Hieron“ eher auf die Innenseite einer solchen Regentschaft; man könnte auch sagen: in diesem Dialog ging es auch um die Dialektik der Aufklärung: Der Herrscher war im Prinzip schon auf dem Wege zur Aufklärung; er brachte die besten Voraussetzungen mit. Der Weise unterstützte ihn sozusagen bei diesem Vorhaben; er lieferte die nötige Theorie, um in den Reflexionen über das Wesen der Macht und ihre Veränderungen die pragmatischen Ziele für diesen Herrscher sichtbar zu machen.
Es war schon die Rede davon, dass dieser Herrscher über Syrakus die Rolle des aufgeklärten Regenten spielte und gewissermaßen auf der anderen Seite nicht den Ton angab. So konnte eine Art von Synthese von Wissen und Macht, aber auch die dialektische Notwendigkeit, dieses Wissen in Praxis umzusetzen, angedeutet werden: Was dieser Hieron von seiner eigenen Herrschaft weiß, wie er sich der Probleme bewusst ist, richtig und das heißt: moralisch regieren zu können, das muss zur Praxis werden. Nur so – so die Botschaft des Autors – können die inneren Konflikte eines Monarchen überwunden, nur so können Verantwortung und Machtausübung in einen quasi natürlichen Einklang gebracht werden.
Dieser Ansatz wirkt idealistisch. Man könnte aber auch sagen: pragmatisch. Xenophon hat in diesem Dialog ganz realistisch auf die Risiken von Macht, auf Maßnahmen, diese abzustellen, auf die Möglichkeit, einen besseren Weg aus der Misere der Tyrannis zu finden, reflektiert. Er hat in diesem Kontext sokratische Gedanken entwickelt; in 4,8ff. tauchte im Dialog zwischen Herrscher und Weisem der zentrale Begriff des richtigen Gebrauchs von Macht und Reichtum auf. Hieron entwickelte den Gedanken, es sei für einen Privatmann einfacher, zum Glück zu finden, als für einen Herrscher. Das Viele und das Wenige, numerische Begriffe, erlangten in diesem Zusammenhang eine an den historischen Sokrates erinnernde Bedeutung: es komme nicht darauf an, Vieles zu besitzen, sondern sich dieses Besitzes richtig zu bedienen. - Das Dilemma, das Hieron in diesem Zusammenhang formulierte, lautete: der aufgeklärte Tyrann ist sich dieses Problems bewusst, er wird jedoch durch die äußeren Umstände gezwungen, so wie bisher weiter zu machen, also auf die Jagd nach materiellen Gütern zu gehen (4,11).
Für den Leser ergab sich bis zu diesem Punkt folgendes Bild: Da diskutierten zwei Personen über die Bedingungen einer Alleinherrschaft; der Herrscher gab zu erkennen, dass er permanent auf sein eigenes Geschick reflektierte. Es wurden freilich keine Botschaften verkündet, zumindest keine direkten.
Zugleich – dies zeigte sich in Kapitel 5 – wurde Tyrannis als ein Zustand begriffen, der auch noch in einem anderen Dilemma mündete: der Tyrann erkenne sehr genau, wer tapfer, weise und gerecht sei; er könne sich jedoch nicht mit diesen Personen in einer für beide Seiten fruchtbaren Weise auseinander setzen. Er sei zugleich auf diese Personen angewiesen und doch wieder nicht angewiesen. Dann wiederum müsse ein solcher Herrscher mit den Schlechten verkehren und somit etwas tun, was sowohl gegen das bessere Wissen als auch gegen die Moralität des Handelns sei (5,2).
Man kann an diesem Sachverhalt erkennen: Xenophon ging das Problem der gerechten bzw. ungerechten Herrschaft durchaus analytisch an. Sein Ausgangspunkt waren die gegebenen Verhältnisse einer Alleinherrschaft oder das, was er als solche fingierte.
Das Problem der gerechten Herrschaft avancierte in diesem Kontext auch zu einem Problem des richtigen Umgangs mit den richtigen, weil guten Menschen; auch dies war zugleich idealistisch und pragmatisch gedacht.
Der Machtbegriff, der dahinter stand, lautete: diese Macht muss immer ausgeübt und gezeigt werden. Ohne eine praktische Umsetzung ist sie wertlos. Dies war der Ansatzpunkt, von dem aus sich der Gedanke des richtigen Gebrauchs in einem an Sokrates erinnernden Sinne entwickeln ließ.
Zugleich wurde in diesem Dialog wiederholt der Charakter des Fürstenspiegels sichtbar. Werfen wir, um dies zu verdeutlichen, einen Blick auf das letzte, 11.Kapitel.
In diesem trat nun Simonides als der wahrhaft Weise auf; seine Reflexionen über den Stellenwert des Allgemeinwohls, über das ideale Verhalten eines Herrschers gegenüber der Öffentlichkeit und über die Frage, wie denn nun dieser sein Wissen in die Praxis umsetzen könne, erwiesen diesen Simonides als den Sophós, der wusste, wovon er sprach und der in diesem Schlusskapitel auch Lösungen parat hatte. Die Ausgangssituation – der weise Dichter kommt zu dem Tyrannen, um sich von diesem belehren zu lassen – schien insofern fern zu sein. Die Konstellation geriet am Ende des Dialogs sozusagen wieder ins Lot.
Das Allgemeinwohl als Maßstab des herrschaftlichen Handelns: damit war klar ausgesprochen, dass die Polis in einer gedachten Hierarchie der Interessen im Bereich des Politischen an der Spitze stehe. Simonides sprach in diesem Zusammenhang von einer „objektiven Notwendigkeit“ (11, 1), womit gemeint war, dass es Kriterien des richtigen Handelns für einen Monarchen gebe, die gleichsam unabhängig von ihm existieren. - Damit war auch angesprochen, dass es in diesem Fürstenspiegel einen zeitlosen Maßstab gebe, an den sich ein Herrscher jederzeit zu halten habe. Überspitzt formuliert: Xenophon beschrieb durch Simonides so etwas wie einen Kategorischen Imperativ.
Die Empfehlungen im Einzelnen:
1. Der Monarch muss darauf sehen, dass es der Polis möglichst gut geht.
Dieser Wert zeigt sich in einer inneren und äußeren Harmonie der Stadt, ferner in einem angemessenen Wohlstand.
2. Das Bemühen des Herrschers um das Wohlergehen der Untertanen ist als eine Art Wettkampf zu verstehen. Der Preis für die glücklichste Stadt ist der schönste.
3. Der Herrscher hat seine Arete zu zeigen. Wenn ihm dies gelingt, wird er von allen Menschen gepriesen werden.
4. Jeder Bürger einer solchen Stadt wird ein Mitstreiter des Herrschers sein.
5. Der ideale Monarch wird über freiwillige Untertanen regieren – ein Lieblingstopos Xenophons, besonders oft in der „Kyrupädie“ vorkommend.
Diese Maximen lassen sich lesen wie ein Versuch, so etwas wie eine Utopie des guten Herrschens zu beschreiben und einzugrenzen.7 Dem Leser wird nicht entgangen sein, dass nun, am Ende des Dialogs, die idealistische Überhöhung dieser Herrscherkonzeption intendiert wird. Praxisnähe und utopisches Denken gingen auf diese Weise eine seltsame Verbindung ein.
Aber auch eine Dialektik der Gedankenfolge trat nun zu Tage. Simonides entwickelte in 11,13 den Gedanken, Hieron werde sich durch das „Bereichern“ der Freunde selbst reich machen. So konnte eine kleine Freundschaftslehre, die Xenophon schon in den „Memorabilien“ entwickelt hatte, zum Vorschein kommen. Die sozusagen unauflösbare Interdependenz zwischen Herrscher und Polis wurde auch von dieser Seite deutlich.
Und da gab es noch einen Gedanken (11,14): Hieron solle die Polis für sein eigenes Haus halten, die Bürger für Gefährten, die Freunde als eigene Kinder erachten; und eine letzte Steigerung: er solle in den eigenen Kindern sein Leben sehen.
Dies bedeutet zum einen, dass Simonides das Regieren in Staat und Haus in Analogie setzte – ein Motiv, das Xenophon bereits ausführlich zu Beginn der „Kyrupädie“ behandelt hatte. Wer – so die Vorstellung – ein Haus gut lenke, der werde auch eine Stadt gut regieren können. Dieser Gedanke blieb in der politischen Philosophie des 4. Jahrhunderts nicht unwidersprochen: Aristoteles richtete sich zu Beginn der „Politik“ dezidiert gegen die Anschauung, es gebe eine Analogie zwischen der Herrschaft im Haus und einer solchen in der Polis. -
Zum zweiten sollte durch diese Hierarchisierung von Freunden, Gefährten und eigenen Kindern so etwas wie eine den Staat durchziehende Ethik des richtigen Verhaltens gegenüber den anderen, zugleich eine durchdachte Alternative zu überkommenen Strukturen · skizziert werden. Der gute Herrscher, der seine Macht richtig gebraucht, werde dafür sorgen, dass der Platz des einzelnen sozusagen neu definiert werde.
Und da war noch ein wichtiger Gedanke. Ebenfalls in 11,14 sagte Xenophon, ein Herrscher der sich so gegenüber der Polis, den Bürgern, den Freunden und seinen Kindern verhalte, solle versuchen, alle durch Wohltaten zu übertreffen. Auch hier wieder die Vorstellung eines permanenten Wettkampfs, nun freilich mit dem Konzept des Herrschers als eines Wohltäters, des Euergetes, verbunden. Diese Vorstellung hat sich im Hellenismus als sehr folgenreich erwiesen.8