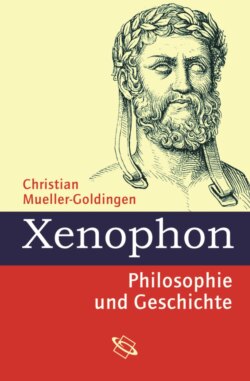Читать книгу Xenophon - Christian Müller-Goldingen - Страница 8
Einleitung
ОглавлениеIn der Forschung der letzten zwanzig Jahre ist Xenophon verstärkt in den Blick genommen worden.1 Dies hat viele Gründe. Sie sind wissenschaftshistorischer, aber auch wissenschaftsbiographischer und systematischer Art; Platon und Aristoteles, um nur die beiden herausragenden antiken Philosophen zu nennen, standen eigentlich immer im Vordergrund; dieses Phänomen gilt auch heute noch, da die Logik des Aristoteles, seine Naturphilosophie und die Eigenart Platonischen Philosophierens konstant das Zentrum des wissenschaftlichen, aber auch breiteren Interesses bilden. - A.N. Whiteheads Aperçu, die abendländische Geschichte der Philosophie sei eine einzige Fußnote zu Platon, hat in gewisser Weise auch heute noch Bestand, wenn man nicht die enorme Wirkung, die Aristoteles hat, unterschlägt.
Xenophon spielt in diesem Zusammenhang eher eine sekundäre Rolle. So sehr man seine sokratischen und allgemein philosophischen Schriften eigentlich „schon immer“ geschätzt hat, so wenig gilt er in der Regel als eine besondere Größe im weiteren Horizont der Philosophiegeschichte. - Das Platonische Sokratesbild, aber auch die sokrateskritischen Reflexionen des Aristoteles in seinen Ethiken haben dazu erheblich beigetragen.
In der Moderne hat sicherlich Bertrand Russell2 Einfluss auf dieses eher ungünstige bzw. ernüchternde Xenophonbild gehabt. Russell hat sich mit dem historischen Sokratesbild auseinander gesetzt; er hat zugleich jedoch seine Skepsis bekundet, was die Möglichkeiten einer Rekonstruktion betrifft. Russell hat andererseits aber den Versuch unternommen, diesem Xenophon Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. -
Philosophiegeschichte sollte immer zweierlei leisten: zum einen sollten Biographien sichtbar werden; zum anderen sollte in solchen Diskursen immer auch die Geschichte von philosophischen Ideen zum Vorschein kommen. Der Philosophiehistoriker könnte im Idealfall auch als Systematiker in Erscheinung treten. – Philosophiegeschichte ist potentiell und reell auch die Entwicklung von systematischen Positionen; dabei ist die Stellung der Nachwelt oft einem dialektischen Prozess unterworfen: das, was uns als neu oder weniger neu in der Geschichte der abendländischen Philosophie erscheint, wurde damals, auch in der Antike, oft nicht so empfunden; die Situation ist prinzipiell vergleichbar mit der Einteilung in Epochen. Die zeitgenössische Gesellschaft hat dementsprechende Einschnitte oft anders gesehen oder gar nicht wahrgenommen.
Philosophiegeschichte ist gleichwohl ein unersetzliches Geschäft. Sie kann imstande sein, Strukturen der jeweiligen Vergangenheit zu erkennen, sie ist aber auch in der Lage, die Interdependenzen zwischen Philosophie und Gesellschaft ins Bewusstsein zu heben.
Im folgenden sollen keine philosophiehistorischen Ansätze entwickelt werden, wenngleich vieles von dem, was über Xenophon gesagt werden wird, in diesem Sinne auch verstanden werden kann. Im Zentrum sollen jedoch andere Themen stehen, die unter einer eher wissenschaftssystematischen und auch literaturwissenschaftlichen Perspektive so behandelt werden sollen, dass Xenophon als sokratischer Philosoph, aber auch als Athener sichtbar wird.
Dieser Diskurs soll unter mehreren Prämissen verlaufen: Xenophon war, trotz seiner Verbannung, mit seiner Heimatstadt Athen eng vernetzt. Er hat sich unter anderem mit Platons Sokratesbild, aber auch mit dem Sokratesbild des Antisthenes auseinander gesetzt.
Die sokratische Philosophie reagierte äußerst sensibel auf den Prozess und Tod des Sokrates. Sie hat das Schlüsselerlebnis, den Umgang mit Sokrates, in je eigener Weise verarbeitet.
Xenophon entwickelte eine eigenständige politische Philosophie. Diese hat er zum Teil verschlüsselt. Er hat sich zum Beispiel historische Personen wie Kyros d.Gr. gewählt, um sie zu Trägern sokratischer und allgemein philosophischer Ideale zu machen.
Der Diskurs über diese politische Philosophie lässt sich auch lesen als einen Versuch, sich über die interdisziplinären Zusammenhänge zwischen Philosophie und anderen Wissenschaften Gewissheit zu verschaffen. Die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts war nicht zuletzt eine Zeit des Umbruchs; dieser hat in Xenophons Werk, zumindest teilweise, Spuren hinterlassen. Diesen Spuren soll in dem Kapitel „Sokrates und die Naturphilosophie“ nachgegangen werden. Es soll in diesem Zusammenhang deutlich werden, wie Xenophons Sokrates sich gegenüber der zeitgenössischen Naturphilosophie in Athen verhalten hat und mit welchen Argumenten er für eine Ethik plädierte, die den Menschen ins Zentrum der Betrachtung rückte. - Aus einer wissenschaftshistorischen Perspektive soll gefragt werden, wie die Debatte in Athen über wissenschaftlichen Fortschritt allgemein verlaufen ist.
Das Thema „Sokrates und die Naturphilosophie“ ordnet sich in einen größeren Zusammenhang, in „Innovation und Tradition“, ein. Diese Fragestellung bildet sozusagen den Prüfstein, wenn es darum geht, nach dem Verhältnis eines Philosophen zu Fortschritt und Bewahrung von Überlieferung im weitesten Sinne zu fragen. Es soll sich zeigen, dass Xenophon mit Traditionen in einer kritischen Weise umgegangen ist; er war ein kritischer Traditionalist.
Die Untersuchungen zu Xenophon verfolgen aber nicht nur philosophiespezifische Ziele und Fragestellungen, die die Zeit, in der dieser Autor lebte, betreffen. Sie dienen auch dazu, die Gesellschaft Athens etwas näher zu beleuchten, ihre Eigenarten, ihren Umgang mit der Philosophie und die Vernetzung dieser Philosophie mit der Gesellschaft.
Xenophon hat in dieser athenischen Gesellschaft nur zeitweise eine Rolle gespielt; sehr lange lebte er im Exil. Daraus ergaben sich Chancen: er konnte seine Heimatstadt aus der Distanz betrachten, er war ein echter Außenseiter, und er konnte aus dieser Distanz vielleicht Vieles sehen und erkennen, was den „normalen“ Bürgern Athens so nicht möglich war. - Diese eigenartige Position des Historikers und Philosophen zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk. In der späten „Kyrupädie“ kommt sie ebenso zum Ausdruck wie in den viel früheren „Memorabilien“. In den „Poroi“ lässt sich seine Liebe zu Athen besonders gut erfassen. Diese Zuneigung war freilich ebenfalls eine reflektierte. Sie endete nicht in einer unbedingten Nostalgie, und sie führte nicht dazu, dass dieser Autor die Schattenseiten der athenischen Gesellschaft ignoriert hätte.
Als ein Sokratiker war Xenophon sensibel, was den sog. gesellschaftlichen Fortschritt und die Errungenschaften des Geistes betrifft. Er war bei weitem nicht so kritisch wie Sokrates und Platon eingestellt; aber er hatte ein waches Empfinden für die Kehrseite dieses Fortschritts. Dieses führte bei ihm nicht zu einem Fortschrittspessimismus. Xenophon hat sich auch nicht, von Ausnahmen abgesehen, voll bewusst gemacht, dass er in einer Zeit des Umbruchs lebte; es fehlte ihm dazu die nötige zeitliche Distanz. Aber er hat besonders im Zusammenhang seines Herrschaftsideals Gedanken formuliert, die sich auf den kommenden Hellenismus in ausnehmender Weise auswirken sollten.3
Da steht mithin auch Xenophons Rezeption zur Debatte; die Nachwelt vom Hellenismus bis zur Spätantike (Stobaios) hat offenbar erkannt, dass Xenophons Philosophie, besonders seine politische, durchaus attraktiv war. Dieser Autor vermochte den Eindruck zu erwecken, philosophische Theoreme zu vermitteln, die in gewisser Weise zeitlos waren, die zumindest den Hellenismus antizipierten und die auch das gesamte Spannungsgeflecht, das die Jahre 400-350 gekennzeichnet hatte, gewinnbringend an andere Zeiten weitergeben konnten. – Man könnte es etwas überspitzt folgendermaßen formulieren: Dieser Xenophon hat lange Zeit in der Rezeptionsgeschichte im Schatten von Platon und Aristoteles gestanden; es brauchte seine Zeit, bis man seinen Wert erkannte und vor allem sah, dass dieser Autor viele Ideen vermittelt hatte, die durchaus originell waren.
1 Vgl. auch unten XIII. „Xenophon heute“.
2 Russell, History of Western Philosophy, 1961, 101-102.
3 Vgl. dazu unten XI. „Die hellenistische Herrschertheorie“