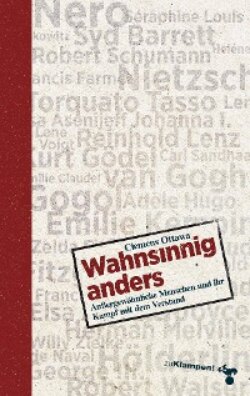Читать книгу Wahnsinnig anders - Clemens Ottawa - Страница 19
ОглавлениеCarl Sandhaas Selbstporträt
»Man hat mir nächtlicherweise die Kleider zerrissen, die Schuhsohlen aufgeschnitten, auch die Füße gebrannt, die Knöpfe vom Rock gerissen und dann mich abwechselnd wieder hungern, schmachten und darben lassen!« Carl Sandhaas, deutscher Maler
(1801 bis 1859)
Der Maler Carl Sandhaas, ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten, was sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, wie er zu Lebzeiten von der Gesellschaft behandelt und zuletzt auch ruiniert wurde. Das Zitat zu Beginn dieses Kapitels stammt vom Künstler selbst und skizziert, wie feindselig die Menschen in der Nachbarschaft auf ihn reagierten.
Sandhaas erblickte am 24. Februar 1801 im schwäbischen Stuttgart das Licht der Welt, als unehelicher Sohn der Maria Magdalena Sandhaas (1771–1828), einer einfachen Magd. Im Taufbuch der Stadt Haslach, auf einem kleinen, eingeklebten Zettelchen steht: »Karl Sandhaas ist geboren 24. Februar 1801.« – mehr auch schon nicht.
Während seiner Kindheit geriet er aufgrund seiner Vaterlosigkeit rasch zum Außenseiter, der gehänselt wurde. Der Vater blieb zwar offiziell unbekannt, es soll sich aber um den Maler Johann Baptist Seele (1774–1814) gehandelt haben, und wie er verfügte Carl über ein enormes zeichnerisches Talent, das sich schon früh herauskristallisierte. Die Mutter wurde, nachdem die Schwangerschaft bekannt wurde, unverzüglich vom Kanzlisten Hans Wölfle, bei dem sie arbeitete und der ihr auch mehrmals den Hof gemacht haben soll, entlassen. Sie unternahm daraufhin einen Selbstmordversuch und entwickelte eine Psychose – »Wahnsinn«, wie man damals praktisch jede psychische Auffälligkeit nannte. Sie war außerstande, sich angemessen um ihren Sohn zu kümmern. Sandhaas’ Kindheit verlief denn auch sehr entbehrungsreich. Er kam schließlich nach Darmstadt, in die Obhut seines Onkels Lorenz, der als Hof- und Theatermaler tätig war, das Talent des Jungen erkannte und ihn künstlerisch förderte. Sandhaas, der übrigens auch ein ausgezeichneter Musiker war, liebte es, in seinen hunderten Portraitzeichnungen Charaktergesichter, vor allem welche mit Makeln, zu fertigen. Kranke, Alte, gesellschaftlich Ausgeschlossene, das waren die Menschen, die ihn bei seiner künstlerischen Arbeit interessierten. Vermutlich auch deshalb, weil er sich mit diesen irgendwie verbunden fühlte.
In seiner neuen Heimatstadt schloss sich Sandhaas den Darmstädter »Schwarzen« an, einer radikalen Gruppierung, die eine rasche Demokratisierung in Deutschland forderte, und freundete sich mit dem Politiker Georg Gottfried Gervinus und dem Architekten und Schriftsteller Fritz Max Hessemer, der ihm Mentor und auch finanzieller Unterstützer wurde, an. Er reiste 1826 zum Studium und für die Inspiration nach Italien, das er in knapp vier Monaten zu Fuß, von Norden nach Süden durchquerte, und arbeitete danach bei Peter Cornelius in München als Freskenmaler in der Glyptothek. Einige Male fiel er in München durch Gemütsschwankungen auf, womit plötzliche Tobsuchtsanfälle mit lautem Geschrei oder plötzliche Weinkrämpfe gemeint waren. Seine Umgebung mied ihn und er sie. 1828 siedelte er nach Frankfurt über, wo sich sein Freund und Malerkollege Johann Karl Barth seiner annahm und versuchte, ihm Aufträge zuzuschanzen. Als jedoch am 31. Dezember 1828 seine Mutter verstarb, kehrte Sandhaas nach Haslach zurück. In den folgenden Jahren verdiente er vor allem durchs Portraitmalen Geld – viel war es freilich nie.
Sein wohl eindrucksvollstes Werk entstand im Laufe des Jahres 1837. Nachdem Carl Sandhaas bereits einige Male als Illustrator in Erscheinung getreten war (so gibt es etwa eine Ausgabe von Shakespeares Sommernachtstraum mit seinen Zeichnungen), engagierte ihn der Mediziner Karl Heinrich Baumgartner für das Fertigen von Tafeln, die der Arzt zur anschaulichen Demonstration benötigte. Er schuf zahlreiche Skizzen und Portraits von Kranken auf insgesamt 67 Tafeln. Es sind großartige, einfühlsame und lebensnahe kleine Bilder, die eine bemerkenswerte künstlerische Selbstständigkeit besitzen und die bewiesen, dass Sandhaas einer der besten Portraitmaler seiner Zeit war.
Was der genaue Grund seines radikalen psychischen Zusammenbruches, ab Ende der 1830er Jahre, gewesen sein kann, ist rückblickend schwer zu beurteilen. Ein möglicher Grund war die unglückliche Liebe zu einem Mädchen, Mina genannt, das tragisch und früh am Fleckfieber verstarb und ihn entrücken ließ. Ihr Tod Ende des Jahres 1837 war auch ein Hauptgrund für den selbstgewählten Eskapismus. Zuvor war die Liebesbeziehung allerdings auch durch die Familie Minas, einer Jägerstochter, heftig untergraben worden. Einmal soll er, gesichert ist dies freilich nicht, die Geburt Christi gemalt haben und das Bild dem Haslacher Stadtrat angeboten haben, der zeigte sich jedoch wenig erfreut, dass Sandhaas die Maria als Ebenbild Minas gemalt hatte.
In einer primitiven Laubhütte im Haslacher Wald lebte Sandhaas daraufhin, und dieses Eremitendasein stieß bei der Bevölkerung auf Unverständnis. Unangepasstheit und Exzentrik waren keine Dinge, die damals toleriert wurden, und Sandhaas tat dazu noch alles, um vollkommen in Verruf zu kommen. Menschen, die sich in die Nähe der Hütte verirrten, scheuchte Sandhaas schroff davon oder bedrohte sie wüst. Der Unmut gegen diesen Sonderling wuchs in der Stadtgemeinde. Als die Hütte eines Nachts abbrannte, meinten die Haslacher, Sandhaas hätte sie selbst in Flammen gesteckt, und sahen in ihm eine Gefahr für die ganze Gemeinde, und so wurde der Maler ins Haslacher »Narrenhüsle« gebracht. Ein wütender Mob soll über ihn hergefallen sein und ihn geprügelt haben. Im Zitat zu Beginn dieses Kapitel schildert Sandhaas die Ereignisse. Man hatte dem Maler die Kleider zerrissen, auch zu körperlichen Misshandlungen, wie, von ihm selbst erwähnt, dem Brennen der Fußsohlen, soll es gekommen sein. Als er, so jedenfalls will es die Überlieferung in Offenburg auch noch den Haslacher Bürgermeister gefährlich bedroht und blind vor Wut getobt haben soll, verlegte man ihn in die Nervenklinik Illenau. Ob er nun tatsächlich so gewütet hatte oder ob man einen ungeliebten Bürger einfach weg von der Straße haben wollte, bleibt unklar.
In einer Krankenakte der Heilanstalt stand, datiert mit 30. Juni 1845: »Ist etwas fleißiger, arbeitet gerne im Feld, zeichnet auch, sehnt sich sehr nach seiner Heimat.« Sandhaas wurde dabei aber auch als Mann »voller Eitelkeiten und Sonderbarkeiten« beschrieben. Er trug auch in der Anstalt seinen Anzug, ein weißes Hemd, seine Langhaarfrisur und den üppigen, recht ungepflegten Bart und zumeist schlief er lieber, als sich einer »nützlichen Arbeit« zu widmen. Am 29. Dezember 1845, nachdem er vorher von der Heilanstaltsleitung als wieder für »arbeitsfähig und krankheitseinsichtig« befunden wurde, entließ man ihn. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Sandhaas im Haslacher Spital auf Kosten der Gemeinde, was die soziale Ausgrenzung nur noch weiter vorantrieb. Die Menschen konnten und wollten es nicht verstehen, dass der »Narr« oder der »Ortsarme«, wie man Carl Sandhaas wenig schmeichelhaft nannte, für Kost und Unterkunft nichts zahlen musste. Das Personal soll ihn daher auch mehr als stiefmütterlich behandelt haben.
Er schrieb in seiner im Spital verfassten Autobiografie: »Die Leute glauben, ich soll ihnen für ein Maß Bier ein Portrait malen.« Der Kupferstecher Julius Allgeyer, einer der wenigen, die den freundschaftlichen Kontakt mit Sandhaas suchten, schrieb nach einem Besuch bei ihm 1853, Sandhaas sei »eine grenzenlos vereinsamte, aber durchaus vornehme Künstlernatur«. Nach der Zeit in der Heilanstalt hatte sich Sandhaas’ Zustand tatsächlich gebessert, eine restlose Heilung hatte es allerdings nicht gegeben. Sicherlich mag auch die so offensichtlich fehlende Empathie seiner Umgebung den sensiblen Künstler sukzessive zerstört haben.
Am 12. April 1859 starb der unangepasste Maler, für den der Großteil seines Lebens ein Kampf und Krampf geblieben war, 58-jährig in Haslach, jener Heimat, der er sich in Hassliebe verbunden gefühlt hatte. Wahrscheinlich litt der Maler an einer manisch-depressiven Erkrankung und vermutlich war diese ihm von seiner Mutter vererbt worden. Basierend auf Sandhaas’ Leben, dessen Werk aktuell seit ein paar Jahren wieder zunehmend in den Fokus des Interesses gerückt ist, schrieb der badische Heimatschriftsteller Heinrich Hansjakob 1888 die Erzählung Der närrische Maler. Hansjakob hatte Sandhaas noch persönlich gekannt, in seinem Text verschwimmen Realität und Fiktion.
In Haslach gibt es heute die Carl-Sandhaas-Schule, die sich geistig behinderter Kinder und Jugendlicher annimmt.