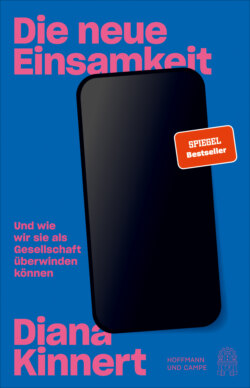Читать книгу Die neue Einsamkeit - Diana Kinnert - Страница 10
Warum wir Einsamkeit völlig neu begreifen müssen
ОглавлениеWie schön. Schon vor einigen Jahren hat das Zukunftsinstitut die Individualisierung der Welt ausgerufen. Einen Megatrend, der sich überall ausbreitet und zu einer beispiellosen Ausdifferenzierung von Lebenskonzepten, Karrieren, Marktnischen und Welterklärungsmodellen geführt hat. Immer mehr gewinnt der Mensch die Freiheit zu wählen, auszuwählen. Er kann entscheiden, wo er lebt, wie er lebt, kann entscheiden zwischen unzähligen und ständig neu hinzukommenden Berufen. Wie er seine Sexualität auslebt, wie er sich kleidet und sich präsentiert, auch hier bieten sich heute immer mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Der Freiraum, den der Einzelne inzwischen für sich beansprucht, ist weiter und größer geworden, und er fordert immer mehr Platz. Normgebende Institutionen wie Politik oder Kirche, so schreibt das Zukunftsinstitut, verlieren an Autorität. Die Antwort auf die Frage, welche Lebensweise die gute, die richtige ist, wurde derweil immer mehr in die Verantwortung des Einzelnen gelegt. Der Medienphilosoph Norbert Bolz formuliert es so: »Sinn wird zunehmend zur Privatsache.« Kollektiver Zwang weicht dem Privileg der Freiheit. Oder anders: der Zumutung der Freiheit.
Und die Individualisierung bricht sich auf vielen Ebenen Bahn. In der Ökonomie schreitet die Ausdifferenzierung der Märkte immer weiter voran, werden die Produkte am Ende der Ketten zunehmend personalisierter. Auf sozialer Ebene kann ein jeder heute über sein Leben bestimmen wie nie zuvor in der Geschichte, steht damit aber auch der Aufgabe gegenüber, wählen und sich über diesen Prozess Gedanken machen zu müssen. Die Freiheit zur Wahl geht einher mit dem Zwang zur Entscheidung.
In der überindividualisierten Gesellschaft begreift sich jeder inzwischen selbst als Handlungszentrum. Das moderne Individuum löst sich von festen sozialen Klammern, denkt nicht mehr in Klassen, Schichten, Geschlechterrollen. Vielmehr entwirft es seinen eigenen Lebenslauf, entwickelt eigene Fähigkeiten, Orientierungen, Partnerschaften. Es destilliert seine ureigenen Geschmäcker, formt seine eigene Sprache. Der Mensch wird zum Designer seiner eigenen sozialen Realität. Die Biographie wird zur Multigraphie.
Und damit sind wir nun endlich ganz im Hier und Heute gelandet. Und dürfen vergnügt feststellen: Der Mainstream ist in tausend Subkulturen zerfasert – und diese tausend Subkulturen sind gerade dabei, zum Mainstream zu werden.
Reichlich obsolet scheint es darum, auch noch immer in alten Kategorien und Schubladen der Einsamkeit zu denken. Viel sinnvoller ist es, den Zustand der Vereinzelung im Licht der neuen Zeiten zu betrachten. Die Einsamkeit – die im Laufe der Geschichte oft genug zu verschiedensten Lesarten führte – offenbart sich alsdann völlig neu. Wir begreifen sie anders, bewerten sie anders. Und können ihr auch dann erst effektiv begegnen.
Anders: Jede Einsamkeit ist ein Produkt ihrer Zeit.
Vertraute Versionen und Betrachtungsweisen sind darum hinfällig. Vor allem in Zeiten der rasenden Digitalisierung wirken altbekannte Einsamkeitsmuster wie Auslaufmodelle ihrer selbst. Ein Johann Wolfgang von Goethe ist längst zum Gestrigen geworden, die Theorie einer »Lonely Crowd« nur noch eine Fußnote in den Geschichtsbüchern.
Denn was ist geschehen? Besonders in den letzten zwei Jahrzehnten? Genauer noch im letzten Jahrzehnt, mit dessen Errungenschaften inzwischen sogar unsere Gefühle durch den digitalen Durchlauferhitzer gejagt werden?
Was geschieht im Zuge dessen wohl auch mit der Einsamkeit, wenn es in Japan inzwischen gängig geworden ist, beim Candlelight-Dinner einer sprechenden Puppe gegenüberzusitzen? Wenn, wie im Spiegel berichtet, die Cobots unaufhaltsam auf dem Vormarsch sind?
In Zeiten von Corona macht die Automatisierung gerade noch mal ordentliche Schritte nach vorn. Autonom navigierende Roboter desinfizieren neuerdings im großen Stil Kliniken, die dänische Firma Blue Ocean Robotics kommt mit der Auslieferung kaum hinterher. GoBe, UVD und PTR Robots heißen die Maschinen, darunter auch jene modernen Putzkolonnen, die Menschen in Form mannshoher, blau leuchtender Röhren ablösen und imstande sind, Krankheitserreger in einem Zimmer binnen zehn Minuten zu 99,9 Prozent zu vernichten. Serviceroboter statt Verkäufer bedienen derweil in den ersten Elektronikmärkten, auch innovative Immobilienmakler schicken inzwischen Roboter durch Wohnungen und Häuser. Potenzielle Mieter und Käufer können diese via App fernsteuern und sich die Immobilie auf diese Weise schon mal selbst anschauen. Weder sie noch der Makler sind dabei anwesend. Zumindest nicht in den vier Wänden, um die es geht.
Digitale Assistenten heißen all diese Gerätschaften, und sie verlassen zunehmend den industriellen Bereich. So langsam mischen sich die künstlichen Helferlein unters Volk – was auch den Begriff der Zwischenmenschlichkeit neu verankern dürfte.
Zu einer viel abstrakteren Vereinzelung kommt es heute auf anderer Ebene. Und ich würde hier eher von einer Verlorenheit sprechen, von einer Überforderung im Überfluss. Denn was geschieht, wenn der Mensch vor der berühmten Qual der Wahl steht? Er ist gestresst, fühlt sich auf gewisse Weise alleingelassen. Psychologische Versuche haben gezeigt, dass sich der Mensch bei der Wahl von Produkten und Angeboten nur in einem bestimmten »Fenster« wohlfühlt. Stressforscher wie Mazda Adli nennen es das »umgedrehte U der Zufriedenheit«. Dargestellt auf x- und y-Achse zeichnet sich dabei eine Parabel ab. Sie macht deutlich: Mit der wachsenden Zahl der Möglichkeiten nimmt unsere Zufriedenheit ab.
Die Ökonomen Elena Retuskaja und Robin Hogarth legten Probanden eine Auswahl von Geschenkschachteln vor: Mal fünf, mal zehn, mal fünfzehn, mal dreißig. Mit einer Wahlmöglichkeit von zehn fühlten sich die meisten am wohlsten, bei fünfzehn Schachteln nahm die Zufriedenheit bereits ab. Grund: Je größer die Menge ist, aus der wir auswählen können, desto mehr stresst uns das Risiko, nicht die beste Wahl treffen zu können.
Nun sind fünfzehn, zwanzig oder auch dreißig Schachteln ein überschaubares Beispiel. Was jedoch passiert, wenn wir im Supermarkt vor 50 Joghurtsorten stehen, in der Stadt zwischen 70 Bars und im Reisebüro zwischen 100 All-Inclusive-Clubs wählen können? Und das alles ist noch klein-klein gedacht. Denn wie reagieren unsere Synapsen erst, wenn wir uns im Internet durch Hunderttausende Angebote klicken? Lampen, Hosen, Dichtungen, Glühlampen: Von A bis Z ist heutzutage alles in unendlicher Zahl zu haben, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.
Was, wenn wir uns danach im Dschungel der Apps umtun? Wenn wir uns heute unzählige Applikationen aufs Handy beamen können, die jahrzehntealte Einrichtungen, Instrumentarien und auch Rituale im Handumdrehen ersetzen: das Reisebüro, den Bahnschalter, den Bankbesuch, den Wetterbericht, den Taschenrechner, die Fotokamera, den Radiosender, die Straßenkarte, die Zeitung, das Spiel, den Pulsmesser. Ganze Welten stehen uns heute im Hosentaschenformat zu Verfügung, abrufbar in Millionenzahl, downzuloaden in nicht mehr bezifferbarer Menge.
Und was geschieht ferner, wenn wir auf Diensten wie Tinder im Sekundentakt über nicht endende Bilderserien wischen können? Über Endlosgalerien aus Gesichtern und Kurzprofilen, die sogar die Auswahl an Menschen selbst ins Unüberschaubare potenziert haben?
Wenn Psychologen schon ab fünfzehn Geschenkschachteln von einer zunehmenden Qual der Wahl sprechen – müsste im heutigen Infinitum der Möglichkeiten nicht längst von einer Pein der Beliebigkeit die Rede sein? Von einer Ohnmacht im Zeitalter des Übermaßes? Mithin von einer Überforderung und lostness, die längst auch zu einer ganz neuen und viel abstrakteren Erscheinungsform von Einsamkeit geführt hat?
Denn einsam ist der Mensch nicht nur unter Menschen. Er wird es irgendwann auch unter einer Überdosis der Reize.
Laut Beobachtungen von Fachleuten wie etwa dem Bonner Kinderpsychiater Michael Winterhoff hat die digitale Überflutung bereits zu einer kollektiven Schädigung der Psyche geführt. In seiner Praxis erlebe er schon seit Mitte der neunziger Jahre, dass sich immer mehr Kinder nicht mehr altersgerecht entwickeln. Und diese Veränderung sei inzwischen auch bei den Erwachsenen angekommen.
Die Menschen fühlen sich überfordert. Der Wechsel von der analogen in die digitale Welt hat das Leben extrem beschleunigt, mit Reizen und Informationen regelrecht überfrachtet. Das Gefühl, ständig unter Strom zu stehen, ist dabei zu einem unterschwelligen Dauerzustand geworden. Der Psychiater Winterhoff führt dies wesentlich auf die pausenlose und flächendeckende mediale Belieferung auf allen Kanälen zurück, die durch das Smartphone auf die Spitze getrieben wird.
Der Mensch lenkt sich durch diesen Dauerbeschuss am Ende von sich selbst ab, sagen Psychologen. Die Einheit von Körper, Seele und Geist wird gestört. Ursache und Symptom gleichermaßen: Denken und Fühlen klaffen auseinander, die sinnliche Verarbeitung der Umwelt scheitert zunehmend. Des Weiteren: Lernprozesse sind nicht mehr mit haptischen, körperlichen und sinnlichen Erfahrungen verknüpft, vermeintliche Belohnungen dafür ohne jede Anstrengung, ohne Kompromiss und Reflektion zu haben.
Zu was mag das führen? Schwindet da womöglich sogar die innigste Form der Zweisamkeit? Findet der Mensch nicht mehr zu sich selbst, wie man so schön sagt?
Nun, dass er sich zumindest von seiner Umwelt systematisch und massenhaft abschottet, müssen Studien gar nicht erst zeigen. Die Indizien dafür sind überall zu sehen: Auf den Straßen, in den U-Bahnen, an den Flughäfen. EarPods sind zur Grundausstattung geworden wie die Unterhose und zugleich zum ostentativen Schmuckstück der kollektiven Abgrenzung. Kabellose Abkapslungs-Gadgets, die es deutlicher kaum sagen könnten: Lass mich in Ruhe. Kontakt unerwünscht. Hier bin ich, ihr seid dort.
Wie würde ein Edward Hopper diesen Menschen heute wohl malen? Vielleicht würde er ihn zerstückeln. In Bits, in Atome. Vielleicht würde er ihn inzwischen auch einfach weglassen. Eine letzte Steigerung der Vereinzelung. Das Verschwinden.
Allemal klar ist, dass wir unser generelles Verständnis von Einsamkeit radikal updaten müssen. Denn so schnell wie wohl nie zuvor modifizieren die technologischen Innovationen gerade unseren Alltag und greifen in grundlegende Parameter unseres Lebens ein. Dabei treffen auch unsere Emotionen auf völlig neue Koordinatensysteme, und es stellt sich die Frage, ob sie schnell genug mitkommen. Ein weiteres Beispiel verdeutlicht das.
Lange war das zugängliche Weltwissen äußerst überschaubar. Laut Schätzungen brauchte es von 1400 bis 1900 gut und gern 500 Jahre, bis sich die Menge an menschlichem Wissen gerade einmal verdoppelte. Dichter und Denker, Philosophen und Gelehrte konnten guten Gewissens behaupten, so ziemlich alle wichtigen Werke zu kennen und sich mit den grundlegenden Theorien in den jeweils aktuellen Wissensgebieten befasst zu haben. Was nicht heißt, dass alle Menschen gleich viel wussten. Lange hatten die Gelehrten ihr Wissen geflissentlich für sich behalten, und vor Luther taten Priester und Mönche einen Teufel, das hehre Wissen aus den Büchern mit der Allgemeinheit zu teilen.
Bis ins 20. Jahrhundert wuchs das Wissen, befördert durch den Buchdruck, schließlich stetig weiter an, war inzwischen für mehr Menschen zugänglich und nun bereits deutlich schneller. Das dem Menschen zur Verfügung stehende Gedankengut verdoppelte sich abermals: Von 1900 bis 1950 nunmehr allerdings in 50, von 1950 bis 1970 in nur noch 20 Jahren. Bis in die neunziger Jahre kamen aus vielen Bereichen immer mehr Mengen an Wissen hinzu, allerdings noch immer auf überschaubare Weise. Bildungsbürger kauften Bücher, besuchten Vorlesungen und Bibliotheken. Es gab Gebildete und weniger Gebildete, wie schon immer, aber doch lebte jeder mit dem beruhigenden Gefühl, dass es eine Art Grundausstattung an Wissen gab, mit der man halbwegs anständig durchs Leben kam. Um sich aktuell zu informieren, las man Zeitungen und Magazine, schaute abends die Nachrichten.
Noch 1999 veröffentlichte der Hamburger Literaturprofessor Dietrich Schwanitz das Buch Bildung. Alles, was man wissen muss. Ein gut verdaulich dargebotener Rundgang durch Geschichte, Philosophie, Literatur, Kunst und Musik, nach dem sich der Leser wissend genug fühlen durfte, um Historie und Gegenwart einzuordnen, Zusammenhänge zu verstehen und die Zukunft denkend mitzugestalten. Dieses Wissen bildete eine solide Grundlage, zudem existierte der sogenannte Bildungskanon: jener Wissensfundus, den eine Kultur für wichtig erachtet, damit eine Gesellschaft gemeinsam funktioniert. Das geht schon in der Schule los: Mit Lesen, Mathe und einer ersten Portion Sachkunde in verschiedenen Gebieten.
So weit, so gut. Doch nun ging die Post ab.
Mit Beginn des 21. Jahrhunderts verdoppelte sich die Menge an Wissen abermals, inzwischen in nur noch drei Jahren, wie das McKinsey Global Institute ermittelte. Doch es geschah dabei nun noch etwas: Die qualitative Vorstellung von Wissen wurde zunehmend durch die quantitativen Konzepte der Nachrichten, Informationen und Daten ersetzt. Und diese Nachrichten, Informationen und Daten vervielfachten sich immer schneller. Und sie tun dies bis heute, inzwischen in viralem Tempo. Das Wissen an sich hat sich also verändert.
Der Rest ist Geschichte. Eine Geschichte wohlgemerkt, der wir im Moment ihres Entstehens schon nicht mehr hinterherkommen. Das ist im Prinzip nichts Neues. Neu aber sind die tatsächlichen Geschwindigkeiten und Massen, mit denen gerade jenes neue »Wissen« produziert und auch ausgetauscht wird.
Früher sagte man noch: Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Es klingt heute geradezu possenhaft. Längst müssten wir sagen: Nichts ist älter als die News von vor zwei Minuten, der Tweet der letzten Sekunde. In den USA kam es schon vor Jahren zu einer Formulierung, mit der man der Informationsflut beikommen wollte: Breaking News. Neueste Nachrichten, die hindurchbrechen durch die, die gerade noch aktuell gewesen sind. Und auch dies ist längst kalter Kaffee.
Inmitten dieses Wirbelwinds sind heute auch Lexika allseits und online mit einem Fingerwisch abrufbar, generieren und schreiben sich durch die User selbst fort. Es existieren Datenbanken, Mediatheken, Streams und Podcasts, im Netz steigen Webinars und Coachings, es tummeln sich dort Udemys und ganze Plattfomen, um die Zahl der weltweiten Online-Kurse überhaupt noch irgendwie zu bündeln.
Kurz: Das Wissen zischt nur noch so durch die Weltgeschichte, es multipliziert sich mit sich selbst, und dabei hat sich auch seine Lesart maßgeblich verändert. Vor allem der auf Effizienz und Profit gedrillte Begriff der Datenmenge ist zur himmlischen Größe angeschwollen, und immer wieder stehen wir kurz davor, das Zeitalter der KI, der Künstlichen Intelligenz, zu verkünden. Big Data macht es möglich, und in Bälde werden Quantencomputer es sehr wahrscheinlich Wirklichkeit werden lassen.
Sicher müsste man die Kategorien erst einmal definieren und scharf voneinander trennen: Wissen und Bildung, Nachrichten, Informationen, Daten. Was ist genau gemeint? Beginnt Bildung bei Sokrates, hört Wissen bei der jüngsten Veröffentlichung zur T-Zellen-Forschung auf? Muss einer Kant gelesen haben, um schlau zu sein? Oder ist er heute schlauer, weil er sich mit den neuesten Technologien in Sachen Klimaschutz auskennt?
Fest steht in jedem Fall, dass jene romantischen Zeiten vorbei sind, in denen wir einen Wissensfundus als etwas halbwegs Konstantes begreifen und im besten Fall mit möglichst vielen teilen konnten. Die Idee eines umfassenden Wissens- und Bildungskanons hat sich schlicht überholt. Das Problem: Vor allem aktuelles Wissen hat sich selbst schon wieder tausendmal upgedatet, während wir noch begriffsstutzig an seinem jüngsten Kapitel kauen. Und was sich abstrakt anhören mag, schlägt sich im Alltag längst konkret nieder.
Davon sind auch Entscheidungsträger nicht ausgenommen. Im Gespräch mit einem Abgeordneten fiel die Frage nach Entscheidungsvorbereitung. Er sagte: »Ich kann gar nicht mehr alles lesen, was ich lesen müsste, um auch nur halbwegs richtig liegen zu können.«
In diesem ganzen Sturm aus altem und neuem Wissen, in dieser Flut aus verfügbaren Bildungsbruchstücken, abrufbaren und ständig neu hinzukommenden Informationshäppchen geschieht nun etwas Wesentliches: Die Schnittmengen an geteiltem Wissen (wie auch immer wir es definieren) werden notgedrungen immer kleiner. Ein »Kanon« ist von einer Person längst nicht mehr zu bewältigen. Es müssen stattdessen, wie der Journalist Ulf Poschardt in Mündig schreibt, »Nutzungs- und Bewältigungsstrukturen konstruiert werden«, die die neuen Wissensmengen sichtbarer, lesbarer und überhaupt erst begreifbar machen.
Fast liest es sich wie eine Illusion. Denn viele haben längst aufgegeben, sich noch ein Quantum an Wissen anzueignen, das einst als umfassend oder gar flächendeckend gelten konnte. Es fehlt die Zeit, die Übersicht. Es fehlt das Gefühl der Machbarkeit.
Die klassischen Medien – Zeitungen, Magazine, Radio, Fernsehen – sind darum längst mehr zu (Vor-)Sortierern und Ratgebern geworden, als sich noch in ihrer alten Rolle als Aufklärer und Säulen der Meinungsbildung behaupten zu können. Im Zeitalter der metastasierten Wissensverbreitung und des Informationsbeschusses testen sie mehr, geben Tipps und müssen schnelle Überblicke verschaffen, anstatt Hintergründe zu durchleuchten, Zusammenhänge aufzuzeigen oder gar so etwas Verrücktes zu tun wie zu denken und zu philosophieren (im alten Griechenland war das noch demokratisch gelebter Straßenalltag).
Nicht umsonst ist das Infotainment zum weitverbreiteten Modus der Wissensvermittlung geworden: Informationen, Nachrichten und Wissen so leicht und flott, so bekömmlich und unterhaltsam präsentieren, dass der Zuschauer, Hörer oder Leser überhaupt noch die Bereitschaft entwickelt, bei der Stange zu bleiben. Dabei ist vom Zuschauer, Hörer oder Leser kaum mehr die Rede. Die Rezipienten sind zu Medienkonsumenten geworden, die durchs Zeitgeschehen streunen wie über einen rammelvollen Marktplatz. Obendrein haben sie sich längst selbst zu öffentlichen Stimmen befördert. Auf Homepages, in Foren, Kommentaren und sozialen Medien ist heute so ziemlich jeder Publizist.
Um sich in dieser Gemengelage noch ein Gesamtbild zu verschaffen und sich darüber hinaus zu orientieren, sind heute ein enormer Lern- und Lesewille sowie die Kunst des Selektierens gefragt; dies neben dem Zwang, sich gleichzeitig immer stärker spezialisieren zu müssen, um vor allem im Beruf auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Ärzte, Piloten, Ingenieure, Architekten, Stadtplaner, aber auch Unternehmer, Manager und Politiker, sie alle können ein Lied davon singen. Oft haben sie mehr damit zu tun, dem aktuellen Stand neuer Entwicklungen und Technologien hinterherzuhecheln als damit, ihren eigentlichen Beruf auszuüben. Zu eng sind die Welten in vielen Bereichen inzwischen miteinander verflochten. Im Großen und Ganzen ergibt sich ein heiteres Szenario: Mal skeptischer, mal euphorischer und mal besinnungsloser steht der Mensch aus Fleisch und Blut dem expandierenden, vorrangig aus Bits und Bytes geformten Informationsinput gegenüber – in den seltensten Fällen allerdings noch wirklich wissend.
Eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts YouGov hat gezeigt, dass kaum jemand hierzulande neue digitale Technologien wie Big Data, Blockchain oder Immersive Media erklären kann, weder oberflächlich noch tiefgreifend. Auch Technologien, die immerhin vom Namen her geläufig waren, konnten 34 Prozent der Studienteilnehmer gar nicht und 44 Prozent nur noch oberflächlich erklären. Im Durchschnitt wussten nur noch 19 Prozent Bescheid. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Wissenslücken deutlich überwiegen, fehlendes Wissen und Skepsis zudem eng zusammenhängen. Nach dem Motto: Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Insgesamt müssten wir im Vergleich zu früher aber wohl weniger von Wissenslücken sprechen, auch nicht so sehr von einer zunehmenden Bildungsschere, sondern von einer Zerfaserung ganz anderer Art. Denn die Menschen tummeln sich mehr und mehr auf einzelnen Wissensinseln, leben in ihren eigenen dynamischen Bildungsblasen. Das eine Weltwissen gibt es nicht mehr. Es ist kaum mehr katalogisierbar, nicht mehr quantifizierbar und schon gar nicht mehr greifbar. Wir selbst sind quasi zu Computern geworden: zu einzelnen Abrufstellen, die an jenen Servern hängen, in deren Datenmeeren sich der Krake unermüdlich klont.
Immerhin: Wissen gibt es heute auf Abruf. Wir googeln es einfach. Gut oder schlecht? Um eine Bewertung in diesem Sinne geht es mir hier nicht. Wohl aber um eine Fragestellung, die inzwischen womöglich mehr Tragweite besitzt. Denn wie kommen wir alle in Zukunft miteinander klar, wenn uns eine Basis gemeinsamen Wissens abhandenkommt? Wenn der eine dies weiß, der andere das? Wenn der Nächste dies gelesen, der Übernächste etwas ganz anderes vernommen, gelernt und verinnerlicht hat? Wenn die Schere die Gesellschaft längst nicht mehr nur in Gebildete und Ungebildete zerschneidet, sondern uns die digitale Zäsur auch hier in tausend Parzellen zerlegt?
Und auch Lesarten und Deutungen, das neumoderne Framing von Information, klaffen auseinander. Dass Flüchtlingsaktivisten und Rechtspopulisten dieselben News vollkommen verschieden lesen, ist nicht mehr nur ein Informationsfehler. Donald Trump machte es vor. Die absolute Sprechunfähigkeit zwischen gesellschaftlichen Lagern. Und das ist die Grundvoraussetzung für Spaltung. Und dafür, gespalten zu bleiben.
Die Idee eines von vielen geteilten Wissens, das Konzept eines von ebenfalls möglichst vielen akzeptierten Bildungskanons war lange die Basis für eine funktionierende Gesellschaft. Bei aller Gegensätzlichkeit, bei aller Meinungsvielfalt, bei allen möglichen Bildungsniveaus und Wissensständen: Es gab doch immer den einen großen Pool, in dem alle herumschwammen.
Dieser Pool aber versickert gerade. In unzähligen kleinen Flüssen, Rinnsalen und Tröpfchen fließt er davon.
Ob noch von einer Einsamkeit oder Vereinsamung zu sprechen ist, wenn immer mehr Menschen in ihren Wissensclouds dahindriften, dürfte eine Frage des subjektiven Empfindens sein. Vielleicht wird es sich anfühlen wie in einem Land, in dem jeder seine eigene Muttersprache spricht. Von einer weiterführenden Form der Vereinzelung aber muss unbedingt die Rede sein.
Denn so sehr geteiltes Wissen uns eint, so sehr trennt uns seine Zersprengung.
Die Zeichen sind längst da. In einer Welt des immer komplexer werdenden Wissens ist die Tendenz zu einer vorschnellen und gefährlichen Simplifizierung vielerorts zu vernehmen: Schwarzweißmalerei anstelle eines weitaus fordernderen Verständnisses der Zwischentöne und Graustufen. Auch haben sich durch den immer feiner zergliederten Wissensstand bereits immer mehr Meinungsinseln gebildet. Zunehmend entferntere Erkenntnisbiotope, immer entlegenere Auslegungsgruppierungen. Und je größer das Angebot, desto schriller der Jahrmarkt. Die Vielzahl der Verschwörungserzählungen ist ein weiteres Indiz. Die Vielzahl der Märchen und die Vielzahl derer, die an sie glauben. Und auch an diesen Begriff haben wir uns längst gewöhnt: Fake News. Derart gedeihen und vermehren können sie sich wohl nur, wenn ihnen kein einhelliges, profundes Wissen entgegengesetzt wird.
So sind wir auf einer weiteren Stufe der Vereinzelung angelangt: der Uneinigkeit durch unüberschaubar gewordenes Wissen.
Das Phänomen zeigt sich in Schemen, an die wir uns noch nicht gewöhnt haben. Es liegt weit entfernt von jenen Facetten der Einsamkeit, die Kunst und Kultur uns einst erklärten, die heute aber höchstens noch als vergangene Stereotypen durchgehen können. Das wundersame Gefühl der neuen Einsamkeit kennt andere Dimensionen. Eine moderne Lostness, die sich anders und auch an anderen Stellen manifestieren wird.
Grund zum Schwarzsehen ist das noch nicht. Doch sollten wir auf dem Quivive sein. Denn wieder wird es um die Membranen gehen, die neuartig Getrenntes eben auch neuartig miteinander verbinden könnten. Es wird um neue Sensoriken gehen müssen, um neue Wege und Visionen, Zerteiltes wieder zu verlinken und den Pool ganz anders zu denken. Eines werden wir dabei kaum abwenden können. Die moderne Gesellschaft zerfällt gerade in zahllose Teilgesellschaften, implodiert in unterschiedlichste Milieus und Individualisierungsmuster.
Die Art des Funkkontakts wird darum eine entscheidende Rolle spielen. Und warum nicht ein bisschen spinnen, ein wenig traumtanzen? Warum nicht an die Möglichkeiten der Superposition glauben, sich die Fähigkeiten der Verschränkung vorstellen? Neue Wege des Miteinanders ersinnen, völlig neue Muster des Gemeinwesens proben? In der Quantenphysik ist man längst so weit. Das vereinzelte Element hat dort bereits eine phantastische Eigenschaft erlernt. Das Bit ist zum Qubit geworden. Es kann nicht mehr nur 0 oder 1 sein, sondern inzwischen beide Zustände gleichzeitig annehmen.
Auf den Menschen bezogen könnte dies nichts Geringeres bedeuten, als sich in andere hineinzuversetzen. Das Wunder wahrer Empathie. Anteilnahme. Verständnis!