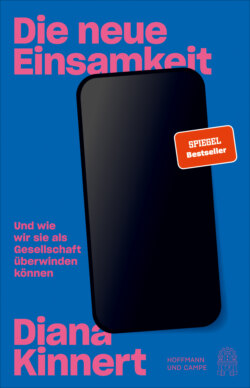Читать книгу Die neue Einsamkeit - Diana Kinnert - Страница 11
Von politischen Maßnahmen zur Enttabuisierung
ОглавлениеDie Frage, wie wir Einsamkeit begreifen und ob wir sie überhaupt definieren können, muss heute zwangsläufig zu völlig neuen Einsichten führen. Und allein diese Erkenntnis ist viel wert, auch in Deutschland hat sie bereits etwas bewirkt. Die neue Einsamkeit ist auch bei uns als gesellschaftliche Herausforderung wahrgenommen worden, der es zu begegnen gilt. Inzwischen steht es im Koalitionsvertrag: »Angesichts einer zunehmend individualisierten, mobilen und digitalen Gesellschaft werden wir Strategien und Konzepte entwickeln, der Einsamkeit in allen Altersgruppen vorbeugen und Vereinsamung bekämpfen.«
Eine Anfrage der FDP im Frühjahr des Jahres 2020 ergab, dass die Zahl der unter Einsamkeit Leidenden im Land unter den 45- bis 84-Jährigen zwischen 2011 und 2017 um 15 Prozent zugenommen hat, in einzelnen Altersgruppen sogar noch deutlich mehr.
Solchen Zahlen aber müssen weitere Überlegungen folgen. Denn die Frage ist nicht nur, wie man Einsamkeit betrachtet, bewertet und bemisst, sondern auch: Woher kommt sie? Ab wann ist ein Mensch einsam? Wie äußert sich die neue Einsamkeit im Detail und in den einzelnen Milieus? Gibt es Warnzeichen, auf die wir reagieren können? Des Weiteren: Wie und in welcher Weise machen uns die neuen Formen der Vereinzelung krank? Und vor welchen Fragen stehen wir, wenn wir die globale Gesellschaft betrachten?
Gut acht Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde, allein letztes Jahr sind 80 Millionen dazugekommen. Was geschieht, wenn nun ein vermeintlicher Widerspruch zur Regel wird – und der Mensch sich einsamer und isolierter fühlt, je voller es auf dem Planeten wird? Und die Einsamkeit epidemische Ausmaße annimmt?
Dass das Phänomen auch in Deutschland immer dringlicher wird und politische Maßnahmen fordert, belegen weitere Zahlen. Unter den 15 Prozent der Deutschen, die sich laut Umfragen einsam fühlen, sind immer mehr jüngere Menschen. Laut einer Studie des Robert Koch-Instituts zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland geben bereits 4,2 Prozent der 11- bis 17-Jährigen an, sich einsam zu fühlen. Auch Infratest Dimap hat im März 2018 im Rahmen des Deutschland-Trends eine repräsentative Auswahl von Bundesbürgern zum Thema befragt: Demnach sagen fast 70 Prozent der Befragten, dass Einsamkeit ein »großes« oder gar »sehr großes« Problem in Deutschland sei. Darunter etwas mehr Frauen als Männer, etwas mehr Ostdeutsche als Westdeutsche und etwas mehr Mittelalte (50 bis 64 Jahre) als höher Betagte oder Jüngere.
Wenn man jedoch fragt, ob sich die Politik um Einsamkeit kümmern sollte, sagen fast 60 Prozent: Nein. Einsamkeit sei schließlich ein persönliches Problem.
Aber ist es das wirklich? Der US-Soziologe Robert Putnam hat in seinem bereits 2000 veröffentlichten Buch Bowling Alone den Niedergang der amerikanischen Zivilgesellschaft beschrieben und für seine Thesen gute Gründe. Er wertete über 500000 Interviews aus einem Zeitraum von 25 Jahren aus und macht für die düsteren Aussichten insbesondere den Trend zur Vereinzelung in den USA verantwortlich. Und wenn er und andere Experten auch nur im Ansatz recht haben, ist die Politik sogar zwingend gefordert. Weil die Einsamkeit dann kein persönliches Problem mehr ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches Dilemma.
Einen weiteren entscheidenden Schritt, um dem Phänomen des kollektiv verbreiteten Ausschlussgefühls beizukommen, kann schließlich nur die Gesellschaft selbst machen: nämlich die Einsamkeit nicht länger zu verstecken und sie von ihrem enormen Stigma zu befreien. Denn genau hier liegt ein Kern des Problems.
Der Psychiater und Psychotherapeut Mazda Adli hat festgestellt, dass Einsamkeit zu den größten Tabus gehört, die ihm während seiner täglichen Arbeit mit den Patienten begegnen. Und oft können wir das selbst beobachten.
Sichtbare Einsamkeit ist uns unglaublich peinlich. Allein zu sein – im Restaurant, auf Reisen, auf Einladungen –, das passt auf Dauer nicht in unsere Vorstellung von sozialer Kompetenz. Selbst beim Psychiater fällt es den meisten Menschen äußerst schwer, diesen Satz zu sagen: Ich bin einsam. Während viele Menschen in den letzten Jahrzehnten immer offener über Depression oder Angst sprechen, wird die Einsamkeit nach wie vor eisern verschwiegen. Einsam zu sein, wird von vielen gleichgesetzt mit sozialem Versagen maximalen Ausmaßes. Mit einem Defizit, das eng an die eigene Persönlichkeit geknüpft ist und das Selbstwertgefühl ins Bodenlose fallen lässt. Und auch hierfür gibt es einen Grund. Er sitzt tief und sollte Teil der Aufklärung sein.
Biologisch nämlich sind wir so gestrickt, dass wir stets die Stabilisierung unseres sozialen Status anstreben, während der Statusverlust mit Stress und Frustration beantwortet wird. Überließen wir uns komplett den Instinkten, würden wir leider so ticken, ausschließlich die Nähe von sozial erfolgreichen Menschen zu suchen, wodurch wir uns die Stabilisierung unseres Status erhoffen würden. Den Umgang mit sozial erfolglosen oder sogar ausgeschlossenen Mitmenschen würden wir hingegen tunlichst meiden, weil wir Angst hätten, dadurch Nachteile zu haben. Am Ende ist es also die Biologie, die uns das Thema evolutionsbedingt verhagelt. Was umso mehr unterstreicht, dass wir uns gezielt damit auseinandersetzen müssen – ebenso sehr wie mit Infektionskrankheiten, mit Armut oder Hunger.
Was wir brauchen, ist ein viel stärkeres Bewusstsein dafür, dass Einsamkeit viele Menschen um uns herum tatsächlich betrifft. Das Thema muss besprechbar werden. Es muss raus aus der Tabuzone. Es muss rauf auf die Agenda nationaler wie internationaler Herausforderungen. Dies wäre ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung moderner Gesellschaften. Ein großer Schritt, der im Kleinen beginnt. Wie sagen die Tuareg?
»Einsamkeit ist nicht traurig, sobald sie beachtet wird.«