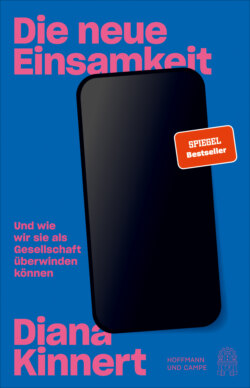Читать книгу Die neue Einsamkeit - Diana Kinnert - Страница 8
Einsamkeit in Psychologie und Medizin
ОглавлениеDie Kunst geht ihre eigenen Wege, um das Thema der Einsamkeit aufzugreifen und zu beschreiben. Musik, Malerei und Literatur sprechen das emotionale Zentrum an. Mit Symbolen, rhetorischen Abstraktionen und im wahrsten Sinne des Wortes eindringlichen Melodien bewegen und berühren sie. Und treffen manchmal sprichwörtlich mitten ins Herz.
Wissenschaftliche Fachbereiche allerdings können solche Betrachtungsweisen kaum zufriedenstellen. Sie müssen sich sachlich mit dem Thema auseinandersetzen, brauchen eine Methodik, die empirische und überprüfbare Aussagen liefert. Und obwohl das zerstreute Gefühl der Einsamkeit so schwer zu packen ist, haben verschiedene Fachgebiete dennoch versucht, den Begriff der Einsamkeit zu erörtern und ihn präziser zu definieren. Wagen wir also auch hier einen kleinen Rundgang.
Der Stressforscher und Psychiater Mazda Adli zum Beispiel traut sich über die Ursachen an das Problem heran. »Einsamkeit«, schreibt er, »entsteht dann, wenn es eine Diskrepanz zwischen dem persönlich erwünschten und dem tatsächlichen Grad sozialer Eingebundenheit gibt.« Einsam ist man also dann, wenn man das Gefühl von Isoliertheit und Unzugehörigkeit verspürt. Ein Gefühl der Absenz, von Menschen, die einem entweder helfen, die einen mögen und mit denen man Zeit verbringen kann. Einsamkeit wird dann zum Seelenschmerz. Ein Gefühl, so Adli weiter, das sich von Mensch zu Mensch zwar erheblich unterscheiden kann, jedoch stets eine Unterform von Stress ist, genauer gesagt: von sozialem Stress.
Psychologen reden dabei von einer Stressform, die unmittelbar verknüpft ist mit dem Zusammenleben und der Interaktion zwischen den Menschen (und entsprechend auch dem Fehlen von beidem). Und dieser soziale Faktor gilt in der Stressforschung als der stärkste Stressor, den man kennt. Das betrifft besonders die soziale Isolation, deren subjektive Seite das Gefühl der Einsamkeit ist.
In der Psychologie wurde dann gefragt: Was sind die eigentlichen Auslöser für die soziale Isolation, wenn wir dies einmal präzisieren wollen? Nun, sie entsteht durch den Mangel an Kontakten, durch das Fehlen von Unterstützung und Verbundenheit zu anderen Menschen oder auch durch aktiven sozialen Ausschluss. Dabei ist eines beachtenswert: Denn allein die drohende Ausschlusserfahrung oder schon die drohende soziale Entwertung gehören zu den drastischsten Stresseinwirkungen, die wir überhaupt kennen. Aus der Experimentalpsychologie weiß man, dass diese Form von sozialem Stress unsere Stresshormone am verlässlichsten aktiviert, was sich anhand der Ausschüttung des Stresshormons Cortisol präzise messen lässt. Unser Organismus wird dabei regelrecht in Alarmbereitschaft versetzt, wobei dies sozusagen der biologische Prozess hinter der subjektiv empfundenen Einsamkeit ist. Wie krass derart sozialer Stress tatsächlich auf uns wirken kann, wissen wir von praktizierten Torturen: Wenn die soziale Isolation bis über die Schmerzgrenze getrieben und als brutales Mittel von Haft und Folter eingesetzt wird.
Einsamkeit als etwas Schmerzähnliches überhaupt empfinden zu können, ist jedoch grundsätzlich sehr wichtig. Das Gefühl nämlich macht uns erst zu sozialen Wesen, dient gleichzeitig aber auch als biologisches Alarmsignal – von der Evolution weise als solches eingerichtet. Denn empfundene Einsamkeit zeigt uns auch an, wenn die soziale Unterstützung, die wir brauchen, quasi unter einen kritischen Grenzwert fällt. So muss es schon dem archaischen Urmensch ergangen sein: Beim Kampf ums Überleben spürte er instinktiv, dass er im Nachteil war, wenn er nicht mehr in ausreichender Weise am Kooperationssystem der Sippe teilhatte.
Im Prinzip ist dies heute nicht anders. Einfach gesagt: Gemeinsam sind wir stark, allein können wir nur verlieren.
Das Gefühl von Einsamkeit ist also auch ein biologisches Mangelsignal und unter den Menschen so unterschiedlich ausgeprägt wie etwa das Hungergefühl. Interessanterweise werden durch Einsamkeits- und Ausschlusserfahrungen in erster Linie eben jene Hirnregionen wie etwa der präfrontale Kortex aktiviert, die auch von Schmerzreizen getriggert werden.
Paradoxerweise müssen wir allerdings tatsächlich andere Menschen um uns herum haben, um uns einsam fühlen zu können. Einsamkeit ist Folge einer Differenz: Nur wenn es überhaupt eine Gruppe gibt, und ein Mensch den Eindruck hat, nicht zu dieser Gruppe zu gehören, kann das Gefühl von Einsamkeit aufkeimen. Erich Kästner beschreibt es in seinem Gedicht »Kleines Solo« von 1947 so: »Einsam bist du sehr alleine – und am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit.«
Hier liegt nun auch der elementare Unterschied zum Alleinsein. Wenn wir ohne jemand anderen über die Felder oder durch den Wald spazieren, fühlen wir uns in der Regel nicht einsam, sondern genießen es wahrscheinlich sogar. In diesem Fall ist Alleinsein Luxus. Die soziale Einsamkeit hingegen entsteht immer im Bezug zu anderen Menschen – und ihren giftigen Stachel erhält sie am Ende vor allem dadurch, dass wir das Gefühl haben, diesen Zustand nicht ohne weiteres aus eigener Kraft verändern zu können.
Aus sozialpsychologischer Sicht ist dies eine zentrale Erkenntnis. Allerdings auch eine Tatsache, die zu einer der häufigsten Fehlannahmen führt, wenn es um Einsamkeit geht: Nämlich, dass vor allem alte Menschen von ihr betroffen sind.
Das jedoch ist grundfalsch. Vielmehr gibt es relevante Altersgipfel, die wir bereits in früheren Lebensabschnitten erleben. Die Arbeiten von Maike Luhmann von der Ruhr-Universität Bochum, die auf Auswertungen des sozioökonomischen Panels in Deutschland beruhen, zeigen, dass der erste große Altersgipfel etwa mit 30 Jahren erreicht wird. Einen zweiten etwas kleineren Peak gibt es mit 60. Anders als vermutet, nehmen die Einsamkeitswerte bei Menschen mit 75 hingegen nur minimal zu, um dann jenseits der 80 allerdings relativ steil wieder anzusteigen.
Die Gründe für Einsamkeit unterscheiden sich dabei je nach Lebensalter. Im hohen Alter liegt es vor allem oft am Verlust des Lebenspartners sowie an gesundheitlichen Einschränkungen, dass die Menschen sich einsam fühlen. In jüngerem Alter dagegen sind es Faktoren wie Einkommen, Arbeitsverhältnis und Beziehungsstatus, die auf sehr unterschiedliche Weise zum Tragen kommen. Dabei hat man eindeutig festgestellt: Im jungen Erwachsenenalter sowie im hohen Alter ist das Risiko am höchsten, unter Einsamkeit zu leiden.
Soziologen und Experten wie zum Beispiel Vivek Murthy unterscheiden dabei grundsätzlich drei Arten der Einsamkeit, die wir erfahren können. Demnach gibt es die emotionale oder auch intime Einsamkeit. Sie spürt man, wenn im Leben ein Partner oder ein eng vertrauter Mensch fehlt. Wenn es einer Person hingegen an Freundschaften und persönlichen Beziehungen im Umfeld mangelt, wenn jemand zum Beispiel keine Kollegen hat, keinen Kontakt zu den Nachbarn, dann sprechen die Fachleute von sozialer Einsamkeit. Sie wird auch die relationale Einsamkeit oder Beziehungseinsamkeit genannt. Die kollektive Einsamkeit schließlich beschreibt das Gefühl einer fehlenden Zugehörigkeit zu einer größeren Gemeinschaft oder Gesellschaft.
Die Erklärungsansätze werden immer spezieller, je weiter sich die einzelnen Fachgebiete mit dem Phänomen beschäftigen. In der Sozialpsychologie etwa versteht der Forscher Wichard Puls aus Münster unter Einsamkeit ein »subjektives Innewerden«, ein »interaktives Dilemma«, bei dem soziale Einstellungen, Verhaltensweisen und letztlich auch die Gefühle selbst von gesellschaftlichen Standards abweichen.
Und nun kommen – nach der Beschreibung von Ursachen und Symptomen – auch schon erste Konsequenzen der Einsamkeit mit ins Spiel. Oft ist sie eine Vorstufe zu Depressionen, kann zu negativen Bewältigungsstrategien und schließlich zu Krankheiten wie etwa Alkoholismus führen. Die Soziologie erkennt aber noch andere Verhaltensmuster, die auf Einsamkeit zurückzuführen sind. Die Betroffenen neigen zu einem eigenen Kommunikationsstil, erzählen seltener, reagieren weniger auf Fragen anderer. Von einem Rückkopplungseffekt ist schließlich die Rede, wenn sich so ein Verhalten weiter verstärkt.
Außerdem kann es dazu führen, dass die Einsamen sich von einem gesellschaftlichen Miteinander immer weiter entfernen und bisweilen Standpunkte vertreten, die als destruktiv oder zynisch wahrgenommen werden können. Die Vereinsamung wird zur Vereinzelung. Und dabei geht irgendwann nicht nur eine Voraussetzung für gegenseitige Sympathie verloren, sondern auch die Basis für beiderseitiges Verständnis: Schnittmengen bei generellen Haltungen, Ähnlichkeiten darin, wie der Mensch zentrale Aspekte des Lebens bewertet. Ist beides nicht mehr gegeben, öffnet sich die Tür zu einem folgenschweren Schritt: Der Nährboden für die Einsamkeit wird dann ganz schnell auch zum Nährboden für Konflikte.
Doch nicht nur die Symptome der Vereinsamung können äußerst unterschiedlich ausfallen, auch die Folgen sind breit gefächert. Und dabei dürfen wir hier und da staunen. Zu einer Mischform aus intimer, sozialer und kollektiver Einsamkeit ist es inzwischen bei einer ganzen Generation japanischer Jugendlicher gekommen, die sich teils komplett von der Gesellschaft abkapseln. Die Ursachen sind gleich in einem ganzen Bündel von Faktoren ausgemacht worden. Das rigorose Schulsystem, Gruppenzwang, Mobbing und eine rücksichtslos kompetitive Gesellschaft haben in Japan zu einem Kuriosum geführt, das »Hikikomori« genannt wird. Das Wort beschreibt Menschen, die sich in ihren Wohnungen und Zimmern einschließen und den Kontakt zur Gesellschaft auf ein absolutes Mindestmaß reduzieren.
Nicht mehr von Einsamkeit ist in dieser Phase die Rede, sondern bereits von einer Sozialphobie oder gar Selbstisolation. Das japanische Gesundheitsministerium hat den Begriff sogar präzise definiert. Als ein Hikikomori gilt demnach eine Person, die sich weigert, das Elternhaus zu verlassen, und sich dabei für mindestens sechs Monate von Familie, Freunden und dem Rest der Gesellschaft zurückzieht. Dies meist bei verriegelter Zimmertür, nicht selten verschollen in den Galaxien der digitalen Subkulturen.
Wie die Soziologie beschäftigt sich auch die Medizin mit speziellen Aspekten der Einsamkeit. Doch geht es hier weniger um die Frage, wie unterschiedlich sich Formen sozialer Isolierung äußern können, sondern vor allem darum, wie sie sich auf die Gesundheit auswirken. Besonders die Altersmedizin hat ein Auge auf das Problem geworfen und erforscht, was Alleinsein bei Senioren auslöst. Bei einem geriatrischen Basisassessment werden alte Menschen gezielt danach gefragt, wie viele persönliche Kontakte sie noch haben, wie oft sie in einem Zeitraum mit anderen sprechen oder das Haus verlassen. Ob und wie Ursache und Wirkung hier zusammenhängen, ist noch nicht präzise erforscht. Doch immer mehr »Verlaufsbeobachtungen« legen nahe, dass alte Menschen schneller dement werden und generell geistig abbauen, je weniger soziale Kontakte sie haben und je einsamer sie sich fühlen.
Und obwohl sich die Einsamkeit nach wie vor eindeutiger Kategorien entzieht, so wurde zumindest dieser Zustand bereits klassifiziert: Nämlich das Alleinleben. Laut der von der WHO veröffentlichen Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zählt das Leben in einem Haushalt ohne eine weitere Person inzwischen zu jenen Faktoren, die nicht nur den Gesundheitszustand eines Menschen beeinflussen, sondern mehr und mehr auch die Gesundheitssysteme in Anspruch nehmen.
Auf den ICD-Listen sind diese »Faktoren« inzwischen unter dem abrechnungsfähigen Code Z60.2 gelistet: »Probleme, die mit dem Alleinleben zusammenhängen.«
Und spätestens damit ist die Einsamkeit auch zu einem medizinischen Fall geworden.