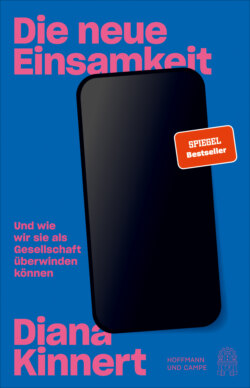Читать книгу Die neue Einsamkeit - Diana Kinnert - Страница 6
Einsamkeit, die Unbekannte
ОглавлениеViele haben versucht, das alte Gefühl zu erklären. Die eine Definition aber gibt es nicht. Zu unterschiedlich und subjektiv offenbart sich das ominöse Sentiment. Die modernen Zeiten machen es nicht leichter. Die digitale Revolution hat zu Phänomenen der Vereinzelung geführt, die wir noch gar nicht richtig begreifen. Womit also haben wir es zu tun? Wie gedenkt die Politik die Sache anzugehen? Und warum muss die Einsamkeit endlich aus der Tabuzone?
Lange hatte ich keinen blassen Schimmer, was Einsamkeit ist. Schlimmer: Ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht, was dieser Zustand alles bedeuten kann. Einsamkeit fand bei mir als Wort statt, als Teil meines Vokabulars – mit all den Gemeinplätzen, die sich damit leichtfüßig bedienen lassen. Eine Freundin fühlte sich einsam nach einer Trennung, Freunde zogen sich vor dem Examen zurück, um sich ein paar Wochen in aller Ruhe und Einsamkeit vorzubereiten. Auf solche und ähnliche Konnotationen war mein Einsamkeitsbegriff lange beschränkt: Mehr war in dieser Schublade nicht drin. Und ich denke, vielen anderen dürfte es ähnlich ergehen. Einsam ist eben einsam. Abgehakt.
Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal von politischen Maßnahmen gegen Einsamkeit hörte, war ich auch darum irritiert. Und staunte regelrecht. Da sprachen einige statt von Einsamkeit von sozialer Isolation – und stuften diese als einen Zustand ein, der angeblich weitverbreitet war.
Konnte das wirklich sein? Und: War das Gefühl einer subjektiv empfundenen Einsamkeit tatsächlich mit realen gesellschaftlichen Konsequenzen verbunden? Mit anderen Worten: Hatte die Einsamkeit der Menschen Einfluss auf die Gesellschaft? Und konnte andererseits die Gesellschaft einsam machen?
Vor allem fragte ich mich: Wie konnte sich ein Mensch in unserer global und digital vernetzten Welt überhaupt einsam fühlen? In einer Welt, die überfüllter, dichter, zusammenhängender und erreichbarer geworden ist als je zuvor? Wie in diesem kommunikativen Schlaraffenland noch ohne sozialen Kontakt sein? Die Welt der neuen Möglichkeiten schrie doch förmlich nach Interaktion und Austausch.
Es dauerte ein wenig, bis ich verstand. Denn mein Begriff von Einsamkeit war verkürzt, eindimensional. Lange dachte ich auch, Einsamkeit habe nichts mit mir zu tun. Am Ende dauerte es Jahre, bis ich begriff. Bis mir ebenfalls klar wurde, wie einsam auch ich selbst lange gewesen war.
Als mir ein befreundeter britischer Politiker Anfang 2016 davon erzählte, dass man sich in Großbritannien der Aufgabe stellte, politisch gegen Einsamkeit vorzugehen, wurde ich neugierig. Da war ein neues Themenfeld. Es klang nach einer innovativen Agenda, nach progressiven Positionen. Anti-Einsamkeit roch nach Zukunftslust, nach etwas, das den gealterten ideologischen Grabenkämpfen von linken Enteignungsphantasien und neoliberalem Deregulierungswahn etwas Neues entgegenzusetzen hatte. Mario Creatura, ehemals Kommunikationschef der britischen Premierministerin Theresa May und heute selbst Politiker in London, berichtete mir etwa von Senioren, die vor ihren Fernsehern gefesselt allein zu Hause saßen. Von Hunderttausenden alter Menschen, die keinen Besuch mehr von Familie oder Freunden empfingen. Einsamkeit, so speicherte ich es damals ab, würde eng mit der demographischen Entwicklung in Europa zusammenhängen. Und daraus ergab sich folgerichtig auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe, vor allem mit Blick auf die Zukunft. Die Alten litten unter Einsamkeit. Und sie wurden immer einsamer – weil sie immer zahlreicher wurden und immer älter. Das Motto lautete: Wir müssen mehr für sie tun. Müssen sie wieder mehr einbinden, berücksichtigen, uns für sie engagieren. Eine sympathische politische Linie, dachte ich in Zeiten, in denen die Klimabewegung Großelterngenerationen als Umweltsäue und Klimasünder verschrie und sich ein neuer Graben zwischen Alt und Jung aufzutun drohte.
An dieser Vorstellung von Einsamkeit blieb ich erst einmal hängen. An einem wahren Klischee, wenn man so will. Denn natürlich stimmt es, dass die Alten vielerorts vereinsamen. Es lag auf der Hand, und man musste sich nur einmal umschauen, nur einmal die Augen und die Ohren öffnen.
So geschehen während eines Routinebesuchs beim Hausarzt. Noch bevor ich das Wartezimmer betrat, hörte ich mehrere Arzthelferinnen, die sich indiskret beschwerten. Mehrere ältere Patientinnen und Patienten waren frühmorgens unangemeldet in der Praxis erschienen mit plötzlichen Krankheitssymptomen, die in der Nacht aufgetreten seien und deren Behandlung nicht warten könne. Der Terminkalender sei dadurch natürlich durcheinandergeschüttelt. Schaffte es das Praxispersonal dann aber doch, den Patienten ohne Termin nach stundenlangem Plausch aus dem Wartezimmer aufzurufen, winkte dieser zumeist wieder ab. »Ist schon besser geworden, ich glaube, es geht wieder«, verabschiedete sich dieser dann. Genervt standen die Arzthelferinnen beisammen. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Vielleicht war da gar keine plötzliche Krankheit, vielleicht war da nur dieses extreme Bedürfnis, sich unerkannt und anonym, aber doch innig und lebhaft im Wartezimmer auszutauschen? War das Wartezimmer in der Hausarztpraxis nicht vielleicht der letzte soziale Ort für sozial Isolierte? Und war dieser Treffpunkt nicht obendrein schambefreit und diskret? Ja, sie waren krank, und ja, sie erhielten ihre Behandlung: Die Einsamen holten sich ihren Austausch. An jenem Nachmittag beim Hausarzt reifte der Gedanke: Unsere Gesellschaft ist einsamer, als sie weiß, und einsamer, als sie zugeben will.
Eine der ersten deutschen Fachkonferenzen zum Thema »Einsamkeit als gesellschaftliche Herausforderung« veranstaltete 2019 die Fliedner Klinik in Berlin. Weil ich in der britischen Anti-Einsamkeitspolitik bereits mitgearbeitet hatte, wies man mir bei der Konferenz einen Bühnenplatz als Expertin zu. Und ich musste staunen, als ich die Hallen betrat. In dem gewaltigen gläsernen Forum direkt am Pariser Platz, zu Füßen des Brandenburger Tors, saßen Hunderte Gäste: Sämtliche Ränge waren besetzt.
Nach zehn Jahren Politik war ich konditioniert, hatte sich mein Blick an ein Meer aus dunklen Anzügen und Kostümen gewöhnt. Die Uniform der politischen Klasse war erstaunlich klar. Doch hier stimmte etwas nicht, da saß keine politische Klasse vor mir. Dieses Publikum trug grüne Baumwollpullover, rosafarbene Blusen und violette Kordhosen. Hier saß jedermann. Hier saß das Volk. Hier saßen Betroffene. Das Thema Einsamkeit traf einen gesellschaftlichen Nerv, berührte mehr Menschen als jene, die der politische Berufsalltag dazu befehligte. Die Ansage aus Großbritannien bestätigte sich: Einsamkeit eignete sich auch als politisches Thema in Deutschland. Und ich rieb mir die Hände: Man müsse doch nur vereinsamte ältere Menschen zusammenführen, Problem erledigt. Was für eine überschaubare Mission.
Doch dann geschah etwas, das mich auf einmal mit einer gänzlich anderen Kategorie der Einsamkeit konfrontierte.
Im selben Jahr, in dem ich mit den Anfängen britischer Einsamkeitspolitik in Berührung kam, verstarb sehr plötzlich meine Mutter. Die zentrale Figur unserer vierköpfigen Familie wurde jäh aus dem Leben gerissen, und nach über 25 Ehejahren stand zunächst einmal mein Vater ziemlich allein da. Die Ehe meiner Eltern war immer eine symbiotische gewesen. Die beiden waren sich selbst genug, Freundschaften hatten sie nie groß gepflegt. Ausflüge zu machen, das bedeutete höchstens gemeinsames Spazierengehen. Eine Ausgehkultur, Bekanntschaften durch Vereinsaktivitäten oder ehrenamtliches Engagement, all so etwas war ihnen völlig fremd. Auch darum brachte der Tod meiner Mutter meinen Vater an einen Punkt des extrem empfundenen Alleinseins. Meine jüngere Schwester, damals 23, war nicht weniger betroffen. Auch sie hatte in meiner Mutter stets die wichtigste Bezugsperson gefunden.
Ich selbst brauchte ebenfalls Zeit und suchte Wege, um mit dem Verlust meiner Mutter umzugehen. Darüber hinaus jedoch – davon war ich überzeugt – sollte der Tod meiner Mutter für mich keinen Initialpunkt eigener Einsamkeit darstellen. Wie auch? Mein Berufsalltag war prall gefüllt. Ich jonglierte zwischen Politik, Wirtschaft und Medien, tagtäglich weilte ich unter den unterschiedlichsten Menschen. Nicht einmal beim Essen saß ich allein, verbrachte kaum einen Abend in der eigenen Wohnung. Dazu trug nicht nur Berlin bei, wo ich wohnte. Auch die mich umgebende Szene war viel zu verführerisch und lebendig, um an so etwas wie Einsamkeit auch nur zu denken. Immerzu wurden neue Bekanntschaften geschlossen. Das Kennenlernen anderer Menschen war für mich Alltagsroutine. Und wie leicht schien das heute zu gehen? Man traf jemanden, tippte dessen Nummer ins Telefonbuch oder Profilnamen ins soziale Netzwerk, fertig. Auch stand ich zunehmend in der Öffentlichkeit. Ich saß in Podiumsdiskussionen, betrat Bühnen und trainierte regelrecht, vor fremden Menschen fließend sprechen zu können. Am Bahnsteig unterhielt ich mich selbstbewusst mit den Menschen, ging offen und souverän auf Fremde zu. Ich war durch und durch Menschenfreund.
Das Abziehbild eines sozialen Wesens.
Parallel aber geschah noch etwas anderes. Und zwar mehr oder weniger unbemerkt, überdeckt vom quirligen Alltag, überblendet von den schnellen Zeiten. Ich brach mit alten Freunden, beendete eine Liebesbeziehung nach der anderen, vermied in weiten Teilen sogar den Kontakt zu Vater und Schwester. Alles, was mich an den Schmerz erinnerte, an die Verlusterfahrung durch den Tod meiner Mutter, spaltete ich vehement von mir ab. Und dieses innere Rückzugsmanöver verschärfte sich noch, als ich mich bald auch noch von langjährigen Mentoren und anderen vertrauten Begleitern verabschieden musste. Meine Großeltern starben. Der Aktivist und Mitbegründer von Cap Anamur, Rupert Neudeck, den ich gut kannte und mit dem ich viel Zeit verbracht hatte, starb. Der Politiker Peter Hintze, mein Chef, auch er starb. Ein Jahr lang wurde ich von Todeserfahrungen verfolgt.
Erst heute verstehe ich, was damals geschah. Zu was mich diese Erfahrungen trieben. Ich begegnete meinem Schmerz nicht. Ich hörte ihm nicht zu und wollte diese Diana Kinnert nicht fortsetzen. Stattdessen erfand ich mich als neue Person. In einer Euphorie von Triumphalismus stürzte ich mich in die Arbeit, züchtete mir einen Freundeskreis heran, dem ich mein dauerhaftes Muntersein als Charakter verkaufte, sabotierte intimere Beziehungen, in denen mich ein liebendes Gegenüber aufrichtig erkannte und behutsam den Schleier heben wollte. Ich wurde gemein, hinterließ verbrannte Erde. Suchte nach Lärm und Ablenkung, war richtig süchtig danach. Und dabei boykottierte ich alle Ruhe und Intimität. Erstickte die Wiege des Eigenen, den Ort der reflexiven Begegnung. Die tiefe Einsamkeit, die mich in diesem Prozedere der Selbstignoranz überfiel, war allerdings sehr gut getarnt. Denn meine Einsamkeit war keine, bei der ich die Anwesenheit anderer vermisste. Meine Einsamkeit war eine, bei der ich mich selbst vermisste.
Ich war eine lange Zeit einfach nicht mehr da gewesen.
Rückblickend haben mich diese Erfahrungen vor allem eines gelehrt: Wie schwierig und vertrackt es ist, sich dem Thema Einsamkeit zu nähern. Und dies nicht nur innerlich und emotional, sondern allein schon auf der Ebene der Definition. Und dabei besteht genau hier eine zwingende Kausalität, die zu verheerenden Missständen führt. Denn wenn wir die verschiedensten Formen der Einsamkeit gar nicht erst weiter ausgraben, wenn wir sie nicht differenzieren, dechiffrieren und benennen, dann werden wir sie auch nicht erkennen, nicht verstehen und erst recht nicht bewältigen können.
Was also bedeutet Einsamkeit? Was kann sie bedeuten, beinhalten, bewirken? Diese Fragen lassen mich heute ebenfalls wissen: Einsamkeit ist bei weitem keine so offensichtliche und eindeutige Angelegenheit, wie die meisten Menschen glauben. Die Fragen schicken einen vielmehr auf tausend Pfade.
Liegt eine Isolation darin begründet, keine Freunde zu haben? Äußert sich Einsamkeit in dem Wunsch, am liebsten und immer öfter einfach zu Hause bleiben zu wollen? Lässt sie sich daran bemessen, wie oft wir mit wem sprechen, uns austauschen, uns treffen? Und kann die Last der Einsamkeit sich womöglich auch hinter jenen feinen Untertönen verbergen, die in der Frage mitschwingen, nicht wie oft und wie laut wir mit jemandem kommunizieren, sondern auch wie ehrlich, wie offen, wie wahrhaftig?
Eines kann ich gleich verraten: Antworten zu finden ist nicht leicht. Es ist schwer. Und oft sind ausgerechnet die widersprüchlichsten Aussagen zum Thema die eindeutigen Indikatoren der Einsamkeit. Wie also mit diesem ganzen Ding am Ende umgehen? Wie sich dieser kuriosen Seelendisponiertheit überhaupt nähern?
Damit kommen wir zu einem ersten grundsätzlichen Problem. Denn Einsamkeit ist nichts Dingliches, das wir greifen können. Einsamkeit besitzt keine messbare Größe, erlaubt keine numerische Diagnose. Wir können Einsamkeit beschreiben, aber nicht abschließend (er)klären. Auf keinem Röntgenbild ist sie zu sehen, in keinem Blutbild eindeutig nachzuweisen. Schon der Ort, wo die Einsamkeit wohnen soll, bietet kaum definierbare Strukturen: Unsere Seele.
Wer von Einsamkeit spricht, begibt sich in die vagen Welten der Gefühle. Empfindungen, die wir kaum objektiv messen können, sondern die wir höchst subjektiv erleben.
Damit kommen wir zu einem zweiten Problem. Denn wenn von zunehmender Einsamkeit in der Gesellschaft die Rede ist, mithin von einem Phänomen, das wirtschaftliche Folgen haben und sogar zum politischen Thema werden wird – woran sollen wir uns dann orientieren? Wie diese unscharfe Empfindung überhaupt packen?
Viele Zustände lassen sich genau bemessen. Wenn es draußen kalt ist, wissen wir, wie kalt. Wenn ein Auto schnell fährt, wissen wir, ob es gerade mit 160 oder mit 284 km/h über die Autobahn prescht. Auch wie groß eine Wohnung ausfällt, können wir exakt beziffern: 20, 50, 100 oder auch 300 Quadratmeter.
Auch wenn ein Mensch krank ist, denken wir in recht präzisen Kategorien. Der eine hat Husten, ein anderer Bluthochdruck, der nächste eine Apoplexie in der linken Gehirnhälfte. Die Art der Krankheit, ihr Ort und ihr Ausmaß: Wir sind meist in der Lage, dies sehr genau zu bestimmen und auch auszudrücken.
Schwieriger wird es schon bei Umständen, die andere Adjektive beschreiben. Wann zum Beispiel ist ein Mensch schön, wann hässlich? Oft sind es kulturell bedingte Schönheitsideale oder auch nur vorgekaute Trends, die uns hier gewisse Muster zur geschmäcklerischen Orientierung an die Hand geben. Ob dies nun gut ist oder schlecht. Doch auch hier gilt letztlich: Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
Was jedoch geschieht, wenn jemand einsam ist? Hier tappen wir im Dunkeln. Haben keine Bemessungsgrundlage, können auf keine Größeneinheit mehr zurückgreifen. Mit der Liebe ist es ja auch so eine Sache. Denn obgleich sie uns wohl deutlich schöner steht, rational zu begreifen ist sie ebenfalls kaum, zu erforschen und zu definieren noch viel weniger. Psychologen, Dichter, Songwriter, sie alle haben sich schon den Kopf darüber zerbrochen. Einige sind dabei zu bemerkenswerten Ergebnissen gekommen, doch eine mathematisch präzise Lösung wird es wohl nie geben.
Zum Glück? Ja, zum Glück, wollen wir jetzt ausrufen! Als sei es uns nicht geheuer und am Ende auch gar nicht lieb, alles immer bis zur letzten Kommastelle bemessen zu können. Und auch bemessen zu wollen. Zu einem Problem, zumindest zu einer brisanten Lage kann es jedoch führen, wenn das, was wir Gefühle nennen, einen zunehmenden Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen hat.
Doch genau das scheint der Fall zu sein. Im Zeitalter der Daueraufregung widmet man sich darum inzwischen gezielter dem diffizilen Gebiet der Gefühlsforschung. Und die Fragen haben es in sich. Über welche Gefühle sprechen wir? Wann müssen wir von geteilten Gefühlslagen reden? Und wie beeinflussen diese am Ende eine Gesellschaft? Allein einige Begriffe, die in letzter Zeit populär geworden sind, zeigen, dass solche Gefühlslagen tatsächlich mehr und mehr auf die gesellschaftlichen und auch auf die politischen Bühnen drängen. Da sind die Wutbürger. Die Hassdemos. Die Solimärsche. Die Klimaproteste. Die Verschwörungserzählungen. Die Corona-Rebellen. Die Schmährufe zur Lügenpresse.
Wut. Hass. Solidarität. Proteste. Verschwörung. Rebellion. Lügen. All dies sind emotional stark aufgeladene Begriffe. Und genau darum kamen auf einer internationalen Konferenz erst jüngst Wisenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, um sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Macht solche Affekte besitzen, wie sie Politik, Medien und soziale Bewegungen beeinflussen. Dem Sonderforschungsbereich gab man den trefflichen Namen: »Affective Societies – Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Gesellschaften.«
Die Einsamkeit stand nicht auf der Liste der einschlägigen und untersuchten Sentimente. Noch nicht. Und vielleicht auch deswegen nicht, weil wir es hier mit einem äußerst flüchtigen, man könnte sagen, besonders unsichtbaren Gefühl zu tun haben.
Wie also mit dieser nebulösen Befindlichkeit umgehen? Vielleicht hilft es auch hier, zunächst nicht von der Einsamkeit zu sprechen, sondern eher von der Vereinzelung. Das Wort »vereinzelt« kommt einem bezifferbaren Zustand immerhin näher und dem Wunsch nach Quantifizierung entgegen. Die Einsamkeit ist eher ein Resultat der Vereinzelung, beschreibt wesentlicher unseren Seelenzustand, unsere Gemütsverfassung. Doch beide Begriffe sind unmittelbar miteinander verwoben, auch wenn der tägliche Sprachgebrauch das eine Wort lieber mag als das andere.
Ich fühle mich einsam. Weniger: Ich fühle mich vereinzelt. Leichter machbar ist dagegen schon diese Version: Der vereinzelte Mensch muss sich irgendwann einsam fühlen.
Gebräuchlicher ist es, die Begriffe »einsam« und »allein« zu unterscheiden. Dabei beschreibt auch das Wort »allein« eher eine objektivierbare und numerisch belegbare Tatsache, »einsam« hingegen eine subjektive Befindlichkeit.
Doch damit genug des semantischen Hickhacks. Denn eines ist am Ende unmissverständlich: Wer behauptet, dass er einsam ist oder sich einsam fühlt, dem geht es in der Regel nicht gut. Der ist allein, der ist traurig. Der fühlt sich außen vor, womöglich ausgeschlossen. Der hat nicht teil. Der fühlt sich wie das fünfte Rad am Wagen. Geduldet, überflüssig, unerwünscht. Auch zu diesem Schluss könnte er kommen: dass er nicht gebraucht wird, nicht mehr dazugehört.
Vor allem mit diesem für jeden Menschen früher oder später tragischen Zustand will ich mich in diesem Buch befassen. Also nicht mit jener Form der Einsamkeit, die der Wanderer in den Bergen sucht, der Einhandsegler auf den Ozeanen, der Sinnsucher auf der einsamen Insel oder der schöpferisch tätige Maler in der einsamen Natur.
Diese Kategorien der Einsamkeit sind grundlegend andere. In diesen Fällen ist die Einsamkeit selbstgewählt oder aufgrund bestimmter Umstände akzeptiert. Der Einsame weiß in der Regel, wann er seine Einsamkeit beenden kann, beenden wird. Er hat Kontrolle und Wissen über diesen Zustand. Auch weiß er, dass andere im Bilde sind. Er schämt sich nicht, ist meist sogar stolz auf seine wie auch immer verordnete Zeit der Entsagung und Abnabelung.
Dieser Einsame kann in der Regel sein Smartphone zücken, ruft seine Familie an, seine Freunde. Er geht runter vom Berg und ist bald wieder mitten im Leben. Zu Hause, im Job. Abends sitzt er mit Kollegen im Restaurant, um von seinem einsamen Abenteuer in geselliger Runde zu berichten.
Der andere Einsame kann genau das nicht. Seine Einsamkeit ist nicht gewählt und selbst auferlegt, sie ist unfreiwillig; kein vorübergehender und meist auch kein beeinflussbarer Zustand. Seine Einsamkeit wird zum Einsamsein. Zu einem ungewollten, zeitlich und räumlich nicht begrenzbaren Zustand. Es gibt keinen Ausknopf. Es existiert keine Welt des (zumindest altbekannten) Gemeinsamseins, die er nach erduldeter oder gemeisterter Isolierung wieder betreten kann.
Dem Einsamen, um den es mir geht, ist genau das verwehrt. Sein Alleinsein ist dauerhaft, ohne absehbares Ende. Ein eklatanter Unterschied. Denn ein Leid mit bekanntem Ende ist entschieden leichter zu ertragen als ein Leid ohne absehbares Finale. Und nun wird es schon langsam trauriger und trüber, gerät menschenloser und unheilvoller, unheroischer und unerhörter. Begriffe wie kontaktarm, abgesondert, abgeschnitten mischen sich ins Feld, Worte wie diese reihen sich ins Vokabular: abseits, ausgestoßen, unbeachtet. Und auch diese Partizipien sind auf einmal zu vernehmen: ignoriert, nicht einbezogen, links liegengelassen. Ausgegrenzt, ausgeschlossen, ausgeklammert. Die Begriffe der Distanz und Distanzierung spielen fast immer eine Rolle. Und wenn einem die eigene Einsamkeit nicht einmal als solche bewusst ist, auch die Möglichkeit der Selbstdistanzierung.
Und nun wird es keineswegs bunter und farbenfroher, sondern schon deutlich grauer und schwärzer. Es wird nicht süß, sondern bitter. Nicht hell, sondern dunkel. Nicht leicht, sondern schwer. Alles Begriffe, die mit der Einsamkeit ebenfalls in enger Verbindung stehen. Und nein, dann wird es auch nicht wärmer, sondern im Gegenteil immer kälter.
Und dann tut Einsamkeit irgendwann weh.