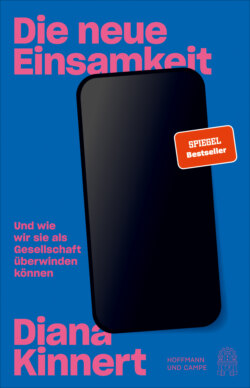Читать книгу Die neue Einsamkeit - Diana Kinnert - Страница 9
Wie wir Einsamkeit bewerten
ОглавлениеSo engagiert Kunst und Kultur, so systematisch Fachgebiete wie die Soziologie, Psychologie oder Medizin sich des Problems der Einsamkeit annehmen, so sehr bleiben all diese Bemühungen letztlich nur Versuche, es irgendwie zu fassen zu kriegen. Schon die medizinisch motivierte Klassifizierung des »Alleinlebens« etwa ist eine Frage der Definition und müsste sich – heute mehr denn je – keinesfalls mehr nur auf die räumlichen Grenzen einer Wohnung, eines Hauses oder eines Altersheims beziehen. Das Edward-Hopper-Syndrom: Es ist gerade auch dann zu verzeichnen, wenn wir aus dem Haus gehen und auf die Straße treten. Vor allem die heutigen Großstädte sind dabei zu Agglomerationen der Anonymität geworden. Und je mehr Menschen wuseln, so scheint es, desto unbedeutender wird das einzelne Individuum. Das bringt einen weiteren Aspekt der Einsamkeit ins Spiel: ihre Bewertung.
Erhöhte Einsamkeit kann dabei auch etwas zutiefst Positives bedeuten, kann uns in einen höchstmöglichen Zustand geistiger Erhabenheit befördern. Beginnen wir an diesem Ende der Skala und unternehmen dafür einen kleinen etymologischen Ausflug. Im 14. Jahrhundert stand hinter dem Wort »einsam« das Althochdeutsche »Einsamana«, womit eine »Einheit« gemeint war. Allerdings nicht nur die einer Gemeinde oder einer Siedlung, sondern vor allem die Einheit mit Gott. Im ekstatischsten aller Fälle also wird aus der Einsamkeit schließlich ein göttlicher Rausch: die unio mystica, nichts anderes als die geheimnisvolle Vereinigung der Seele mit Gott.
Ein Bumerang-Effekt von elysischer Qualität. Der Einsamste, die von allem losgelöste Seele landet am Ende in der höchstmöglichen Zusammenkunft: Im göttlichen Nirvana. Was ihre Bewertung betrifft, dürfte die Einsamkeit in der Verschmelzung mit dem Allmächtigen ihre Bestnote abbekommen – doch im Laufe der Jahrhunderte geriet der göttliche Faktor mehr und mehr in Vergessenheit.
Das Wort »einsam« nahm eine andere Bedeutung an, die Vorstellungen änderten sich. Zunehmend bezeichneten die Menschen damit eher eine Art der Abgeschiedenheit von anderen, ein Dasein abseits der Gesellschaft, womit der Begriff nun keineswegs mehr positiv, sondern zunehmend negativer ausgelegt wurde. Der einsame Mensch wandelte sich mehr und mehr zu jenem Geschöpf, das nicht mehr die stille Einkehr suchte, sondern sich beim Thema Geselligkeit unwillig oder sogar unfähig zeigte. Damit war der Weg frei ins Reich der Neurotiker und Depressiven, ins Land der Ausgegrenzten und Ausgestoßenen.
Das damit verbundene Urteilsdenken hat sich lange gehalten und ist zu weiten Teilen bis heute das Maß der Einsamkeit. Isoliert, allein und einsam dazustehen, gilt als unattraktiv, als Makel. Der Einsame scheint unfähig zu gemeinnützigem Handeln, er nimmt nicht teil am Leben, und allzu schnell wird er als Versager etikettiert. Vom Typ her zeigt er sich eher schrullig, komisch, behaftet von seltsamen Macken – zumindest, wenn es um Fremdzuschreibung geht. Der Einsame meidet andere Menschen. Die anderen meiden den Einsamen. Und der so in die Ecke Gestellte darf auf wenig Gnade und Verständnis rechnen. Und dies ist enorm wichtig zu verstehen: Wir mögen Einsamkeit nicht nur nicht – wir verurteilen sie, lassen sie verschwinden hinter einem Tabu. Mit der Einsamkeit verhält es sich ähnlich wie mit Krankheit, Depression, Alkoholismus, Fremdsein, Anderssein aller Art. Als Betroffene geben wir es ungern zu. Verstecken diesen Zustand am liebsten, überspielen diese unangenehme innere Befindlichkeit – überspielen sie anderen gegenüber, oft genug sogar uns selbst gegenüber. Wer hingegen Zeuge der Einsamkeit wird, schaut ungern hin. Wer sie riecht, macht lieber einen Bogen drum herum. Denn an der Einsamkeit ist etwas faul. Sie stinkt. Und wenn man ihr etwas Positives abgewinnen will, dann müssen schon metaphorische Schwergewichte bemüht werden, um sie aufzuwerten. Dann muss das betroffene Subjekt schon zum einsamen Wolf, zum Lonely Cowboy oder gleich zum Lone Rider werden, um seine abstoßende Aura abzustreifen. Doch freilich sind dies lediglich romantische, irreführende und oft verharmlosende Verklärungen des Begriffs. Denn an wahrer Einsamkeit ist nichts Schönes, nichts Gutes. Sie ist dunkel und kalt.
Und dabei doch immer wieder zu finden. Zum Beispiel in den Megalopolen Indiens, wo sich beobachten lässt, wie rücksichtslos mit dem Phänomen – oder sollten wir sagen: mit der Krankheit? – umgegangen werden kann. Soziale Isolation, Armut und gesellschaftliches Klassendenken haben hier zu einer besonders brutalen Konfiguration der Einsamkeit geführt. Abermillionen Menschen flitzen über die Straßen von Mumbai, Kolkata, Neu-Delhi, in endlosen Schlangen stehen sie vor den Tempeln, quetschen sich in die Züge und drängeln sich noch auf ihren Dächern. Mitten in diesem Chaos der Großstädte leben Abertausende Bettler und Verwahrloste, die einsam ums Überleben kämpfen. Unantastbar, als seien sie nicht nur allein, sondern regelrecht unsichtbar.
Der so von der Gemeinschaft Isolierte wird nicht mehr als einsame Seele wahrgenommen. Wenn er überhaupt noch wahrgenommen wird, dann als Schmutz, als Aussätziger.
Wie drastisch wir die Einsamkeit jedoch auch immer beurteilen und aburteilen – in der Regel fällt das Verdikt unschön aus. Und das gilt nicht nur für die einzelne Person, sondern wird schnell auf die Gesamtheit aller Einsamen übertragen. Das Urteil fällt dann pauschal aus und kann sich sogar auf eine ganze Epoche beziehen. Und so stand es also bald da, das Individuum einer sich so gern als modern begreifenden Gesellschaft: Haltlos in der Sinnkrise, orientierungslos in der sich formenden Konsumgesellschaft, fassungslos in einem sich langsam auflösenden Wertesystem.
Spätestens mit David Riesmans 1950 erschienenem Buch The Lonely Crowd, das sechs Jahre später unter dem Titel Die einsame Masse auch hierzulande erschien und für große Aufmerksamkeit sorgte, wird der Gesellschaft dabei endgültig auch die Verbundenheit gegenüber alten Traditionen aberkannt. Der Mensch wird zu Treibgut, das in den modernen Massengesellschaften schwimmt, ausgestattet nicht mehr mit einem mehrheitlich erlernten Sinn fürs Gemeinwesen, sondern vielmehr mit einem »inner gyroscope«, wie Riesman es nennt. Einem persönlichen inneren Kreiselkompass, mit dem jeder für sich durch die Fluten steuert.
Ein höchst interessanter Gedanke. Vor allem, weil er bereits 1950 formuliert wurde – siebzig Jahre vor unserer fragmentierten Zeit, in der fast jeder ein Smartphone besitzt, in der Internet, Mails und Messenger-Dienste direkte persönliche Kontakte massiv ins Digitale verschoben haben. Nicht umsonst ist darum auch der Begriff der Fragmentierung längst passé. Wenn es um die Vereinzelung des Menschen im dritten Millennium geht, ist inzwischen von einem weiteren Stadium die Rede: der Atomisierung.
Und was die Bewertung von Einsamkeit angeht, geschieht hier nun etwas absolut Überraschendes. Denn der Ausgestoßene, Isolierte, Einsame oder Vereinzelte – wie man ihn letztlich auch nennen mag – streift hier auf einmal sein beflecktes Etikett ab. Der moderne Einzelgänger erlebt sozusagen eine positive Überschreibung. Denn so sehr das vereinzelte Wesen im menschlichen Zusammenleben lange eher verschmäht wurde, so sehr nehmen wir es heute auf einmal als Ideal wahr.
Ein Paradigmenwechsel, dessen Bedeutung wir uns noch gar nicht in Gänze bewusst sind. Dabei findet genau hier nicht nur ein Sinneswandel, sondern auch eine Umbewertung des Einsamkeitsbegriffs von außerordentlicher Tragweite statt. Im Eiltempo der kapitalistischen Aufrüstung haben wir den Charakterzug der Einsamkeit umprogrammiert. Bis der moderne Mensch endlich auf ganz neue Weise brilliert: Nicht mehr glücklich in der Gemeinschaft, sondern erfolgreich in seiner eigenen Singularität.
Dies ist ein so wesentlicher wie bemerkenswerter und vielleicht auch bedenklicher Schritt. Und neben den kaum absehbaren Nebenwirkungen birgt er vor allem die Notwendigkeit, auch das Phänomen der Vereinsamung völlig anders zu betrachten.