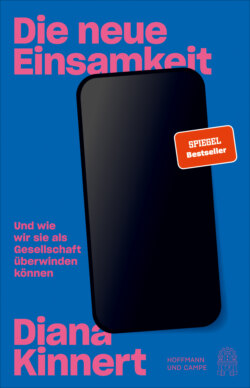Читать книгу Die neue Einsamkeit - Diana Kinnert - Страница 5
Es fängt an: Die vereinzelte Gesellschaft
ОглавлениеEinsamkeit kennt viele Formen. In den modernen kapitalistischen Gesellschaften haben sie inzwischen zu einer kollektiven Vereinzelung geführt. Experten sprechen von einem Phänomen, das sich ausweitet wie eine Epidemie: Allein in Deutschland sagen 14 Millionen Menschen, dass sie sich einsam fühlen. Und spätestens seit Corona ist das Gefühl der Isolation zum globalen Status quo geworden.
Wenn ich in die Suchmaschine die Worte »einsam« oder »allein« eingebe, spuckt das Internet in weniger als einer halben Sekunde bis zu 160 Millionen Ergebnisse aus. Ich klicke auf Bilder. Sekunden später darf ich mir anschauen, was wir uns offenbar unter diesen Begriffen vorstellen. Was die Filter und Algorithmen uns vor Augen halten, wenn es um das Thema Einsamkeit geht.
Ich sehe einen Herrn mittleren Alters, der allein auf einer Bank sitzt und aufs Meer blickt. Eine Frau, die unter ihrem Regenschirm auf einem Steg steht und aufs graue Wasser schaut. Da ist ein Mann, er hockt auf seiner Fensterbank, starrt verloren auf das Häusermeer zu seinen Füßen. Da ist eine Frau, allein auf ihrem Bett, die Beine angezogen, die Arme über den Knien verschränkt. Ich sehe eine Seniorin in ihrem Sessel sitzend, deren Blick durch ein offenes Fenster in die Leere fällt. Weiter unten spiegelt sich das Gesicht eines jungen Mädchens in einer Scheibe, der Blick traurig, melancholisch. Es sind gängige Szenen der Einsamkeit. Eine Verlorenheit, die uns anspringt.
Scrolle ich weiter runter, sind Leuchttürme auf menschenleeren Inseln zu sehen. Alsbald: Liegengelassene Teddybären, verlassene und vom Regen nasse Straßen, der Mond, Millennials, die sich eine Plastiktüte über den Kopf ziehen. Die Bilder zeigen mir Zäune, Barrieren aus Draht, geisterhaft verlassene Rolltreppen und einen nackten Stein, auf den jemand mit Farbe geschrieben hat: »Corona ist doof«.
Noch weiter unten wird mir ein Poster dargeboten, das die Vorstellungen von Einsamkeit typographisch darstellt. Es stehen dort groß die Worte: »Verschlossenheit«, »Verlassensein«, »Isolation«, »Solitüde«, »Wüste«, »Einsiedlerleben«. Dann wieder kommen zahllose Bilder von Frauen und Männern, die zu Hause in ihren Wohnungen allein auf den Fluren sitzen, barfuß oder in dicken Socken, flankiert von blanken, möbellosen Wänden. Plötzlich das graphische Motiv einer Statistik: Frauen (42,4 Prozent) würden sich häufiger einsam fühlen als Männer (29,5 Prozent). Ich wische weiter nach unten, bekomme nun einige Sinnsprüche präsentiert.
Ich lese: »Der Kummer, der nicht spricht, nagt leise am Herzen, bis es bricht.« Ich lese: »Einsam heißt nicht, dass man keine Freunde hat, die für einen da sind. Einsam heißt, dass fehlt, was das Herz glücklich macht.« Plötzlich ein Zitat von Wilhelm Busch: »Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut.« Kurz darauf dieser Aphorismus: »Begegnest Du der Einsamkeit, habe keine Angst! Sie ist eine kostbare Hilfe, mit sich selbst Freundschaft zu schließen.«
Ich sitze da und denke: Ja, was denn nun? Und surfe noch etwas weiter durchs Ergebnismeer.
Ein Mann ohne Augen. Ein Heißluftballon über den Wolken. Ein Teenager, vergraben in seinem Hoodie, seinem Kapuzenpulli. Ich sehe, noch weiter nach unten scrollend, eine graphisch dargestellte Waagschale, auf der die Begriffe »Äußere Auslöser« und »Innere Ursachen« schwerer wiegen als jener der »Inneren Stärke«. Ich erkenne das symbolträchtige Bild des einsamen Poeten. Eine Schreibmaschine, ein weißes Blatt Papier. Darauf einzig die Worte: »Die Einsamkeit.« Vielleicht ist es der Beginn eines Romans, vielleicht nur das inszenierte Motiv einer Bildagentur.
Als Nächstes bieten mir die Suchergebnisse: Zwei Schienen, die ins Leere führen. Dann entdecke ich ein Gemälde von Marc Chagall, Solitude von 1933. Öl auf Leinwand, 1×1,69 Meter groß. Laut Beschreibung ein Sinnbild kultureller Entfremdung, dargestellt durch einen Rabbiner, eine Geige spielende, einäugige Ziege und einen Engel mit Flügeln vor einem dunkel verrauchten Dorf. Menschen auf der Flucht, offenbar auch ein Inbegriff der Einsamkeit.
Ich scrolle noch weiter nach unten. Lese auf einem Bild den Satz: »Es ist schon eigenartig, wie wir es genießen, allein sein zu können, aber daran verzweifeln, wenn wir allein sein müssen.« Ich sehe dann noch dies: Einen winzigen Mann auf einem gottverlassenen Parkplatz, einen Rentner am Stock, eine Frau auf einer Schaukel, sitzend und sinnierend vor einem spiegelglatten See. Und sie alle wenden uns den Rücken zu.
Doch dann erschöpft es sich langsam. Dann wiederholen sich die Motive, die Bilder, die Ideen. Ab einem gewissen Punkt, so scheint es, kommen die Vorstellungen von Einsamkeit an eine Grenze. Ich sehe, ganz unten, noch eine skizzierte Cloud, lese von »digitaler Einsamkeit«. Danach aber bietet unter den Hunderten von Suchergebnissen nur noch ein fauler Zynismus Abwechslung. Ich blicke auf die Vergrößerung eines haarigen Milbengesichts und lese: »Wenn Du einsam bist, besinne Dich Deiner garantierten Freunde – sie leben zu Millionen auf deiner Haut.«
Die Seite ist zu Ende. Und nun sehe ich mich selbst. Wie ich mitten in Berlin in der U-Bahn sitze, allein unter vielen, versunken in mein mobiles Display.
Einsamkeit ist ein altes Thema. Es beschäftigt die Menschen seit eh und je, kommt in zahlreichen Facetten zur Sprache. Der Zustand der Einsamkeit, so scheint es, kann ein guter sein, ein schlechter, er kann beflügeln und bedrücken. Einsamkeit hat, grob gesprochen, einen doppelten Ruf. Allein das Wort kann uns an menschenleere Strände und sonstige Paradiese der Besinnung beamen. Orte, die wir mit Selbstfindung und Glück verbinden. Dies ist die eine Spielart des Einsamkeitsbegriffs. Sie hat mit lustvoller Entdeckung zu tun, mit Reizreduktion, Einkehr und Kontemplation, mit spiritueller und gedanklicher Bereicherung. Selten jedoch bringt der Zustand der Einsamkeit – so positiv wir ihn auch begreifen wollen – Heiterkeit und Ausgelassenheit mit sich. Auf der anderen Seite des Spektrums landen wir schließlich in ganz anderen Kontexten, wenn wir von Einsamkeit sprechen. Dann haben wir es mit Verlassenheit zu tun, mit Abgeschiedenheit und Ausgrenzung.
Schon beim ersten Betrachten wird klar, dass das Thema Gewicht hat. Dass der Begriff der Einsamkeit zudem keineswegs leicht zu definieren ist, dafür umso schneller in Gemeinplätzen und Klischees versandet.
Eindeutig sind hingegen Zahlen. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Splendid Research fühlt sich in Deutschland jeder Sechste häufig oder gar ständig einsam – und damit ist nicht die schöne Spielart der Einsamkeit gemeint. Fast 14 Millionen Menschen, allein hierzulande, die vielmehr das sind, was der Duden so definiert: »Für sich allein«, »verlassen« oder »ohne Kontakte zur Umwelt«. Ein verstörender Zustand. Und ein verstörender Wert. Zum Vergleich: Die Zahl der so begriffenen Einsamen ist damit doppelt so hoch wie die der Diabetiker im Land, weit höher auch als jene der Herzkranken und sogar gut siebenmal höher als die der Demenzkranken in Deutschland.
In vielen anderen Ländern kommen die Umfragen zu keinem ermutigenderen Ergebnis. In einer Umfrage der Europäischen Kommission von 2018, also vor Corona, wurden über 28000 Menschen aus ganz Europa gefragt, ob sie sich in der vorangegangenen Woche einsam gefühlt hätten. Das Ergebnis: In Bulgarien waren die meisten Menschen von Einsamkeit betroffen. 20 Prozent der Befragten fühlten sich dort meistens, fast immer oder immer einsam. In sieben weiteren Ländern erging es mindestens zehn Prozent der Befragten ebenso. Nur in den Niederlanden waren es mit drei Prozent deutlich weniger. Der Gesamtdurchschnitt derjenigen, die sich meistens oder immer einsam fühlten, lag bei acht Prozent. Auf die Gesamtbevölkerung der EU von 2018 hochgerechnet, entspricht das etwa 41 Millionen Menschen. Allein über sechs Millionen davon sollen es in England sein. Gut und gern 20 Millionen außerhalb Europas in Japan, weit über 30 Millionen in den USA. Wie der nichtkommerzielle Hörfunksender NPR berichtet, geben in den Vereinigten Staaten sogar drei von fünf Amerikanern an, einsam zu sein. »Mehr und mehr Menschen sagen, dass sie sich ausgeschlossen und unverstanden fühlen«, schreiben die Autoren einer Studie, die im Auftrag des Versicherungsunternehmens Cigna gemacht wurde. Zudem fehle es ihnen an companionship, an Gesellschaft. Und seit 2018 ist die Zahl all jener, die sich sozusagen »außen vor« fühlen, noch einmal um 13 Prozent gestiegen.
Forscher und Ärzte sprechen längst von einer Epidemie der Einsamkeit. Und obwohl »Einsamkeit« nach wie vor ein schwammiger Begriff ist und bis heute von den meisten Menschen kaum als genuines Problem erkannt und eingestuft wird, meinen die Forscher damit sogar einen Zustand, der nicht nur traurig und bemitleidenswert ist, sondern der sogar krank macht.
Der Mediziner Vivek Murthy diente unter Präsident Barack Obama als Surgeon General of the United States, war verantwortlich für die wichtigen Fragen der US-amerikanischen Gesundheit. Seine Erfahrungen fasste er jüngst wie folgt zusammen: »Während all meiner Jahre als Arzt waren es weniger Herzattacken und Diabetes, die für den Zustand der meisten Patienten verantwortlich waren. Es war ihre Einsamkeit.« Und wenn Murthy von einer crisis of loneliness spricht, meint auch er eine Angelegenheit, die längst ganze Gesellschaften betrifft.
In der Tat: Eine seltsame und neue Form der Vereinsamung wird zusehends zu einem modernen Phänomen. Zu einem Grundzustand vieler Menschen, der zunächst wenig greifbar, dafür aber umso drängender zu spüren ist.
Und dabei reicht es nicht mehr, sich auf alte Muster und Vorstellungen von Einsamkeit zu berufen, wie sie sich etwa in den stereotypen Motiven der Suchergebnisse zeigen. Die Seniorin, die schweigend auf der Parkbank sitzt. Der einsame Rentner in seiner stillen Wohnung. Die Frau im Regen. Oder auch die berühmte einsame Insel.
Auch genügt es nicht mehr, sich auf gängige Konnotationen zu berufen, wenn wir statt von Einsamkeit einerseits etwa von Ruhe und Besinnung sprechen, andererseits von Kontaktarmut, Isolierung, Verlassenheit oder sozialer Ausgrenzung. Vielmehr gilt es, die Merkmale und Bedingungen der neuen Einsamkeit differenzierter zu betrachten und feiner zu bemessen, also ganz neu zu begreifen und dann präziser zu definieren. Denn ein diffuses Gefühl von meist negativer Einsamkeit zieht sich inzwischen durch alle Milieus und betrifft die meisten Altersgruppen. Einsam fühlen sich nicht mehr vorrangig Senioren, verwitwete und arme Menschen, sondern zunehmend auch arbeitende Bürger, zunehmend auch jene Frauen und Männer der digitalen Generationen, die ja eigentlich inmitten eines sozial vernetzten, durchlässigen, mobilen Lebens stehen.
Das Phänomen der Einsamkeit, dem wir heute gegenüberstehen, ist komplex und vielschichtig. Globalisierung und Individualisierung haben zu ganz neuen Formen der Isolation geführt. Die digitale Welt und die neuen Technologien befeuern dies, und das beschleunigte und mehr und mehr kompetitive Leben macht es augenscheinlich nicht leichter.
Was geschieht, wenn das Mobiltelefon in die Hosentasche rutscht, ich die Treppen der U-Bahnstation hinaufsteige und auf die Straße hinaustrete? Ich sehe die Menschen – denn sie sind überall. Sie sitzen in den Bars, bummeln durch die Stadt, flitzen zum Bus, warten auf ihr Uber, kommen von der Arbeit, gehen zur Arbeit. Sie sitzen in ihren Wohnungen, in ihren Autos, kommen vom Einkaufen, fahren nach Hause. Vielleicht wollen sie ins Kino, ins Theater, zum Sport. Vielleicht haben sie einen Termin, holen gerade die Kinder ab, wollen zu einer Veranstaltung. Ein einziges Gewusel, wie Ameisen sind sie stets ziel- und zweckgerichtet unterwegs.
Über 3,6 Millionen Menschen leben in Berlin, das sind über 4000 pro Quadratkilometer. Was für ein herrliches Durcheinander, was für ein erstaunliches Miteinander. Aber ist es das wirklich? Leben wir wirklich noch die Idee des Gemeinwesens, so wie es die verdichtenden Räume von Gemeinden, Landkreisen, Kommunen und Städten eigentlich verlangen – egal, wie vielstimmig und divers vor allem Letztere sich inzwischen entwickelt haben? Sind wir wirklich auch so verbunden, wie es uns das Internet, die sozialen Medien gern suggerieren? Sind wir die Community, die uns das World Wide Web so lieblich verheißt? Und bilden wir am Ende wirklich noch die Gesellschaft, wie sie in der Soziologie definiert ist: Sind wir eine durch unterschiedliche Merkmale zusammengefasste Anzahl von Personen, die als sozial Handelnde miteinander verknüpft leben und direkt oder indirekt sozial interagieren?
Oder sind uns die verbindenden Elemente eher abhandengekommen? Fehlen uns womöglich gemeinsame Themen? Sitzen wir in unterschiedlichen Blasen und findet jeder heute zunehmend in seiner eigenen, aus beinahe unendlichen Möglichkeiten zusammengebauten Biographie statt? Ist da letztlich eine längst überholte Idee des Gemeinwesens am Bröckeln? Ein Miteinander, das gerade auf tausendfach verzweigten Wegen auseinanderfällt?
Schon beim Essen – eigentlich Paradebeispiel für soziales Miteinander – sind Kategorien populär geworden, die mehr trennen als einen. Und oft sogar einen Dissens eröffnen. Auf der einen Seite stehen die Veganer und Vegetarier, auf der anderen die Fleischliebhaber und Genießer alter Schule, die dem Essen weiterhin unverändert frönen wollen. Allein die Vielzahl an kursierenden Sprüchen zeigt, dass hier Fronten entstanden sind. »War kurz davor, Veganer zu werden, habe gerade noch mal Schwein gehabt«, lautet einer davon. Ein nächster: »Wenn alle Tiere ausgestorben sind, dann fressen wir die Vegetarier!« Die andere Fraktion kontert auf ihre Weise, fragt die Fleischesser, was sie als Außenstehende zum Thema Intelligenz zu sagen haben.
Das Essen ist zur politischen Gesinnungsfrage geworden. Zum Etikett, ob einer zu den Guten gehört, die die Welt retten wollen, oder zu den Bösen, die sich um nichts scheren. Gräben sind entstanden, wo eigentlich doch alle an einem Tisch sitzen sollten – um sich in aller Gegensätzlichkeit zuzuprosten. Nach der Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten am 8. November 2016 boykottierten Tausende junge und progressive Demokraten vornehmlich aus den Großstädten die familiäre Einkehr zu Thanksgiving in den Staaten des Mittleren Westens. Mit Trump-Wählern an einem Tisch sitzen? Nein. Auch dann nicht, wenn es sich um Vater, Mutter, Onkel, Tante, die Großeltern handelt.
Weitaus krasser, komplexer und undurchschaubarer schreitet die Fragmentierung in den digitalen Welten voran. Die Werbung ist in hohem Maße personalisiert, heute bedient sie einen jeden ganz gezielt nach seinen individuellen Wünschen, Neigungen, Geschmäckern und Aktivitäten im Netz. In den sozialen Medien dürfen sich viele in abgekapselten Filterblasen wohlfühlen und in ihrer persönlichen Meinung bestätigt finden, während konträre Argumente und abweichende Standpunkte gar nicht mehr eingeblendet werden. Vielerorts sind die sozialen Medien zu Stammtischen geworden, nicht zu verbindenden Plattformen des sachlichen Austauschs.
Auf Diensten wie Instagram, Snapchat oder Tiktok kann sich jeder seine eigenen Bilderbuchwelten bauen, seine idiographischen Traumvorstellungen reibungslos und in Sekundenschnelle generieren. Diese Darbietungen sind zwar explizit zum Sharen gedacht, flitzen anschließend aber durch die digitalen Räume und können nie wieder zurückgeholt werden. Antastbar und diskutabel sind sie nur noch durch kurze Kommentarfunktionen, ein paar bunte Emojis. Geliked durch den erhobenen Daumen, gehatet durch den Shitstorm. Verhandelt während Begegnungen von Mensch zu Mensch werden Statements dieser Art so gut wie nicht mehr.
Man könnte es das Pippi-Langstrumpf-Syndrom nennen: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Nur dass Pippi Langstrumpf in der Villa Kunterbunt wohnte und nicht im vollvernetzten und durchglobalisierten dritten Millennium. Pippi war eine rotzopfige, freiheitsliebende, in doppelter Hinsicht starke und herrlich querdenkende Ausnahme. Eine kopfstehende junge Philanthropin, die ohne Eltern, dafür aber mit einem prallvollen Goldkoffer des Vaters über die Tische und durchs Leben tanzte. Die sich Piratenhüte aufsetzte, ein Pferd im Garten und einen Affen auf der Schulter hatte, die im Heißluftballon über den Dingen schwebte, auf die Schule und aufs Bravsein pfiff und sich die Welt wirklich machte, wie sie ihr gefiel. Ein Kniestrumpf grün, der andere knallorange.
Ein Sinnbild der Individualisierung, das heute in gewisser Weise zum Programm geworden ist. Zum gelebten Alltag von Milliarden.
Im Meer der Möglichkeiten können wir beliebig und beinahe grenzenlos auswählen und zugreifen. Können ordern und buchen, uns stylen und präsentieren, wie es uns gefällt: 24/7 und an beinahe jedem Ort der Welt. Wir können uns pinkfarbene Jeans bestellen und sie in der nächsten Sekunde gegen lilafarbene Highheels umtauschen. Handyhüllen stehen in Abermillionen Ausführungen zur Verfügung, elektronische Geräte in zahllosen Konfigurationen. Auch Alltagsgegenstände, Statussymbole und Produkte, die schon immer Teil der Selbstpositionierung und des persönlichen Ausdrucks waren, stehen heute in schier endloser Vielfalt und oft genug zum Schnäppchenpreis zur Verfügung. T-Shirts und Turnschuhe massenhaft, Möbel in unbegrenzten Mengen und Designs, Autos in zahllosen Ausführungen, Klassen und Finanzierungsrahmen. Selbst Reisen sind heute zu allen nur erdenklichen Destinationen zu haben, vom All-Inclusive-Urlaub auf Gran Canaria bis zum maßgeschneiderten Erlebnistrip zu den Goldschopfpinguinen der Antarktis. Die Welt der Waren und Angebote ist zum Manifest der Individualisierung geworden. Der Soziologe und Psychologe Harald Welzer fasst das heute existierende Universum der Möglichkeiten so zusammen: »Alles immer, immer alles.«
Die gepriesene Individualisierung aber bringt per definitionem eine tückische Eigenschaft mit sich. Das Wort Individuum nämlich steht für eine Entität, die sich nicht mehr weiter teilen lässt. Der Ursprung stammt aus dem Lateinischen: individere – nicht teilbar. Und so steht eigentlich das Gegenteil der Individualisierung für jene womöglich zu diskutierende Daseinsform, die vielmehr dieses Wort beschreibt. Dividuum: das Teilbare. Das, was wir halbieren, dritteln, vierteln können. Das, was zu Schnittstellen führt und uns in einem Boot mit anderen sitzen lässt. Kurzum: Nicht die Individualisierung steht für die Idee einer Gemeinschaft und Gesellschaft – sondern ihr Antonym.
Wie aber können die Einheiten in der Vielheit funktionieren? Ja, wie ticken die Menschen in der Gesellschaft? Nun, aufs Hier und Heute des digitalen Zeitalters gemünzt, ließe es sich wohl so ausdrücken: Das moderne, vernetzte Wesen bewegt sich nach Belieben durch den Ozean des Überflusses. Es kann wählen zwischen unendlich vielen Angeboten, kann sich das Leben aus einem fast unerschöpflichen Kosmos von Informationen, Meinungen und Botschaften, aus einem Füllhorn ungezählter Träume, Apps und Waren komponieren.
Das Pippi-Langstrumpf-Syndrom 3.0: Wir alle machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Jeder für sich. Jeder allein für sich. Jeder in seiner eigenen kleinen Raumkapsel.
Der Publizist Ulf Poschardt schreibt in seinem Buch Mündig von der »zentralen Subjektverfasstheit«, mit der der Mensch durch die modernen Zeiten taumelt. Durch eine Zeit, »in der alles möglich ist, das Unmögliche kommt und alle auf eine magische Art mit allem überfordert sind«.
Wenn im Zustand dieser heiteren Reizüberflutung allein in Deutschland weit mehr als zehn Millionen Menschen von sich selbst sagen, sie würden sich oft oder dauerhaft »einsam« fühlen – müssten wir dann nicht eher einen anderen Begriff wählen, um das Phänomen zu beschreiben? Ein Wort, das diesen Zustand präziser greift? Das Bild des haltlos auseinanderindividualisierten Menschen, der als ebensolcher am Ende ziemlich allein dasteht?
Oder besser: Vereinzelt.
Ausgerechnet die lieben Handys, ersonnen als ultimative Verbindungsautomaten, sind in diesem Prozess zu alternativlosen Katalysatoren geworden: Zu Vereinzelungsapparaten erster Güte. Und wir alle sind jeden Tag Zeuge davon – meist selbst als emsige Nutzer. Die Menschen laufen mit ihren Smartphones über die Straßen, sitzen und stehen in den U-Bahnen vor ihren Geräten, zücken das Mobiltelefon beim Fußballspiel, schreiben Messages während der Besprechung, wischen im Flugzeug noch kurz vor dem Pushback über die letzten Nachrichten. Und der genervte Blick ist inzwischen sogar beim Abendessen am Familientisch zur unabwendbaren Zutat geworden: »Jetzt leg doch endlich mal das Handy weg, Mensch!«
Denn der Mensch klebt am Handy. Das Handy klebt am Menschen. Längst sind beide zusammengewachsen.
Die Computer, besonders in ihrer omnipräsenten Ausprägung als Smartphones, führen uns das Phänomen der Vereinzelung so radikal vor Augen wie kaum etwas anderes. Allüberall ist es zu beobachten: In den Büros und Restaurants, in Bussen und Bahnen, abends im Restaurant und sogar noch auf Konzerten, wo eigentlich alle gemeinsam den Auftritt genießen wollen. Das Telefon ist stets zur Hand, die Bildschirmzeit zur festen Größe geworden. Vor kurzem habe ich eine Mutter neben ihrem Kinderwagen gesehen, in dem ihr Baby lag. Sie stand auf der Straße und telefonierte, aus dem Kinderwagen schimmerte ein bläuliches Licht. Mutter und Kind im Bann des allmächtigen Schirms – jeder für sich.
Eine befreundete Lehrerin erzählte mir neulich von einer Variante dieser Auseinanderdrift. In der Pause kam ein Schüler zu ihr gelaufen und heulte: »Leon will gar nicht mehr mit mir spielen, er spielt nur noch mit seinem Handy!«
Solche und ähnliche Szenen haben sich längst zu einem Sinnbild der kollektiven Vereinzelung verdichtet. Mit einem Fingerwisch landet jeder in seiner Welt, surft ein jeder durch seine persönlichen Universen, auch wenn er gerade Teil einer Masse ist, Mitglied einer mehr oder minder eng zusammengehörigen Gemeinschaft. Die allgegenwärtigen neuen Technologien machen es möglich: Wir sind im Hier und Jetzt – und doch oft ganz woanders. Sind Teil einer Menge – und doch meist ganz bei uns. Sind im Plural eingebunden – und doch dem Singular verbunden.
»Connectivity« lautet das Schlüsselwort dieser allgegenwärtigen Vernetzung. Und dabei sei zumindest die Frage erlaubt: Sind wir am Ende nicht trotz, sondern vielleicht gerade wegen dieser Verknüpfungsorgien gleichzeitig das, was ja auch das Wort »gemeinsam« bereits in sich birgt: Einsam?
Ein plakatives Beispiel dieser Art der Vereinzelung erlebte ich in einem Internetcafé in Asien. Weit über 20 Kinder und Teenager saßen dichtgedrängt in dem dunklen, heißen Raum, kaum einer älter als zwölf, dreizehn Jahre. Die Jugendlichen saßen Ellenbogen an Ellenbogen, doch ein jeder war fixiert auf seinen Bildschirm, ein jeder versunken in das Computerspiel vor seinen Augen. Auf den Screens schritten Maschinenwesen durch künstliche Welten, während draußen die Palmen der Insel im Wind standen, am Steg die Fischer festmachten und die Erwachsenen und älteren Menschen auf niedrigen Plastikstühlen vor den Garküchen saßen. Doch auch sie und sogar viele der Fischer blickten auf ihre Geräte, denn fast jeder hielt ein Smartphone in der Hand.
Es wirkte grotesk. Der Mensch mitten im tropischen, bunten Gewimmel Asiens – ein jeder davongeflogen in seine eigene Welt.
Und mitten im Gewusel saß der Staat auf zwei Klappstühlen. Zwei Polizisten in Uniform, Rücken an Rücken, ein jeder absorbiert von seinem kleinen Phone, das er in Händen hielt.
Es ist erstaunlich und klingt paradox. Doch trotz nie dagewesener Möglichkeiten der Kommunikation, trotz immer neuer Kanäle des rasenden Austauschs scheint das vermeintliche Miteinander zunehmend zu einem systematischen Auseinander zu führen. Als ob uns im Beliebigen das Verbindende und Verbindliche abhanden kommt – zumindest jene Versionen davon, an die wir uns bisher geklammert haben.
Zu beobachten sind dabei nicht nur altbekannte Bruchstellen, sondern tausend neue Haarrisse, die das Ganze kreuz und quer zerschnippeln. Statt der Zusammenführung, so könnte man den Eindruck gewinnen, lässt sich vielerorts eine Fragmentierung feststellen, statt der Gemeinsamkeit zudem eine voranschreitende Polarisierung. Die in letzter Zeit öfter und vehementer stattfindenden Demonstrationen sind ein weiteres Zeichen. Pegida. Fridays for Future. Märsche gegen Rechts. Die Gelbwesten in Frankreich. Die Separatisten in Spanien. Die Corona-Demos. Oft genug sind es hitzige Kundgebungen, Proteste, die in Ausschreitungen münden. Neu aber ist etwas anderes: Denn vor allem in letzter Zeit führt die Spaltung keineswegs mehr nur durch die weite Gesellschaft, sondern bricht sich Bahn bis hinein in enge Bekanntenkreise, Freundeskreise, Familien.
Beim Thema Klimawandel sind es heute die eigenen Kinder, die den Eltern die Leviten lesen und gegenüber Mama und Papa nicht nur einen emanzipierten und mündigen, sondern vor allem völlig konträren Standpunkt einnehmen. Auch hier hat sich eine Kluft aufgetan, die es bisher nicht gab: Eine weltweite Generation von Teenagern hält den Erwachsenen vor, versagt zu haben und weiter zu versagen.
Auch die Corona-Krise hat Differenzen zutage gefördert, von denen viele bisher gar nicht wussten, dass sie existieren. Da standen sich Kollegen, alteingeschworene Freunde und sogar Familienmitglieder auf einmal stirnrunzelnd gegenüber. Die einen glaubten an eine vielfach im Internet verabreichte Deutung der Pandemie, nannten die anderen systemtreue Lemminge. Die wiederum titulierten die anderen als Verschwörungserzähler und hielten sie für Dumpfbacken. Im Nu hatten sich diverse Lager gebildet. Denn Corona trennte schlagartig nicht nur Alte und Junge voneinander, Kranke und Gesunde, systemrelevante und systemirrelevante Menschen. Das Virus trieb Keile auch zwischen alte Verbündete – die sich plötzlich wie Gläubige und Ungläubige gegenüberstanden.
Und oft nur noch wütend schwiegen.
Ist aus einem Austausch am Ende nicht nur Konfrontation geworden, sondern eine Form der stillen Abwendung? Zerbröselt da durch ein konfuses Gemisch Tausender Faktoren womöglich gerade ein größeres Wir und mündet in eine immer feinere Zersplitterung, die bei vielen längst zu einer unbemerkten Vereinzelung geführt hat? Zu einer Art der Vereinsamung, die inzwischen immerhin 14 Millionen Deutsche spätestens dann einräumen, wenn sie gezielt danach gefragt werden?
Man muss nicht lange suchen, um diese einsamen Menschen im Alltag zu finden. Sie leben auf dem Land, in der Stadt. Sie fristen ihr Dasein in der Wohnung nebenan, gehen über die Straßen, sitzen in der U-Bahn. Normalerweise offenbart sich die Einsamkeit der Menschen nicht, wird kaschiert durch die vermeintliche Normalität. Doch wer genau hinschaut, wer nachfragt und zuhört, der wird feststellen: Das nuancierte Phänomen der Einsamkeit ist überall anzutreffen. Bei Menschen fast jeden Alters, unter Menschen fast jeder Einkommensgruppe, bei Deutschen wie Migranten.
Insbesondere ältere Menschen sind betroffen. Ärzte berichten davon, dass immer mehr Senioren sich mit akuten Beschwerden melden und einen schnellen Termin wünschen. Sie kommen in die Praxen, klaglos bereit, zwei, drei oder mehr Stunden im Wartezimmer zu sitzen. Einmal im Sprechzimmer beim Arzt, sind die Beschwerden auf einmal »halb so schlimm« oder »so gut wie verflogen«. Grund: Die älteren Damen und Herren suchten einfach nur Gesellschaft. Denn sie wollen unter Menschen, wollen sich unterhalten – und im Wartezimmer können sie dies tun, ohne sich gleich als einsame Seelen zu outen.
Danach aber gehen sie wieder nach Hause. Kaum fällt die Tür ins Schloss, sind sie allein mit sich in den eigenen vier Wänden. Stille, Schweigen. Es bleibt ein Buch, ein Rätselheft. Die Berieselung durchs Fernsehen, durchs Radio. Denn viele ältere Menschen besitzen keinen Computer, sind online nicht vernetzt. Und sie müssen sich allein schon darum ausgeschlossen fühlen, weil sie es von allen Seiten hören und mitbekommen, dass die digitale Welt größer und größer wird – ohne dass sie jedoch Teil von ihr werden.
Wie vielen mag es so ergehen? Tausenden? Hunderttausenden? Womöglich sogar Millionen älteren Mitbürgern?
Das Einsamkeitssyndrom äußert sich an noch vielen anderen Stellen sehr konkret. Gemeinden müssen Verstorbene immer öfter auf amtliche Weisung hin beerdigen, weil keine Angehörigen aufzufinden sind, die sich der Formalitäten annehmen. Häufig sind es beim letzten Gang allein die Friedhofsangestellten, die einen Toten zu Grabe tragen.
Denn da ist sonst niemand.
Wie steht es mit den Suppenküchen, mit den Kirchen? Wie viele Menschen kommen hierher, um etwas zu essen, um Trost zu erhalten – und wie viele sind es, die auch hier schlicht Gesellschaft suchen? Die nur unter Menschen sein wollen, damit sie reden, sich austauschen und ihre Sorgen teilen können? Erhebungen gibt es hierzu noch nicht. Doch wer mit Pastoren und Sozialarbeitern spricht, erfährt es auch von ihnen: Viele Menschen kommen zu ihnen, um für ein, zwei Stunden nicht so einsam zu sein.
Aus aktuellen Statistiken geht hervor, dass immer mehr Menschen in Singlehaushalten leben. Laut Statista lebten 2019 in Deutschland über 17,5 Millionen Menschen in einem Einpersonenhaushalt – mehr als je zuvor. Sicher, viele leben bewusst ohne Partner, ohne Mitbewohner, und fühlen sich wohl dabei. Allerdings: Rund 30 Prozent der Singles sind laut Statistischem Bundesamt von Armut gefährdet – und dürften ihre Zeit oftmals eher notgedrungen allein daheim verbringen. Der Gang ins Theater, der Besuch im Kino ist ihnen verwehrt, vom vergnüglichen Einkaufsbummel oder gar einer Reise ganz zu schweigen.
Das Gefühl der Einsamkeit dürfte sich bei ihnen oft nur verstärken: Weil sie umgeben sind von Menschen, denen es nicht so geht. Menschen, die Familie haben, Freunde, Partner, Jobs. Menschen, die mehr Geld haben, sich mehr leisten können. Aber sind dies dann noch Mitmenschen im besten Sinne dieses Wortes? Menschen, mit denen man in einer Gemeinschaft lebt? Oder zieht sich hier ein weiterer Riss durchs Gemenge? Bis die Mitmenschen nicht mehr die Mitmenschen sind, sondern die »Anderen«? Der Psychotherapeut Mazda Adli drückt es so aus: »Einsam fühlt man sich nur unter Menschen.«
Von »sozialer Einsamkeit« und »sozialen Ausschlussverfahren« sprechen Psychiater und Psychotherapeuten inzwischen. Sie stellen bei ihrer täglichen Arbeit fest, dass hinter vielen Depressionen, Angstzuständen und anderen seelischen Leiden in Wirklichkeit Einsamkeit als Auslöser steckt. Oder sich zumindest als ein gewichtiger Faktor im Geflecht der Ursachen herausstellt. Doch auch weitaus profanere Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass traute Mehrsamkeit nicht gerade auf dem Vormarsch ist. Zumindest nicht unter dem Menschen und seinesgleichen.
In immer mehr deutschen Haushalten leben Haustiere, und jedes Jahr werden es mehr. Inzwischen leben 34 Millionen Hunde, Katzen, Hamster und andere Tiere in unseren Wohnungen und Häusern. Viele Familien mit Kindern besitzen Haustiere, doch wie die Seite Forschung und Wissen berichtet, werden Tiere auch in Single-Haushalten zunehmend beliebter, wo sie »häufig die Rolle des Sozialpartners einnehmen«. Die größte Gruppe an Haustierbesitzern bilden in Deutschland mit 26 Prozent allerdings die Personen, die älter als 60 Jahre sind. Je älter der Mensch, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er sich einen tierischen Gefährten anschafft.
Doch nicht nur alte Menschen, sondern auch immer mehr jüngere Frauen und Männer scheinen das Gefühl einer Isolierung zu verspüren. Welche Rolle die so langsam in sämtliche Ritzen sickernde Digitalisierung dabei spielt und zu welchen Ausprägungen des Einsamseins sie führen kann, ist noch wenig erforscht. Doch schon jetzt werden nicht nur Teenager, sondern Millionen Kinder damit groß, mehr Zeit mit ihrem Smartphone oder vor dem Computer zu verbringen als mit Gleichaltrigen beim Toben im Park. Inzwischen sind es ganze Generationen, die zentrale Begriffe wie »soziales Miteinander«, »Freundschaft« und »Kommunikation« völlig neu definieren. Und entsprechend agieren. Das Miteinander findet in sozialen Medien statt, Freunde sind zu Friends geworden sind, Fans zu Followern, beides numerisch exakt protokolliert. Statt ein gesprochenes »Gut gemacht« oder »Finde ich toll« senden wir Likes, nutzen Chats und Messages und schleudern aberwitzige Mengen von Fotos durch die Weltgeschichte. Laut statistischen Angaben hat die Menschheit 2015 erstmals mehr als 1000 Milliarden Fotos geschossen, die meisten davon mit dem Handy. Inzwischen sind wir bei weit über einer Billion Schnappschüssen pro Jahr gelandet. Laut Statista und Brandwatch werden auf Facebook um die 350 Millionen Fotos pro Tag hochgeladen. Instagram hat im Juni 2018 die Marke von monatlich einer Milliarde Nutzern erreicht, die fast ausschließlich Fotos teilen. Fotos, die hier jeden Tag 3,5 Milliarden Likes erhalten.
Pixel statt Worte. Bilder statt Sätze. Momentaufnahmen sind zum Kommunikationsmittel der Wahl geworden, das Schnelle und Ephemere zum Vokabular des Austauschs. Wohin das alles führen und was es auch mit dem Phänomen der Vereinsamung anstellen könnte – niemand kann es abschätzen.
Doch nicht nur die digitalen Wunderwelten dürften einen Einfluss darauf haben, ob und in welchem Ausmaß wir Einsamkeit verspüren. Auch die analogen Sphären des echten Lebens ändern sich rasant und rühren längst an Grundsätzlichem. Vor allem viele jüngere Menschen finden sich nach der Schule, während der Ausbildung und schließlich im frühen Berufsleben in einer Epoche der hocheffizienten Unverbindlichkeit und als Sklaven eines Flexibilitätsregimes wieder.
Studien zufolge pendelt eine globale junge Generation immer öfter zwischen Hochschulen und Familie hin und her, hetzt von einem unbezahlten Praktikum zum nächsten, von WG zu WG, von einem Studienort zum anderen. Inzwischen gibt es im Englischen den feststehenden Begriff »student migration«. Und laut dem »Migration Data Portal« nimmt die Zahl der »international mobilen Studenten« mit einem »non-resident visa« stetig zu, so auch die Zahl der Destinationen, wo sie studieren.
Auch nach der Ausbildung winkt oft nur ein Leben mit befristeten Jobs, ohne Festanstellung, ohne längerfristigen Wohnsitz. Und somit auch ohne große Chance, solide Bindungen aufzubauen, wie wir sie bisher kannten. Auch der Begriff der »Kettenbefristung« hat sich darum längst etabliert. Ebenso die Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, für ihre Mandanten zu klagen, wenn deren Arbeitsverträge über Jahre immer nur kurz verlängert werden. Jeder zwölfte Arbeitnehmer in Deutschland hat laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aktuell einen befristeten Arbeitsvertrag, Auszubildende nicht mitgerechnet. Das sind 3,15 Millionen Menschen.
Bekannt wurde ein Fall, der vor dem Bundesarbeitsgericht landete. Eine Arbeitnehmerin war nach ihrer Ausbildung über mehr als elf Jahre hinweg nur auf Zeit beschäftigt. Sie hatte am Ende dreizehn befristete Arbeitsverträge hintereinander unterschrieben, was vom Arbeitsgericht schließlich als unzulässig erklärt wurde. Eine Kanzlei für Arbeitsrecht schrieb: »Eine Kettenbefristung kann Missbrauch sein.«
Angestellte wie Freiberufler sollen zudem immer flexibler arbeiten, ohne Anspruch auf einen festen Standort. Mehr noch: Der Jobwechsel wird – ebenso wie der (oft grenzüberschreitende) Wohnortwechsel – sogar zum Leistungsmerkmal. Agilität ist das Stichwort. Auch hier sind weniger soziale Kontakte eine logische Folge. Hinzu kommt die Digitalisierung vieler Arbeitsplätze, die Automatisierung zahlreicher Produktionsabläufe.
Der moderne Mensch wird dabei kaum zu einem modernen Wanderer. Zu einem, der aufbricht, eine bestimmte Wegstrecke bewältigt, um anschließend an einem Ziel anzukommen. Er wird vielmehr zu einem austauschbaren Pixel, zu einem beschleunigten Einzelteilchen, das wie ein Bit durch die Weltenbahnen rast.
Einen treffenden Begriff für das moderne Individuum dieser Machart haben wir längst verinnerlicht. Den digital nomad kennen wir, an den digital loner sollten wir uns gewöhnen.
Viele bekommen die Folgen dieser flott getakteten Welt zu spüren. Rebecca Nowland von der University of Central Lancashire beschäftigt sich mit den Ursachen und Gefahren von Einsamkeit und kommt zu dem Schluss, dass gerade die 20- bis 30-Jährigen ein Problem haben. In einem Interview mit der Zeit sagt sie: »Ich nenne es das Bridget-Jones-Phänomen: Nach einem Tag voller Arbeit, Meetings oder Seminaren kommt man nach Hause und merkt plötzlich, wie einen die Einsamkeit überkommt. Tagsüber war das vielleicht nicht so spürbar. Aber jetzt sitzt man allein im Zimmer und merkt, dass man niemanden hat, den man anrufen kann.«
Oder, besser, neuer, zeitgemäßer: Da sind auf einmal zu viele, die man anrufen oder anchatten könnte.
Es gibt noch eine weitere verbreitete Variante der Vereinzelung. Besonders in Deutschland, wo nach Scheidung oder Familienbruch mehr Männer als Frauen das Los des Entkoppelten trifft. Studien zufolge sind es vor allem Männer, die sich nach Trennungen aus dem gemeinsamen Freundeskreis zurückziehen. Die das Scheitern vertuschen, indem sie sich auch unter Arbeitskollegen rarmachen, sich abkapseln oder gar bewusst lügen. Denn so unterschiedlich und weitgreifend das Syndrom der Einsamkeit ist: Es ist nicht sexy, sondern irgendwie peinlich, weil es soziale Inkompetenz signalisiert.
Einsamkeit wird darum oft auch noch von einem Schneeballeffekt begleitet, bei Jung und Alt. Wer einsam ist, der gibt es nicht gern zu. Man zieht sich zurück – und wird noch einsamer. Weiterer Nebeneffekt: Weil viele es nicht zugeben, auch nicht in Erhebungen und Umfragen, dürfte die Dunkelziffer der Einsamen enorm hoch sein.
Auch ein Mitarbeiter der Telefonseelsorge im niedersächsischen Stade berichtet, dass die Anrufe in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Zu viert sitzen sie dort in einem kleinen Raum vor den Telefonen, oft sind die Leitungen den ganzen Tag belegt. Die Telefonseelsorger berichten von einer starken Diversifizierung der Anrufer: »Es rufen inzwischen Menschen fast jeden Alters an, vor allem aber 30- bis 45-Jährige haben wir immer öfter an der Strippe«, sagt einer der Mitarbeiter, der seit vielen Jahren hier arbeitet. Inzwischen würde er das ganze Kaleidoskop an Fällen am Apparat haben.
Die Menschen würden meist ins Stammeln geraten, wenn die Seelsorger sie nach dem Grund für ihre Sorgen fragen. Oft sprechen die Betroffenen von Depressionen, von Schwermut, wissen jedoch meist selbst nicht genauer um die Ursache ihrer misslichen Lage. Dabei würden die meisten letztlich unter einer Form der Kontaktarmut leiden, die im Laufe fast jeden Gesprächs irgendwann so zum Ausdruck kommt: »Ich habe sonst niemanden zum Reden.«
Ein folgenschwerer Satz. Nicht nur, weil eine Tristesse in ihm anklingt, sondern weil der unter ihm schlummernde Seelenzustand tatsächlich krank macht. »Wenn wir uns von anderen Menschen fernhalten, setzen wir uns enormen Risiken aus«, sagt der amerikanische Neurowissenschaftler James Coan. Wer einsam sei, würde öfter krank, Wunden würden schlechter heilen, das Immunsystem leiden. Auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Depressionen steige, zudem würde man eher dement, man sterbe früher.
»Soziale Isolation tötet«, sagt Coan. »Das ist eine Tatsache.«
Sind Krankheiten wie Bluthochdruck, Herzattacken oder auch Schlaganfälle also keineswegs nur auf konkrete Ursachen zurückzuführen, sondern können sie auch durch Einsamkeit ausgelöst werden? Zu diesem Schluss kommt zumindest die Psychologin Julianne Holt-Lunstad von der Brigham Young University in Utah. Sie fasste die Aussagen von 3,4 Millionen Menschen sowie 70 verschiedene Studien zu einer Metaanalyse zusammen. Das Ergebnis: Die Sterbewahrscheinlichkeit stieg um 26 Prozent bei subjektiv empfundener Einsamkeit, um 29 Prozent bei objektiv beschreibbarer menschenvermeidender Einstellung und sogar um 32 Prozent, wenn die Teilnehmer allein lebten.
Dass Einsamkeit tatsächlich krank macht, zeigen Experimente. Im März 2020 wiesen Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology in Cambridge nach, dass Einsamkeit Empfindungen auslöst, die mit Hunger vergleichbar sind. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Nähe zu anderen Menschen ein so fundamentales Bedürfnis ist wie Essen. Vor allem eine unfreiwillige Isolation löst im Körper anscheinend eine regelrechte Stressreaktion aus, die dem Betroffenen signalisiert, dass ihm Lebenswichtiges fehlt. Und dieses Hungern nach Gesellschaft kann chronisch werden.
Andere Versuche haben hingegen gezeigt, wie Nähe lindern kann, dass schon Händchenhalten wie Balsam auf uns wirkt. Probanden in einem Hirnscanner wurden dafür Elektroschocks verabreicht. Ein Teil der Gruppe musste die Traktierungen allein ertragen, andere durften die Hand eines Fremden halten, die nächsten die Hand des Partners. Die Resultate waren eindeutig. Wer mit einer vertrauten Person Hand in Hand stand, litt statistisch gesehen am wenigsten. Die Berührung wirkte offenbar wie ein Schmerzmittel, denn die Hirnregionen, die bei Gefahr aktiviert werden, reagierten bei den händchenhaltenden Pärchen deutlich weniger. Der Hirnforscher James Coan erklärt das Phänomen so: »Wenn wir uns einem anderen Menschen anvertrauen, muss sich unser Gehirn weniger anstrengen. Und je mehr wir es auf diese Weise entlasten, desto besser sind wir vor psychischen und auch physischen Krankheiten geschützt.«
In der Gesamtschau fügen sich diese Beobachtungen letztlich zu einem besorgniserregenden, wenn nicht gar bedrohlichen Bild. Denn wenn Einsamkeit tatsächlich krank macht, wenn verschiedenste Formen der Vereinzelung inzwischen weite Teile unserer Gesellschaft erfasst haben und diese Gesellschaft obendrein immer älter wird, dann dürfte das Problem zunehmend auch Auswirkungen auf die Wirtschaft und unsere Gesundheitssysteme haben. Und somit unweigerlich zum Politikum werden.
In anderen Ländern stellt man sich dieser Aufgabe bereits. In England wurde ein Ministerium für Einsamkeit gegründet, um die vereinsamende Gesellschaft besser zu verstehen und ihr gezielt zu begegnen. Die von der ehemaligen Premierministerin Theresa May ins neue Amt berufene erste Ministerin für Einsamkeit, Tracey Crouch, begründet den Schritt so: »Einsamkeit ist eine reale und diagnostizierbare Geißel.«
Die Folgen fallen schon jetzt dramatisch aus. Durch den demographischen Wandel nimmt die Vereinzelung unter alten Menschen ständig weiter zu. In den westlichen Industriegesellschaften ist dies bereits als einer der traurigen Gigatrends der nahen Zukunft ausgemacht worden.
Auch die zunehmende Migration wird zu einer weiteren Form der Vereinsamung führen beziehungsweise hat dies längst getan. Migranten – vor allem jene der zweiten Generation – fühlen sich oft besonders ausgeschlossen. Sie sind in Deutschland geboren oder hier aufgewachsen, empfinden jedoch weder das Geburtsland ihrer Eltern noch Deutschland wirklich als ihr Zuhause. Der allseits zu vernehmende Ruf nach Integration bestätigt dies. Weil genau das Gegenteil weit verbreitete Realität ist: Die Desintegration. Und sie ist nur eine weitere Facette der Einsamkeit. Die Heimatlosigkeit.
Doch egal, ob wir von kultureller Ausgrenzung sprechen, von Kontaktarmut, Isolierung, Verlassenheit oder sozialer Disruption: Die Vereinsamung wird gerade zu einem gesamtgesellschaftlichen Riesenthema.
Vielleicht ist man in den Megametropolen Asiens schon viel weiter. Dort haben die Auswüchse der Vereinsamung längst bizarre – oder sollten wir sagen: moderne? – Züge angenommen. In Japan und China können sich einsame Geister zu Weihnachten in Familien einmieten, sich zum Geburtstag Gesellschaft ins Haus buchen. Fremde, die zu bezahlten Freunden werden.
In Japan boomt das sogenannte Rent-a-friend-Business. Diverse Agenturen haben ausgebildete Schauspieler angestellt, die auf Wunsch und für hohe Gagen als Ehemann einspringen, als Statisten auf der Hochzeit, als Kumpelersatz beim Sushi-Abend. Der 36-jährige Japaner Ishii Yuichi gründete schon vor zehn Jahren die Firma Family Romance und spürte schnell, dass der Bedarf nach menschlicher Lückenfüllung nicht nur vorhanden war, sondern stetig stieg. Yuichi selbst spielte für jüngere Menschen schon den Vater, mimte bei Beerdigungen ein trauerndes Familienmitglied, weil das echte nicht existierte oder nicht zur Verfügung stand. Inzwischen sind um die 800 Laiendarsteller und Profischauspieler bei ihm unter Vertrag, darunter Kleinkinder und ältere Menschen, die als Familien-, Verwandten- oder Freundesersatz im Angebot sind.
Die Agentur wirbt damit, für fast jede Lebenssituation einen passenden Menschen liefern zu können, und Ishii Yuichi glaubt fest daran, dass diese Sozial-Surrogate dabei helfen, Absenzen zu ertragen, fehlendes Seelengut gezielt zu ersetzen. Seinem Geschäft prognostiziert er eine blühende Zukunft. Laut Yuichi soll, wie in The Atlantic zu lesen ist, die »menschliche Interaktion à la carte« schon bald zur Norm werden.
In Anbetracht solcher Entwicklungen mutet es naiv an, sich noch über Petitessen wie Verschwörungserzählungen oder Fake News zu echauffieren. In Fernost hat längst das Zeitalter der Fake Friends und Fake Family begonnen, denn im hoch technologisierten und mit fast 130 Millionen Menschen dicht bevölkerten Japan ist loneliness zum Ist-Zustand geworden.
Über 15 Prozent der Japaner geben an, sie hätten außerhalb der Familie überhaupt keinen sozialen Austausch mehr. Und ebenfalls 15 Prozent der älteren Männer, von denen einige Millionen allein leben, sagen, sie würden in einem Zeitraum von zwei Wochen weniger als eine Konversation führen. In Japan spricht man von einer neuen Form des Schweigens. Von einem Ausmaß an Stille und Wortlosigkeit, das heute nicht mehr für Tugenden steht, sondern für die Ausbreitung der gesellschaftlichen Isolierung – der man mit entsprechenden Methoden jedoch längst beikommt. Und in der man in Windeseile wirtschaftliches Potenzial erkannt hat.
Als eine Form der zivilisatorischen Entwicklung mögen es die einen betrachten, als menschliche Verarmung andere. Beide Fraktionen aber dürften zu dem selben Schluss gelangen, dass ein Homo singularis den Zustand verschärfter Vereinzelung irgendwann irgendwie kompensieren muss. Durch Krankheit. Durch Sucht. Durch Macht. Durch einen Anruf bei der Telefonseelsorge oder eben durch Placebos. Oder durch käuflich zu erwerbende Sozialstrukturen, bislang wahrscheinlich die progressivste Lösung, um menschliche Nähe wieder herbeizuzüchten.
Wächst das Phänomen insgesamt weiter an, dürften die Auswirkungen so unabsehbar wie gravierend ausfallen. Was geschieht, wenn sich nicht nur in Europa zehn, zwanzig, dreißig, sondern am Ende Hunderte Millionen von Menschen auf der ganzen Welt einsam fühlen? In welche Richtung fliegen wir, wenn die Zäsuren immer filigraner ausfallen und das Gemeinwesen zersieben? Wenn der Bürger zu einem abgenabelten Argonauten wird, der in seiner Raumkapsel durch die Neerströme der Moderne irrt? Wenn sogar Randgruppen zu Randpersonen zerfallen?
Einige der Effekte bekommen wir bereits zu spüren: Nichtsolidarität, Misstrauen, Fremdenfeindlichkeit, Neidkultur, Abstiegsängste. Angestachelt durch Globalisierung und Digitalisierung, gespeist durch eine unmündige Individualisierung führt die versammelte Vereinsamung letztlich zu noch viel drastischeren Auswirkungen: Zu einer politischen Radikalisierung, zum Erodieren der Demokratie.
Spätestens dann wird Einsamkeit zur Gefahr. Zum Symptom wie gleichermaßen zur Ursache einer segmentierten und sich weiter segmentierenden Gesellschaft. Der afroamerikanische Historiker Eddie Glaude beschreibt es im Fall der USA. Nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd, der in Minnesota unter dem Knie eines Polizisten starb, sagte Glaude: »Unser System hat eine enorme Ungleichheit hervorgebracht, hat uns alle zu selbstsüchtigen Menschen gemacht, die sich nur um Wettbewerb und Rivalität kümmern, es hat den Begriff des Gemeinwohls vernichtet und den Sinn eines sozialen Sicherheitsnetzes zerrissen.«
Im kranksten Fall gehen aus einer solchen Segmentierung Amokläufer, Todesschützen und Selbstmordattentäter hervor. Das Ende brutaler Vereinzelungsspiralen, deren Zeuge die Welt in letzter Zeit immer öfter wurde. Bei den Massenerschießungen und Attentaten in den vergangenen zehn Jahren lagen oberflächlich zwar jeweils unterschiedliche Beweggründe vor, ein Motiv aber war immer das gleiche: Die Täter waren einsam, litten unter »social rejection«. Das jedenfalls besagt eine Studie des Psychologen und Neurowissenschaftlers Mark Leary aus Florida, die in dem Magazin Cicero besprochen wird, wo der Autor zu dem Schluss kommt: »Was sind diese Taten anderes als grausame Schreie nach Aufmerksamkeit, verbreitet auf und befeuert von den neuen Medien?«
Schreie nach Aufmerksamkeit. Vielleicht das letzte Stadium krankhafter Einsamkeit.
Es ist schwer, die tiefen Gründe für die Zerfaserung der Gesellschaft zu verstehen. Intellektuelle und Vordenker haben ihre Gravimeter jedoch aktiviert. Und die seismischen Wellen, die sie empfangen, stammen in ernstzunehmender Übereinkunft aus jenen Regionen, die wir getrost als die systemischen Absiedelungen des Kapitalismus bezeichnen können.
Mit schwindelerregender Verve sind Flexibilität und Agilität zu den Gewinnerfähigkeiten deklariert worden, derweil Verwurzelung und Verbindlichkeit die Opfergestalten produzieren. Die Ausgestelltheit des konsumfordernden wie konsumtreibenden Menschen lässt nun einmal wenig Spielraum für träge Strukturen. Jede Festlegung gerät zum Nachteil, jedes Bindungsversprechen führt zum Stottern im Getriebe. Der vollwertig performende Zeitgenosse ist darum am besten aus Elasthan: Er muss dehnbar sein, beweglich und alternativgeil. Seine Bestimmung liegt im Suchen, nicht im Finden. Ein kulturelles wie historisches Gedächtnis ist ihm im Zuge dieser Mobilmachung abhanden gekommen, eine daraus resultierende Verantwortung niemals begreifbar geworden.
Eine Abgeschnittenheit, die schwerwiegende Folgen hat. Denn es stürzen gerade Brücken ein zwischen den Generationen: Ein Todesbeil für jede moralisch und rituell verbundene Gemeinschaft. Die Forderungen von Kapital und Konsum aber sind verlässlich resolut. Entdecke die Möglichkeiten. Play on. Just do it.
Entsprechend emsig folgen wir dem Ruf, der das eigentlich Traurige zum Ideal erkoren hat. Ein kollektiver Imperativ, dem wir besinnungslos applaudieren. Das Alleinstellungsmerkmal ist nicht mehr nur Maß der Wirtschaft, sondern längst auch das des Menschen. Bis es inzwischen jeder sein will: Einsame Spitze.
Doch die Demokratie und ein funktionierender Staat leben zu weiten Teilen vom exakten Gegenteil dieser Losung: Keine durch rücksichtslose Performance zerstückelte Gesellschaft ist gefragt, sondern ein ständig wachsendes Gemeinwesen aus verschiedenen Milieus und Altersgruppen, aus mündigen und offen verlinkten Individuen. Bürgern, die in ihren Raumkapseln zwar eigene Wege fliegen, aber über intakte Kommunikationsgerätschaften verfügen. Im besten Fall über durchlässige Membranen, die zum allesentscheidenden Instrument werden. Zur Möglichkeit der Begegnung, zur Fähigkeit des Austauschs. Zum Ankoppeln, nicht zum Auseinanderdriften.
Es wäre nun ein Leichtes, eine derart zerfallende Welt allein als gesellschaftsfeindliche Dystopie zu begreifen. Die Staatengemeinschaften als Flickenteppiche der Separatisten und Radikalen zu beschwören, sich die wachsenden Metropolen als Moloche voller Einzelgänger vorzustellen, das Land als Äcker der Zurückgelassenen. Ja, schnell und bequem könnten wir uns in zurückgewandten Ängsten ergehen und die Zukunft schwarzmalen. Charlie Chaplin tat es mit der Industrialisierung, Jacques Tati ließ seinen Monsieur Hulot auf die Auswüchse der Moderne los, und inzwischen gehört die Verkündung einer düsteren Zukunft zum alltäglichen Geschäft der medialen Fehlerfeststellungskommandos. Verlockend ist das Unkenrufen, quotentreibend die allgemeine Untergangslaune.
Ähnliches geschieht gerade mit dem frisch konstatierten Phänomen der großen Vereinsamung. Und tatsächlich klingen die Zahlen nicht gut, die Befunde müssen verunsichern.
Und jetzt auch noch: Corona. Die Pandemie spülte vieles an die Oberfläche. In echt viralem Tempo und im globalen Maßstab stellte Covid-19 auf einmal die Frage, wie und warum die Menschheit so lange das Falsche zulassen konnte, ohne das Richtige zu tun. Beim Klima. Bei der Tierhaltung. Bei der Gesundheit. Beim Turbokapitalismus und beim im selben Atemzug praktizierten Sparwahn, der sich hinter dem hübschen Begriff der Austerität versteckt. Doch brachte die Pandemie noch ein weiteres Thema eiskalt und mit Macht auf den Plan: Nämlich und ganz besonders das der kollektiven Vereinzelung.
Geradezu emblematisch trieb es das Virus hier auf die Spitze und uns alle in die einsame Verbannung. Schon sprachlich standen auf einmal Begrifflichkeiten auf der Tagesordnung, die es deutlicher nicht sagen konnten. Social distancing. Abstandsregeln. Kontaktsperren. Shutdowns, Homeoffice und häusliche Quarantäne. Imperative, die uns aufforderten: Bleibt zu Hause! Haltet Abstand! Gebt euch nicht mehr die Hände! Tragt Masken! Separiert euch! Wie nichts anderes zuvor machte das Virus die Fragmentierung zum Programm: Nicht mehr als eine Person aus einem anderen Haushalt! Schulen zu. Kitas zu. Sogar die Städte: Dicht. Es war, als sei die Vereinzelung mit einem Schlag auf ihrer höchsten Steigerungsebene angekommen. Der Mensch, allein daheim. Verkrochen in den eigenen vier Wänden.
Die meisten litten schon nach kurzer Zeit unter diesem Zustand. Der moderne Mensch drehte im Homeoffice langsam durch. Senioren fühlten sich noch einsamer, als sie es eh schon waren, Kinder vermissten ihre Schulfreunde, in Italien traten die Menschen vor Verzweiflung auf die Balkone und sangen. In den Krankenhäusern erlebten derweil Abertausende, was in vielen Hospizen und auf Friedhöfen längst bekannt ist und was nun auch die Öffentlichkeit unverblümt zu sehen bekam: anonymes Sterben.
»Zweifellos«, schrieb der Spiegel, »verschlimmert Covid-19 ein Problem, das schon vorher Millionen Menschen und Regierungen auf der ganzen Welt beschäftigt hat: Einsamkeit.«
Wird die Pandemie die Gesellschaften langfristig verändern? So lautete eine der vielen neuen Fragen. Eine nächste: Werden die Alten ab sofort nur noch mehr ausgegrenzt, ausgeschlossen, weggesperrt? Werden wir uns alle über Generationen gelernte Begrüßungsformen abgewöhnen? Kein Händeschütteln, kein High five mehr unter Freunden? Sogar Mütter und Töchter standen sich gegenüber, Tanten und Nichten, und sie wagten nicht mal mehr eine flüchtige Umarmung. Das Virus führte zu einer bisher ungekannten Berührungslosigkeit. Die Forscher sprachen vom größten Sozialexperiment aller Zeiten, denn Corona gipfelte in einer gigantischen, weltumspannenden Vereinzelungsstarre. Mitte April 2020 galten in 115 Ländern der Erde explizite Ausgangsbeschränkungen.
Spätestens damit war die Vereinzelung kein Phänomen mehr, sondern zum globalen Status quo avanciert.
Einige befürchten in diesen neuen virulenten Zeiten eine Krise, die am Ende womöglich schlimmer ausfällt als die wirtschaftliche. Experten wie Vivek Murthy und James Coan haben ihr auch schon einen Namen gegeben: Erstmals ist von einer sozialen Rezession die Rede. Von einer Vereinsamung in corpere, die es so noch nie gegeben hat.
Das sind die schlechten Nachrichten. Doch es gibt vielleicht auch gute. Denn was ist ebenfalls in Zeiten der programmatischen Separierung geschehen? Die digitalen Verbindungen schnellten in die Höhe, Zoom und Skype gerieten zu millionenfach genutzten Plattformen für Meetings und gemeinsame Besprechungen. Interviews und Fernsehbeiträge, sonst aufwändig von weitgereisten Kamerateams produziert, entstanden binnen weniger Minuten via Smartphone. Ohne große Dramaturgie, eher improvisiert, oft spontan. Das Internet, sonst vielgescholtenes Disruptionsmedium, wurde zum Austauschbeschleuniger, zum Fluidum der Zusammenkünfte.
Die Jungen feierten ihre Corona-Partys und schauten gemeinsam Filme, saßen mit Freunden auf dem Sofa, jeder für sich zu Hause. Sie aßen dabei Chips und tranken Negroni, der eine draußen auf dem Land, der nächste in der Stadt, in der Wohnung nebenan, der nächste in Australien, Kanada, Neuseeland, wohin auch immer es ihn während seines Work-and-Travel-Trips gerade verschlagen hatte – und doch saßen sie am Ende alle irgendwie in einem Boot.
Bald standen die Leute auch in Frankreich, Spanien, Deutschland auf ihren Balkonen, sie öffneten die Fenster, klatschten, bekundeten Solidarität. Schufen Zusammengehörigkeit, Verbundenheit. Konzerte wurden aus menschenleeren Bars übertragen, Lesungen aus verwaisten Hörsälen. Es war, als würde der Mensch die Separierung nicht wollen und nicht ertragen, die Vereinzelung auf einmal mit aller Macht aushebeln wollen. Und dies schließlich auch tat. Digital. Virtuell. Mal mehr, mal weniger. Mal auf bereits benutzten Bahnen, mal erfinderisch oder auch radikal neu. Mitgliederversammlungen stiegen auf einmal in virtuellen Räumen, in Windeseile entwickelte Apps machten auf einmal Housepartys möglich und gestreamte DJ-Auftritte. Die Masken, einst geradezu exemplarische Entfremdungsaccessoires, wurden plötzlich zu persönlichen Designerstücken, zu in Kellern und improvisierten Nähstuben gefertigten Symbolen gemeinsamen Handelns. Zum Stoff des Zusammenhalts in Zeiten des Auseinanderpurzelns.
Da waren auf einmal neuartige Membranen. Kanäle und Verbindungskorridore, von denen wir vorher nichts wussten.
Ist das nun alles gut? Ist das nun alles schlecht? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Denn ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Was hier nämlich gerade abgeht, ist nichts Geringeres als ein großes, spannendes, wichtiges und ziemlich entscheidendes Experiment. Wie geht der Mensch mit sich selbst um? Wie mit den über acht Milliarden anderen, die auf dieser Erde leben, einer Erde, die nicht größer wird und gerade auch nicht wirklich flauschiger? Wie tauscht er sich aus, wie begegnet und begreift er sich? Als Partikel im Ganzen oder Partikel des Ganzen? Wie schafft er in der zunehmenden Enge und unter der Last der großen Fragen einen Zusammenhalt? Wie findet er einen sinnvollen Generalkurs, der sich aus Tausenden verschiedenen Zickzacks ergibt?
Ich möchte mich am liebsten an nichts halten. Möchte alles Vorgefertigte vergessen, alles Gelernte und am besten auch mich selbst annullieren. Möchte in diesem Buch vorsichtig forschen und neugierig fragen, wie er womöglich funktionieren könnte, dieser geheimnisvolle Stoffwechsel zwischen dem Einzelnen und dem Ganzen.