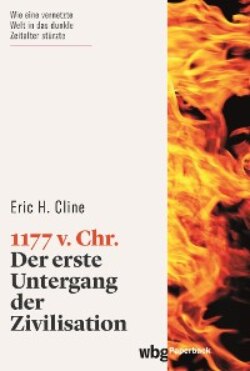Читать книгу 1177 v. Chr. - Eric H. Cline - Страница 11
Prolog Zusammenbruch der Zivilisationen:
1177 v. Chr.
ОглавлениеAls die Krieger die Bühne der Weltgeschichte betraten, kamen sie schnell voran und brachten Tod und Verwüstung über das Land. Die moderne Wissenschaft nennt sie kollektiv »Seevölker«, aber die Ägypter benutzten diesen Begriff nicht, sondern nannten in ihren Aufzeichnungen stets die einzelnen Gruppen, die zusammen auftraten: Peleset, Tjeker, Šekeleš, Šardana, Danunäer und Wašaš – fremd klingende Namen für fremd aussehende Menschen.1
Abgesehen von diesen Namen verraten uns die ägyptischen Aufzeichnungen nur wenig über sie. Wir wissen nicht genau, woher die Seevölker ursprünglich kamen – nach einem möglichen Szenario vielleicht von Sizilien, Sardinien und aus Italien, vielleicht aber auch aus der Ägäis oder Westanatolien, vielleicht von Zypern oder aus dem östlichen Mittelmeer.2 Es ist noch niemandem gelungen, eine antike Stätte als den Ort ihrer Herkunft oder den Ausgangspunkt ihrer Reisen zu identifizieren. Die Seevölker fuhren unaufhaltsam von Ort zu Ort und überrannten dabei ganze Länder und Königreiche. Glaubt man den ägyptischen Texten, so schlugen sie in Syrien ihr Lager auf, bevor sie die Küste von Kanaan (einen Teil der heutigen Staaten Syrien, Libanon und Israel) überfielen und schließlich ins ägyptische Nildelta vordrangen.
Das geschah 1177 v. Chr., im achten Regierungsjahr von Pharao Ramses III.3 Nach den Aufzeichnungen der Alten Ägypter und neueren archäologischen Befunden fielen einige der Seevölker auf dem Landweg ein, andere über See.4 Sie hatten keine Uniformen, keine aufwändigen Kleider. Alte Bilder zeigen eine Gruppe mit Federschmuck auf dem Kopf, eine andere mit Schädelkappen, wieder andere mit gehörnten Helmen oder ganz ohne Kopfbedeckung. Einige trugen kurze Spitzbärte und kurze Röcke, der Oberkörper nackt oder mit einer Tunika bedeckt, andere hatten keine Bärte und trugen längere, ebenfalls rockähnliche Kleidungsstücke. Diese Beobachtungen legen nahe, dass die Seevölker aus unterschiedlichen Gruppen aus verschiedenen Regionen und verschiedenen Kulturen bestanden. Sie waren mit scharfen Bronzeschwertern, Holzstangen mit glänzenden Metallspitzen sowie mit Pfeil und Bogen bewaffnet und kamen auf Schiffen, Kutschen, Ochsenkarren und Streitwagen. Auch wenn ich hier 1177 v. Chr. als Jahreszahl in den Mittelpunkt rücke, wissen wir, dass die Eindringlinge in Wellen kamen, und das über einen beträchtlichen Zeitraum hinweg. Manchmal kamen die Krieger allein, manchmal wurden sie von ihren Familien begleitet.
Wie uns die Inschriften des Ramses berichten, gab es kein Land, das in der Lage gewesen wäre, der Masse der Eindringlinge etwas entgegenzusetzen. Jeder Widerstand war zwecklos. Die damaligen Großmächte – die Hethiter, die Mykener, die Kanaaniter, die Zyprer und andere mehr – fielen ihnen eine nach der anderen zum Opfer. Manchen gelang es, nur zu überleben, indem sie vor dem Massaker flohen, andere hausten bald in den Ruinen ihrer einst so stolzen Städte; es gab aber auch Menschen, die sich den Invasoren anschlossen, ihre Anzahl weiter anschwellen ließen und zu der offensichtlichen Vielschichtigkeit des eindringenden Mobs beitrugen. Jede einzelne Gruppe der Seevölker befand sich in Bewegung, die Motivation dafür war aber offenbar recht unterschiedlich. Vielleicht war es der Wunsch nach Beute oder Sklaven, der einige antrieb; andere könnte der demographische Druck dazu gezwungen haben, den Westen zu verlassen und im Osten ihr Glück zu suchen.
An den Mauern seines Totentempels in Medinet Habu, nahe dem Tal der Könige, stehen Ramses’ prägnante Worte:
Die Fremdländischen verschworen sich auf ihren Inseln. Im Kampfgewühl wurden die Länder auf einen Schlag vernichtet. Kein Land hielt ihren Armeen stand, Ḫatti, Qadi, Qarqemiš, Arzawa, Alašija waren [auf einen Schlag] entwurzelt. Sie schlugen an einem Ort im Inneren von Amurru ihr Lager auf. Sie vernichteten die Bewohner und das Land, als habe es nie existiert. Während die Flamme vor ihnen bereitet wurde, kamen sie vorwärts gegen Ägypten. Die Länder Peleset, Tjeker, Šekeleš, Danunäer und Wašaš verbündeten sich. Sie legten Hand an alle Länder bis ans Ende der Welt; ihre Herzen waren zuversichtlich und voller Vertrauen.5
Wir kennen die Orte, die von den Invasoren angeblich überrannt wurden, sie waren im Altertum allesamt berühmte Stätten. Ḫatti war das Land der Hethiter, sein Kernland befand sich auf der Hochebene im Landesinneren von Anatolien in der Nähe des heutigen Ankara; das Reich erstreckte sich von der Küste der Ägäis im Westen bis nach Nordsyrien im Osten. Qadi lag wahrscheinlich im heutigen Südosten der Türkei (möglicherweise handelt es sich um die antike Region Kizzuwatna). Karkemiš ist eine bekannte archäologische Stätte, die von einem Archäologenteam ausgegraben wurde, dem neben Sir Leonard Woolley (den man eher durch die Ausgrabung von Abrahams »Ur in Chaldäa« im Irak kennt) auch Thomas E. Lawrence angehörte (der vor seinen Heldentaten im Ersten Weltkrieg, die ihn am Ende zum Hollywoodhelden »Lawrence von Arabien« machten, in Oxford klassische Archäologie studiert hatte). Das Land Arzawa kannten die Hethiter gut, es lag innerhalb ihres Einflussbereichs in Westanatolien. Alašija könnte die Insel gewesen sein, die wir heute als Zypern kennen – eine Insel mit großen Metallvorkommen, die vor allem für ihr Kupfererz berühmt war. Amurru lag an der Küste Nordsyriens. In den Kapiteln und in den Geschichten, die folgen, werden wir all diesen Orten noch einmal begegnen.
Die sechs Einzelgruppen, aus denen die Seevölker bei dieser Invasionswelle bestanden – die fünf oben von Ramses in der Inschrift in Medinet Habu aufgezählten sowie eine sechste Gruppe, die man Šardana nannte und die in einer weiteren Inschrift erwähnt wird – sind um einiges rätselhafter als die Länder, die sie angeblich überrannten. Sie hinterließen keine eigenen Inschriften, so dass wir sie fast ausschließlich aus ägyptischen Inschriften kennen.6
Abb. 1 Seevölker als Gefangene in Medinet Habu (nach Medinet Habu, Bd. 1, Taf. 44. Mit freundlicher Genehmigung des Oriental Institute der University of Chicago).
Die meisten dieser Gruppen sind auch in archäologischer Hinsicht nur schwer zu fassen, obwohl Archäologen und Philologen genau dies seit fast 100 Jahren immer wieder ganz tapfer versuchen – erst mittels linguistischer Versuche, in jüngerer Zeit dann anhand von Keramik und anderen archäologischen Funden. So hat man zum Beispiel die Danunäer mit Homers Danaern aus der bronzezeitlichen Ägäis identifiziert. Von den Šekeleš nimmt man immer wieder an, dass sie aus dem heutigen Sizilien stammen, die Šardana aus Sardinien – die Basis dieser Annahme ist einerseits die Ähnlichkeit der Konsonanten, andererseits Ramses’ Bemerkung über die »Fremdländischen« von den »Inseln«; bei den Šardana heißt es in Ramses’ Inschriften zudem explizit, sie wohnten »auf See«.7
Diesen Vorschlägen schließen sich allerdings längst nicht alle Wissenschaftler an. Eine ganze Forschungsrichtung ist der Ansicht, die Šekeleš und die Šardana seien gar nicht aus dem westlichen Mittelmeerraum gekommen, sondern aus Gebieten im östlichen Mittelmeer – später, nach dem Sieg der Ägypter, seien sie dann nach Sizilien und Sardinien geflüchtet; so seien diese Regionen überhaupt erst zu ihren Namen gekommen. Dafür spricht die Tatsache, dass die Šardana schon lange vor dem Aufkommen der Seevölker für und auch gegen die Ägypter kämpften. Dagegen spricht, dass Ramses III. erwähnt, die überlebenden Angreifer hätten sich in Ägypten niedergelassen.8
Von allen ausländischen Gruppen, die hier zu jener Zeit aktiv waren, ist es bislang nur bei einer gelungen, sie zu identifizieren. Es gilt als sicher, dass das Seevolk der Peleset mit den Philistern identisch ist, die laut der Bibel von Kreta stammten.9 Die linguistische Identifizierung war so offensichtlich, dass Jean-François Champollion, der die ägyptischen Hieroglyphen entschlüsselte, dies bereits vor 1836 vorgeschlagen hatte; 1899 identifizierten biblische Archäologen in Tell es-Safi, dem biblischen Gath, erstmals bestimmte Keramik- und Architekturstile sowie weiteres Material als »philistisch«.10
Auch wenn wir über Herkunft und Motivation der Angreifer nichts Genaues wissen, können wir doch immerhin feststellen, wie sie aussahen – wir kennen ihre Namen und ihre Gesichter von den Reliefs an den Mauern des Totentempels Ramses’ III. in Medinet Habu. Diese antike Stätte ist reich an Bildern und hieroglyphischen Texten. Rüstungen, Waffen, Kleidung, Schiffe und mit Habseligkeiten beladene Ochsenkarren der Invasoren sind in den Darstellungen deutlich sichtbar, und zwar in einer solchen Detailfülle, dass diverse Wissenschaftler Individuen und sogar Schiffe, die dort abgebildet sind, analysiert haben.11 Es gibt auch weitaus martialischere Bilder: Eines zeigt Invasoren und Ägypter mitten in einer chaotischen Seeschlacht; einige sind eindeutig tot – sie treiben mit dem Kopf nach unten im Wasser –, andere kämpfen weiterhin heftig aus ihren Schiffen heraus.
Seit den 1920er Jahren haben Ägyptologen vom Oriental Institute der University of Chicago die Inschriften und Bilder in Medinet Habu untersucht und sorgfältig kopiert. Dieses Institut war und ist noch heute eine der weltweit führenden Institutionen, wenn es um das Studium der antiken Zivilisationen Ägyptens und des Nahen Ostens geht. Gegründet wurde es von James Henry Breasted nach dessen Rückkehr von einer abenteuerlichen Reise durch den Nahen Osten in den Jahren 1919 und 1920; das Startkapital von 50.000 Dollar stellte John D. Rockefeller Jr. bereit. Archäologen vom OI (wie man es meistens nennt) waren an Ausgrabungen im gesamten Nahen Osten beteiligt, u.a. im Iran und in Ägypten.
Über Breasted und die OI-Projekte, die unter seiner Leitung angestoßen wurden, hat man viel geschrieben, beispielsweise über die Ausgrabungen in Megiddo (dem biblischen Armageddon) in Israel, die von 1925 bis 1939 dauerten.12 Zu den Highlights gehörten mehrere Epigraphik-Surveys in Ägypten, im Rahmen derer hieroglyphische Texte und Szenen, die die Pharaonen in ihren Tempeln und Palästen in ganz Ägypten hinterließen, von Ägyptologen akribisch kopiert wurden – eine unglaublich mühsame Arbeit. Stunden um Stunden standen die Mitarbeiter des Instituts in der prallen Sonne auf Leitern oder hockten auf Gerüsten und versuchten, die längst verblassenden Symbole an Toren, Tempeln und Säulen abzuzeichnen. Dennoch sind die Ergebnisse dieser Bemühungen von geradezu unschätzbarem Wert, vor allem da viele Inschriften seither stark unter der Erosion und dem Ansturm von Touristen gelitten haben. Hätte man diese Inschriften nicht rechtzeitig übertragen, wären sie irgendwann verschwunden und für künftige Generationen verloren. Die Abschriften von Medinet Habu wurden in mehreren Bänden veröffentlicht; der erste erschien 1930, weitere Bände in den 1940er und 50er Jahren.
Zwar diskutiert die Wissenschaft auch weiterhin über die Land- und Seeschlachten an den Mauern von Medinet Habu, aber die meisten Experten sind sich inzwischen einig, dass die dort dargestellten Szenen wahrscheinlich nahezu zeitgleich stattfanden, und zwar entweder im Nildelta oder in der Nähe von Medinet Habu. Es kann gut sein, dass sie eine einzige große Schlacht zeigen, die zugleich an Land und auf See ausgetragen wurde, und einige Forscher haben darauf hingewiesen, hier könne dargestellt sein, wie die Ägypter beide Streitmächte der Seevölker in einen Hinterhalt lockten.13 Das endgültige Ergebnis bezweifelt indes niemand – in Medinet Habu hält der ägyptische Pharao ganz eindeutig fest:
Abb. 2 Seeschlacht mit Seevölkern in Medinet Habu (nach Medinet Habu, Bd. 1, Taf. 37. Mit freundlicher Genehmigung des Oriental Institute der University of Chicago).
Der Same derer, die meine Grenze erreichten, ist ausgelöscht, mit ihren Herzen und ihren Seelen hat es auf ewig ein Ende. Diejenigen, die zusammen über das Meer gekommen waren, erwartete an den Flussmündungen die volle Flamme, während ein Meer aus Lanzen sie am Ufer umgab. Man lockte sie ins Landesinnere, schloss sie ein und tötete sie an der Küste niedergestreckt, schichtete ihre Leichname zu Haufen. Ich habe die Länder dazu gebracht, den Namen Ägyptens nicht auszusprechen; wenn sie in ihrem Land meinen Namen dennoch aussprechen, dann werden sie verbrannt.14
In einem berühmten Dokument, das man als »Großer Papyrus Harris« bezeichnet, führt Ramses dies weiter aus und nennt noch einmal die Namen seiner besiegten Feinde:
Ich stürzte die, die sie von ihrem Land aus überfielen. Ich schlug die Danunäer, die auf ihren Inseln [sind], die Tjeker und die Peleset wurden zu Asche. Die Šardana und Wašaš des Meeres – sie wurden behandelt, als hätten sie nie existiert; einmal nahm man sie fest und brachte sie als Gefangene nach Ägypten, [zahlreich] wie der Sand am Ufer. Ich setzte sie in meinem Namen in Burgen fest. Hunderttausende zählten ihre Klassen. Ich besteuerte sie alle jedes Jahr, in Kleidung und Getreide aus den Lagerhäusern und den Getreidespeichern.15
Dies war nicht das erste Mal, dass die Ägypter gegen die gesammelte Streitmacht der »Seevölker« kämpften: Bereits 30 Jahre zuvor, im Jahr 1207 v. Chr., dem fünften Jahr der Herrschaft des Pharaos Merenptah, hatte eine ähnliche Ansammlung nicht genau identifizierbarer Krieger Ägypten angegriffen. Merenptah ist Kennern des alten Orients vor allem deshalb vertraut, weil er als erster ägyptischer Pharao den Begriff »Israel« verwendete, übrigens in einer Inschrift aus exakt demselben Jahr (1207 v. Chr.). Diese Inschrift markiert zugleich die früheste Verwendung des Namens Israel außerhalb der Bibel. In der pharaonischen Inschrift ist der Name mit einer speziellen Markierung gekennzeichnet, die anzeigt, dass es sich dabei um ein Volk und nicht um einen Ort handelt. Erwähnt wird der Name im Zusammenhang mit einer knappen Beschreibung eines Feldzugs in die Region Kanaan, wo das Volk, das er »Israel« nennt, angesiedelt war.16 Die betreffenden Sätze stehen innerhalb einer viel längeren Inschrift, in der es vornehmlich um Merenptahs langwierige kriegerische Auseinandersetzungen mit den Libyern geht, Ägyptens Nachbarn im Westen. Die Libyer und die Seevölker beanspruchten die Aufmerksamkeit des Pharaos in jenem Jahr weitaus mehr als die Israeliten.
Ein Text aus Heliopolis zum Beispiel, datiert auf »Jahr fünf, Monat zwei der dritten Jahreszeit (zehnter Monat)«, teilt uns mit: »Der elende Anführer Libyens ist [mit] Šekeleš und jedem fremden Land, das ihm beisteht, eingefallen und hat die Grenzen Ägyptens verletzt«.17 Den gleichen Wortlaut finden wir in einer anderen Inschrift, die man als »Säule von Kairo« kennt.18 In einer längeren Inschrift in Karnak (dem heutigen Luxor) erfahren wir noch ein paar weitere Einzelheiten zu dieser frühen Angriffswelle der Seevölker. Die einzelnen Gruppen sind darin genau bezeichnet:
[Zu Beginn des Siegs, den seine Majestät im Land Libyen errang, kamen] Ekweš, Tereš, Lukka, Šardana, Šekeleš, alle von Ländern des Nordens, … in der dritten Jahreszeit und sagten: Der elende, gefallene Anführer Libyens … ist mit seinen Bogenschützen – Šardana, Šekeleš, Ekweš, Lukka, Tereš – ins Land der Tehenu eingefallen, wobei er die besten Krieger und jeden einzelnen Kämpfer seines Landes mitnahm
Die Liste der Gefangenen, die aus dem Lande Libyen und von den Ländern, die es mitbrachte, fortgeschafft wurden
Šerden, Šekeleš, Ekweš, die keine Vorhaut hatten, von den Ländern des Meeres:
Šekeleš: 222 Männer,
das ergibt 250 Hände.
Tereš: 742 Männer,
das ergibt 790 Hände.
Šardana: –
[das ergibt] –
[Ek]weš, die keine Vorhaut hatten, wurden erschlagen, ihre Hände wurden weggeführt, (denn) sie hatten keine [Vorhaut] –
Šekeleš und Tereš, die als Feinde Libyens kamen –
218 Männer der Qeheq und Libyer wurden lebend als Gefangene abgeführt.19
Zwei Dinge gehen aus dieser Inschrift eindeutig hervor. Erstens waren an diesem früheren Angriff der Seevölker nicht sechs, sondern fünf Gruppen beteiligt: Šardana (oder Šerden), Šekeleš, Ekweš, Lukka und Tereš; die Šardana und Šekeleš tauchen später zur Zeit Ramses’ III. wieder auf, die anderen drei Gruppen nicht. Zweitens werden die Šardana, Šekeleš und Ekweš ausdrücklich als »von den Ländern des Meeres« identifiziert, und von den fünf Gruppen heißt es kollektiv, sie seien »alle von Ländern des Nordens« gekommen. Letzteres ist nicht allzu überraschend, denn die meisten Länder, mit denen das Land zur Zeit des Neuen Reiches in Kontakt stand, lagen nördlich von Ägypten (außer Nubien und Libyen). Die Identifizierung der Šardana und Šekeleš als »von den Ländern des Meeres« verstärkt die Vermutung, dass sie in irgendeiner Weise mit Sardinien und Sizilien zu tun haben.
Dass auch die Ekweš als »von Ländern des Nordens« kommend genannt werden, hat einige Wissenschaftler zur Annahme verleitet, damit könnten die Achaier Homers gemeint sein, also die Mykener des griechischen Festlandes der Bronzezeit – eben jenes Volk, das Ramses III. in seinen Seevölker-Inschriften zwei Jahrzehnte später vielleicht mit »Danunäer« meinte. Was die letzten beiden Namen betrifft, so akzeptiert die Wissenschaft in der Regel Lukka als Verweis auf ein Volk aus dem Südwesten der Türkei, derjenigen Region, die in der klassischen Zeit »Lykien« hieß. Der Ursprung des Tereš ist ungewiss, vielleicht waren es die italischen Etrusker.20 Viel mehr geben die Inschriften nicht her, und auch über den Schauplatz der Schlacht(en) können wir nur vage Vermutungen anstellen. Merenptah sagt lediglich, der Sieg sei »im Lande Libyen« errungen worden, das er weiter als »Land der Tehenu« definiert. Indes wird ganz klar, dass Merenptah den Sieg für sich beansprucht, denn er listet getötete und gefangengenommene feindliche Krieger sowie ihre »Hände« auf. Damals war es Brauch, den getöteten Feinden eine Hand abzuschneiden und mit nach Hause zu bringen, um die übliche Belohnung für die Tötung eines feindlichen Kämpfers einzustreichen. Erst kürzlich entdeckte man einen grausigen Beweis für diese Praxis aus der Hyksoszeit, etwa 400 Jahre vor Merenptah, in der Form von 16 rechten Händen, die man beim Hyksos-Palast in Avaris im Nildelta in vier Gruben verscharrt hatte.21 Ob alle Angehörigen der Seevölker getötet wurden oder ob einige überlebten, wissen wir nicht – anzunehmen ist jedoch Letzteres, bedenkt man, dass mehrere dieser Gruppen 30 Jahre später zu einer zweiten Invasion zurückkehrten.
Im Jahr 1177 v. Chr., wie bereits 1207 v. Chr., besiegten die Ägypter die Seevölker. Sie kehrten kein drittes Mal nach Ägypten zurück. Ramses war stolz darauf, dass er den Feind »zum Kentern brachte und an Ort und Stelle überwand«: »Ihre Herzen«, schrieb er, »werden ihnen fortgenommen, ihre Seelen fliegen davon. Ihre Waffen sind auf See verstreut.«22 Dennoch war es ein Pyrrhussieg: Obwohl das Ägypten Ramses’ III. die einzige Großmacht war, die dem Ansturm der Seevölker jemals erfolgreich widerstanden hatte, war das ägyptische Neue Reich danach doch nicht mehr dasselbe. Das lag indes an anderen Problemen, denen sich zu jener Zeit wahrscheinlich der gesamte Mittelmeerraum ausgesetzt sah, wie wir im Folgenden sehen werden. Die Pharaonen, die auf Ramses III. folgten und die übrige Zeit des 2. Jahrtausends v. Chr. Ägypten beherrschten, waren damit zufrieden, ein Land zu verwalten, dessen Einfluss und Macht rapide schwanden. Am Ende war Ägypten nicht mehr als ein zweitklassiges Imperium und nur noch ein müder Abklatsch dessen, was es einst gewesen war. Erst unter dem libyschstämmigen Pharao Scheschonq I., der ca. 945 v. Chr. die 22. Dynastie gründete (und der wahrscheinlich mit dem biblischen Pharao Šišak identisch ist23) fand Ägypten wieder ein Stück weit zu seiner alten Form und Geltung zurück.
Außer Ägypten verloren fast alle Länder und Mächte in der Ägäis und im Nahen Osten – die in der späten Bronzezeit den Ton angegeben hatten – im 2. Jahrtausend v. Chr. an Bedeutung und verschwanden von der Bildfläche, entweder unmittelbar oder doch binnen weniger als einem Jahrhundert. Es war, als würde sich die Zivilisation in weiten Teilen dieser Region selbst auslöschen. In riesigen Gebieten, von Griechenland bis nach Mesopotamien, gingen viele, wenn nicht sogar alle zivilisatorischen Fortschritte der vergangenen Jahrhunderte verloren. Eine neue Epoche des Übergangs begann, die mindestens 100, in manchen Regionen vielleicht sogar 300 Jahre dauerte.
Man kann sich gut vorstellen, wie in diesen Ländern damals Angst und Schrecken herrschten. Ein ganz konkretes Beispiel dafür findet sich auf einer Tontafel, in die ein Brief des Königs von Ugarit in Nordsyrien an den (in der Hierarchie über ihm stehenden) König von Zypern eingeritzt ist:
Mein Vater, jetzt sind die Schiffe des Feindes eingetroffen. Sie stecken seither meine Städte in Brand und verwüsten das Land. Weiß mein Vater nicht, dass alle meine Fußtruppen und [Streitwagen] in Ḫatti stationiert sind und dass alle meine Schiffe im Lande der Lukka stationiert sind? Sie sind noch nicht zurückgekommen, daher liegt das Land darnieder. Möge mein Vater Kenntnis von dieser Angelegenheit haben. Jetzt haben uns die sieben Schiffe des Feindes, die gekommen sind, bereits Schaden zugefügt. Falls weitere Schiffe des Feindes auftauchen, sende mir irgendwie einen Bericht, damit ich es weiß.24
Die Forschung ist sich nicht ganz einig, ob die Tafel ihren Adressaten auf Zypern erreicht hat. Die Ausgräber, die die Tafel entdeckten, glaubten, der Brief sei wahrscheinlich gar nicht abgeschickt worden. Es hieß ursprünglich, man habe ihn zusammen mit mehr als 70 anderen Tafeln im Inneren eines Brennofens gefunden – sicherlich wollte man die Tafel brennen, damit sie die Reise nach Zypern besser überstünde.25 Die Ausgräber und andere Gelehrte vermuteten zunächst, dass die feindlichen Schiffe zurückgekehrt waren und die Stadt überfallen hatten, bevor das Hilfeersuchen auf den Weg gebracht werden konnte. So lautet die Geschichte, die die Geschichtsbücher erzählen und die einer ganzen Studentengeneration aufgetischt wurde. Dabei hat man inzwischen herausgefunden, dass die Tafel nicht in einem Brennofen lag und dass es sich (wie wir später sehen werden) nur um eine Kopie des Briefes handelt; einiges spricht dafür, dass das Original tatsächlich nach Zypern geschickt wurde.
Früher gab es in der Forschung die Tendenz, alle solche zerstörerischen Überfälle in jener Epoche den Seevölkern zuzuschreiben.26 Doch ihnen die komplette Schuld für das Ende der Bronzezeit in der Ägäis und im östlichen Mittelmeerraum zugeben, wäre sicherlich vermessen; so viel Macht werden sie kaum gehabt haben. Wir haben aber ohnehin keine eindeutigen Beweise für ihr Wirken, abgesehen von den ägyptischen Texten und Inschriften, die jedoch einen widersprüchlichen Eindruck hinterlassen. Fielen die Seevölker als organisierte Armee ins östliche Mittelmeer ein, im Sinne eines der besser organisierten Kreuzzüge im Mittelalter, die zum Ziel hatten, das Heilige Land zu erobern? Handelte es sich um eine eher locker bzw. schlecht organisierte Bande von Plünderern wie die späteren Wikinger? Oder waren sie Flüchtlinge, die vor einer Naturkatastrophe flohen und neue Orte zum Besiedeln suchten? Soviel wir wissen, könnte die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen – vielleicht war es eine Kombination aller drei oben genannten Aspekte, vielleicht traf aber auch keiner davon zu.
Immerhin: In den letzten Jahrzehnten ist eine Fülle neuer Daten aufgetaucht, die man hier mit berücksichtigen muss.27 So sind wir uns heute durchaus nicht mehr so sicher, dass alle Orte, an denen sich Spuren der Zerstörung fanden, von den Seevölkern heimgesucht wurden. Archäologische Befunde verraten uns zuverlässig, dass eine Stätte zerstört wurde, aber nicht immer wovon oder von wem. Darüber hinaus wurden nicht alle diese Stätten zur selben Zeit zerstört, viele nicht einmal im selben Jahrzehnt. Wie wir sehen werden, erstreckte sich der kumulative Untergang über mehrere Jahrzehnte, vielleicht sogar über ein ganzes Jahrhundert.
Während wir also noch immer nicht genau die Ursache (oder alle Ursachen) dafür kennen, weshalb die Welt der Bronzezeit in Griechenland, Ägypten und dem Nahen Osten zusammenbrach, weist die aktuelle Forschungslage doch eher darauf hin, dass die Schuld nicht allein bei den Seevölkern zu suchen ist. Als wahrscheinlicher gilt, dass sie beim Zusammenbruch der Zivilisationen nicht nur Aggressoren waren, sondern zugleich auch selbst zu den Opfern gehörten.28 Eine Hypothese besagt, dass sie durch eine Verkettung unglücklicher Umstände und Ereignisse gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen und nach Osten auszuwandern, während sich die dortigen Königreiche und Imperien bereits im Niedergang befanden. Es ist durchaus möglich, dass sie allein deshalb in der Lage waren, diese Monarchien erfolgreich anzugreifen, eben weil sie bereits im Untergang begriffen und entsprechend geschwächt waren. Insofern könnte man den Seevölkern höchstens vorwerfen, dass sie besonders opportunistisch waren (wie es ein Forscher ausgedrückt hat). Ebenso könnte ihre Besiedlung des östlichen Mittelmeerraums weitaus gesitteter und mit weniger Blutvergießen einhergegangen sein, als man früher angenommen hat. Wir werden diese Möglichkeiten im Folgenden noch näher betrachten.
Jahrzehntelang waren die Seevölker für die Wissenschaft ein willkommener Sündenbock für eine Situation, die weit komplexer war, als man annahm, und für die sie letztlich gar nicht so viel konnten. Jetzt scheint sich das Blatt zu wenden: Mehrere Wissenschaftler haben kürzlich darauf hingewiesen, dass die »Geschichte« der katastrophalen Welle von mutwilliger Zerstörung und/oder Migration, die die Seevölker angeblich über das östliche Mittelmeer brachten, von Gelehrten wie Gaston Maspero, dem berühmten französischen Ägyptologen, in den 1860er und 70er Jahren in die Welt gesetzt wurde und sich bis 1901 in den Köpfen festgesetzt hatte. Dennoch war es niemals mehr als eine bloße Theorie auf Basis epigraphischer Zeugnisse, und sie entstand lange, bevor die zerstörten Stätten tatsächlich ausgegraben wurden. Dabei waren sich selbst die Forscher, die Masperos Annahmen folgten, uneins darüber, welche Richtung die Seevölker einschlugen, nachdem sie von den Ägyptern besiegt worden waren – einige waren der Ansicht, sie seien erst anschließend ins westliche Mittelmeer gefahren und seien gar nicht von dort gekommen.29
Heute herrscht allgemein die Überzeugung, dass die Seevölker (wie wir weiter unten sehen werden) wohl durchaus für einen Teil der Zerstörungen gegen Ende der späten Bronzezeit verantwortlich gewesen sein können. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass eine Verknüpfung natürlicher und menschengemachter Ereignisse – u.a. Klimawandel und Dürre, Erdbebenserien, Revolten und »Systemzusammenbrüche« – eine Kettenreaktion in Gang setzte, die zum Ende jener Epoche führte. Um wirklich zu verstehen, von welcher umwälzenden Bedeutung die Ereignisse um das Jahr 1177 v. Chr. waren, müssen wir zunächst rund 300 Jahre früher ansetzen.
Tab. 1 Im Text erwähnte spätbronzezeitliche Könige Ägyptens und des alten Orients, chronologisch nach Land/Reich.
Tab. 2 Moderne Regionen und ihre (wahrscheinlichen) Namen in der späten Bronzezeit.