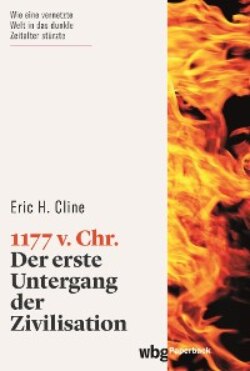Читать книгу 1177 v. Chr. - Eric H. Cline - Страница 15
Entdeckung der Minoer und Überblick
ОглавлениеWie bereits deutlich geworden sein dürfte, standen die kretischen Minoer in der Mittel- und Spätbronzezeit, ab mindestens 1800 v. Chr., mit mehreren Regionen im alten Orient in Kontakt. Sogar die Briefe von Mari erwähnen die Minoer und weisen möglicherweise darauf hin, dass es Anfang des 18. Jahrhunderts v. Chr. einen minoischen Dolmetscher (oder auch einen Dolmetscher für die Minoer) im nordsyrischen Ugarit gab; Ugarit ließ sich aus dem östlich gelegenen Mari Zinn schicken.14 Zwischen Ägypten und den Minoern scheint es ab dem 15. Jahrhundert v. Chr., der Zeit von Hatschepsut und Thutmosis III., jedoch eine ganz besondere Beziehung gegeben zu haben – deshalb soll unsere Geschichte nun an diesem Punkt einsetzen.
Die minoische Kultur erhielt ihren Namen interessanterweise erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts von dem britischen Archäologen Sir Arthur Evans. Wie sie sich selbst nannten, ist nicht bekannt, auch wenn wir die Namen kennen, die die Ägypter, Kanaaniter und Mesopotamier ihnen jeweils gaben. Ebenso wenig wissen wir, woher sie kamen – Anatolien in der Türkei gilt heute als wahrscheinlichste Hypothese.
Sicher ist, dass sie im 3. Jahrtausend v. Chr. auf Kreta eine Zivilisation begründeten, die bis ca. 1200 v. Chr. bestand. Mitten in dieser Zeit, etwa um 1700 v. Chr., gab es auf der Insel ein verheerendes Erdbeben, nach dem mehrere Paläste auf der Insel, u.a. der in Knossos, wieder aufgebaut werden mussten. Doch die Minoer erholten sich bald, und ihre Kultur blühte, bis im Laufe des 2. Jahrtausends v. Chr. die Mykener vom griechischen Festland kamen und die Insel eroberten. Danach blieb Kreta unter mykenischer Herrschaft, bis ca. 1200 v. Chr. die Zivilisation auf der Insel zusammenbrach.
Evans begann, auf Kreta zu graben, nachdem er herausgefunden hatte, woher die sogenannten Milchsteine stammten, die man ihm auf dem Markt in Athen verkauft hatte. Griechinnen, die gerade entbunden hatten oder kurz vor der Entbindung standen, trugen damals solche Steine um den Hals. Darin waren Symbole eingraviert, die Evans noch nie gesehen hatte, die er aber als Schrift identifizierte. Es gelang ihm, ihre Herkunft bis in die Nähe der modernen Großstadt Heraklion auf Kreta zurückzuverfolgen, wo am Hügel Kephala die Stätte von Knossos verborgen lag. Schon früher hatte Heinrich Schliemann, der Ausgräber von Troja, versucht, das Grundstück zu kaufen und dort zu graben, allerdings vergebens. Evans hatte mehr Erfolg: Er kaufte das Land und begann im März 1900 mit den Ausgrabungen. Diese dauerten mehrere Jahrzehnte, und er investierte dabei den Großteil seines Privatvermögens. Am Ende veröffentlichte er seine Funde und Erkenntnisse in einem umfangreichen mehrbändigen Werk mit dem Titel The Palace of Minos at Knossos.15
Unterstützt von seinem vertrauten schottischen Assistenten Duncan Mackenzie16 entdeckte Evans einen Palast, der nur einem König gehört haben konnte. Prompt taufte er die neu entdeckte Zivilisation »minoisch«, nach dem mythischen König Minos, der, wie es hieß, Kreta in der Antike regiert hatte und in den labyrinthischen unterirdischen Gängen seines Palastes den Minotaurus (halb Mensch, halb Stier) eingesperrt hatte. Evans fand zahlreiche Tontafeln und andere Objekte mit Schrift darauf, in Linear A (noch nicht entziffert) und in Linear B (einer Frühform des Griechischen, die wahrscheinlich die Mykener mit nach Kreta brachten). Er fand jedoch nie heraus, wie sich diese Menschen selbst nannten. Bis heute wissen wir das nicht – trotz über 100 Jahre andauernder Ausgrabungen sowohl in Knossos als auch an vielen anderen Orten auf Kreta.17
Evans entdeckte in Knossos zahlreiche aus Ägypten und dem Nahen Osten importierte Gegenstände, nicht zuletzt einen Gefäßdeckel aus Alabaster mit Hieroglyphen darauf, die besagten: »der gute Gott, Seweserenre, Sohn des Re, Chajan«.18 Chajan war einer der bekanntesten Hyksos-Könige und regierte zu Beginn des 16. Jahrhunderts v. Chr. Objekte von ihm fand man im gesamten alten Orient, aber wie dieser Deckel nach Kreta kam, ist noch immer ein Rätsel.
Von Interesse ist hier eine ägyptische Alabastervase, die ein anderer Archäologe viele Jahre später in einem Grab in Katsamba ausgrub, einer Hafenstadt an der Nordküste Kretas mit Verbindungen zu Knossos. Sie trägt den Königsnamen des Thutmosis III.: »der gute Gott Men-cheper-re, Sohn des Re, Thutmosis, vollkommen in der Verwandlung«. Es ist eines der ganz wenigen in der Ägäis gefundenen Objekte, die seinen Namen tragen.19 Der griechische Historiker des 5. Jahrhunderts v. Chr. Thukydides behauptete, die Minoer hätten eine eigene Flotte besessen und zu jener Zeit das Meer beherrscht: »Minos war der Erste, von dem wir hören, dass er eine Flotte besaß, die das heute ›hellenisch‹ genannte Meer weithin beherrschte« (Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krieges, 1. 3–8).
Früher nannten die Forscher diese Meereshoheit »minoische Thalassokratie« (von krátos = »Herrschaft« und thálassa = »Meer«). Auch wenn man diese Thalassokratie in ihrer Bedeutung heute anzweifelt, werden in ägyptischen Aufzeichnungen doch immerhin mehrfach »Keftiu-Schiffe« erwähnt – Keftiu war die damalige ägyptische Bezeichnung für Kreta. Es ist jedoch unklar, ob damit Schiffe gemeint waren, die aus Kreta kamen, die nach Kreta fuhren oder die vielleicht nach minoischem Vorbild gebaut waren.20
Evans’ Nachfolger in Knossos war John Devitt Stringfellow Pendlebury. Er interessierte sich sehr für die möglichen Beziehungen zwischen Ägypten und Kreta; neben Knossos grub er auch regelmäßig im ägyptischen Amarna (der Hauptstadt Echnatons, die wir im Folgenden noch kennenlernen werden). Pendlebury veröffentlichte auch eine Monographie über das Thema, mit dem Titel Aegyptiaca. Darin versammelte und katalogisierte er alle ägyptischen Importe, die man in Knossos und anderswo auf der Insel gefunden hat. Wenig später, im Jahr 1941, wurde er von Fallschirmjägern erschossen, als die Deutschen Kreta überfielen.21
Evans und Pendlebury fanden noch weitere importierte Gegenstände in Knossos, und es wurde in den folgenden Jahrzehnten immer klarer, dass die Minoer ziemlich fleißige Importeure, aber auch Exporteure waren, die in regelmäßigem Kontakt mit einer ganzen Reihe ferner Regionen standen, nicht nur mit Ägypten. Zum Beispiel hat man an verschiedenen Standorten auf Kreta Rollsiegel aus Mesopotamien und Vorratsgefäße aus Kanaan aus der Mittel- und Spätbronzezeit gefunden; andersherum hat man minoische Keramik und andere Artefakte (oder zumindest Texte, die solche Artefakte erwähnen) im heutigen Ägypten, Israel, Jordanien, Zypern, Syrien und Irak entdeckt.