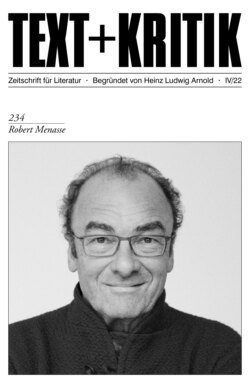Читать книгу TEXT + KRITIK 234 - Robert Menasse - Ewout van der Knaap - Страница 8
Variationen auf die Entgeisterung Zum literarischen Werk von Robert Menasse 1
ОглавлениеRobert Menasses literarisches Werk kann vor einem europäischen Hintergrund erörtert werden, in dem historisches und kulturelles Erbe resoniert: »Als Widerspiegelungen der ideellen Welt erweisen sich Menasses ›welthaltige‹ Romane nicht nur als Zusammenhang stiftende Erzählungen der verlorengegangenen Totalität auf höchstem Niveau, sondern darüber hinaus als selbstreferentielle literarästhetische Diskurse.«1 Menasse stellt Lebenswelten von literarischen Protagonisten dar, deren aktuell-eigene und ehemalig-kollektive Geschichten in den Romanen miteinander verstrickt sind. Im Vordergrund der großen realistisch-zeitgenössischen Panoramabilder stehend, haben diese Figuren fixe Ideen und kreative Vorstellungen, in deren Sackgassen sie zu geraten scheinen: Roman Gilanian, Leo Singer und Judith Katz pseudophilosophieren miteinander und reflektieren übereinander im brasilianischen Alltag; Samuel Manasseh ben Israel und Viktor Abravanel aus zwei verschiedenen historischen Epochen spiegeln einander in den europäischen Vertreibungsgeschichten; Nathan als Don Juan und Don Quijote in einer Person mischt seine ahistorischen Lebenslektionen über Lust und Lesen; eine ziemlich große Zahl von zeitgenössischen Protagonisten aus mehreren Generationen nimmt in »Die Hauptstadt« an einem Europa-Countdown teil, während sie alle an ihren eigenen familiären und politisch-historischen Traumata leiden.
Menasse erzählt in Zeitromanen negative Entwicklungsgeschichten.2 Die Romane »Sinnliche Gewissheit« (1988), »Selige Zeiten, brüchige Welt« (1991), »Schubumkehr« (1995) – als »Trilogie der Entgeisterung« bezeichnet – üben eine komödienhafte, aber gleichzeitig hartnäckige Kritik an den politisch-historischen Ideologien des ausgehenden 20. Jahrhunderts: Der Geist, der die Welt noch verbessern will, verwandelt seinen Glauben in bittere, mörderische Diskurse. »Die Vertreibung aus der Hölle« (2001) ist eine ironische Antwort auf den verlorenen Status der Geschichte und ein Musterbeispiel in Form einer weitläufigen Erzählung über die Äquivalenz zweier verschiedener »historischer« Epochen. »Don Juan de la Mancha« (2007) berichtet über das Sexualleben eines lese- und schreibsüchtigen Intellektuellen in Form autobiografischer Aufzeichnungen und psychoanalytischer Farcen und zeigt Leben, Liebe und Leiden in den »seligen« postmodernen Zeiten. »Die Hauptstadt« (2017) stellt die Alltagswelt einiger EU-Beamter in Brüssel dar und analysiert ironisch deren institutionelle Ebene und wie die supranationale Vorstellung eines friedlichen und gemeinsamen Europa-Projektes schiefzugehen droht. Die Rückentwicklung dieser Figuren fällt mit der Entwicklung der Menschheit zusammen: »Während nämlich der Held des Entwicklungsromans zur vollständigen Entfaltung seiner Persönlichkeit und sinnvollen Integration in die Gesellschaft voranschreitet, regredieren Menasses Figuren zu ihrem Anfangspunkt. Sie tun das jedoch in völliger Übereinstimmung mit der äußeren Welt.«3 Das Phänomen ›Entgeisterung‹ ist in allen Werken Menasses omnipräsent. Es ist aber nicht nur eine komische Simulation oder Paraphrase des pathetischen und idealistischen philosophischen Fachwortschatzes, sondern eine Art ständige Spiralbewegung zwischen dessen Polen: Menasse hält Hegels »Phänomenologie des Geistes« in Händen, liest thesenhaft das Inhaltsverzeichnis von hinten nach vorn, mit der sich Werk für Werk wiederholenden Konsequenz: Dass die geistige Arbeit der Menschheit nicht verhindern kann, tragischen – politisch-historischen wie privaten – Ereignissen entgehen zu können, ist ein purer Skandal. Zeitlich und örtlich ist es egal, wo sich die literarischen Protagonisten aktuell aufhalten: Das Unwiederholbare ist immer und überall wiederholbar. Das ist die Ironie der Tragik im Romanwerk Menasses.
Menasse mischt bewährte Erzählgattungen: Subkategorial sind seine Romane Bildungs-, Familien-, Geschichts- und Zeitromane. Trotz der schweren und sich oft wiederholenden Themen wirken die Situationskomik und das Anekdotische farcehaft; dialogfreudig und handlungsorientiert ist die Erzählweise; metafiktional und reflektiert sind die einzelnen Erzählebenen; das Essayistische in der Erzähler- beziehungsweise Kommentarstimme macht die Romane ernst und gleichzeitig ambivalent. »Robert Menasse schreibt seine Texte mit dem sicheren Gefühl für das, was Effekt machen könnte; das ist kein negatives Kriterium vor allem dann, wenn man bedenkt, wie wenig überhaupt in der Literatur Effekt macht (…).«4 Zwar können seine Protagonisten noch einmal ein Leben führen wie einst die Figuren Marcel Prousts, Thomas Manns, Robert Musils oder Heimito von Doderers, nur tun sie das bereits vor den Kulissen einer »kopierten« Romanwelt. Diese Welt ist aber eine, die auf den Kopf gestellt ist, in der alles zitierbar ist und alles seine Kopie kennt: Das sind die Erfahrungen einer brüchigen Welt, und dazwischen zeigt sich der totale Zerfall des jeweiligen Subjekts. Mit Menasses Worten: »Das postmoderne Bewußtsein ist die Emphase von der Beliebigkeit der Beziehungen, die die Phänomene heute eingehen können, weil reale gesellschaftliche Vermitteltheiten keine Rolle mehr spielen, bzw. durch das Prinzip Beliebigkeit ersetzt sind: das allgemeine Bewußtsein ist eine Klitterung aus Versatzstücken der Geschichte, gereinigt von Geschichte, aus Zitaten, gereinigt vom Geist des Zitierten, Kopien, ohne Bewußtsein vom Original, also Original-Kopien, Farcen, die die Tragödien vergessen haben, die sie perpetuieren.«5
Diese Prämissen gelten auch für Menasses historische Romankonstruktionen: Menasse sprach in seiner Eröffnungsrede anlässlich der Frankfurter Buchmesse 1995 mit Schwerpunktland Österreich darüber, der größte Irrtum der Menschheit sei die Geschichte: »Erst der Glaube, daß es eine Geschichte gebe, die ein sinnvoller Prozeß sei, der ein Ziel habe, das man erkennen und auf das man schließlich bewußt hinarbeiten könne, hat aus dem Kreislauf simplen biologischen und sozialen Lebens von Menschen auf diesem Planeten jene Abfolge von Greuel in immer neuer Qualität gemacht, die wir als ›Geschichte‹ studieren und gleichzeitig verdrängen.«6
Die Geschichte als Erinnerung an die Lehren und Erfahrungen der Menschheit bezweifelt, Menasse zufolge, ihren eigenen Zustand im Gegensatz zu der europäischen ziel- und entwicklungsorientierten Auffassung, die ihren allgemeinen Aufstieg, ihre Würdigkeit für gutes Schicksal, ihre geistige Vorrangigkeit utopisch voraussetzt. In der »Geschichte« kommen private oder kollektive Pogrome, Genozide und Verbrechen in wahnsinnigen Ideologien verschleiert immer wieder vor. Diese wiederholen sich ständig – trotz des angeblichen aufklärerischen Impetus der ethisch orientierten Menschheitsgeschichte. »So macht Robert Menasse dem euphorischen geschichtlichen Fortschrittdenken den Garaus – durch sein Konzept des ›progressiven Rückschritts‹ bis hin zur entfalteten Totalität der Dummheit«.7 Menasses diesbezügliche Richtungssuche zieht sich durch sein ganzes Werk hindurch.