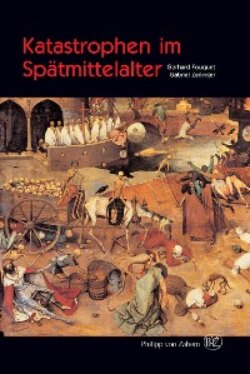Читать книгу Katastrophen im Spätmittelalter - Gerhard Fouquet - Страница 11
Was sehen Augenzeugen? Schäden: Menschen und Tiere – das ‚Gemeine Gut‘
Оглавление„Das Wasser war fünfzehn Ellen über die Berge hinaus angeschwollen und hatte sie zugedeckt. Da verendeten alle Wesen aus Fleisch, die sich auf der Erde geregt hatten, Vögel, Vieh und sonstige Tiere, alles, wovon die Erde gewimmelt hatte, und auch alle Menschen.“ (Genesis, 7,20–21)
Beim Herannahen der Flut, als sich der Birsig vor dem Steinentor gewaltig aufstaute, versuchten einige Männer offenbar in großer Eile die beiden Gatter, mit denen der Einlass des Birsigs durch die Stadtmauer am Steinentor verschlossen war, hochzuziehen. Das Wasser sollte basz seinen louff nehmen, wie Konrad Schnitt berichtet. Doch das Gewölbe über den Einlasskanälen, auf denen die Leute arbeiteten, brach plötzlich unter ihnen zusammen: Sie stürzten in den reißenden Fluss – etlich, sagt Schnitt, konnten sich schwimmend retten, und ettliche ertrancken. Auch dabei mochte der Ryffsche Chronist der bessere Beobachter sein: Er zählt dry burger, die an diesem Ort zu Tode gekommen seien. In ihren überfluteten Häusern hatten sich derweil die Bewohner in die oberen Stockwerke geflüchtet, so hoch hinaus, wie es irgend ging. Und dennoch glaubte nach dem Anonymus niemand, dass er sicher wer. Panik hatte das so plötzlich hereinbrechende Hochwasser unter den Menschen verbreitet.
Befestigte Stadt und ‚wilde‘ Natur – das Steinentor und der Einfluss des Birsigs in Basel (vor 1865)
Auch zahlreiche Tiere wurden Opfer der Flut – Rösser, Schweine und Hühner. Der Autor der Chronik des Fridolin Ryff gedenkt besonders eines Pferdes, es gehörte dem Knecht im öffentlichen Kaufhaus Basels. Das Ross fiel durch das unter den Wassermassen zusammenbrechende Gewölbe, das den Birsig am Kaufhaus überdeckte, hinab in die Flut und ertrank. Und Konrad Schnitt will Hühner beobachtet haben, so das wasser emportrug – man habe sie lebendig auf dem Kornmarktplatz umherschwimmen sehen.
Die Häuser von Bürgern und Einwohnern, die Werkstätten der Handwerker, die Läden der Krämer – alles stand durch und durch im Wasser. Es kam offenbar zu schweren Schäden am Inventar, am Handwerkszeug, an gelagerten Waren: Alles wurde nass, das Hochwasser habe vil Gut fortgetragen, denn, kommentiert der Anonymus der Ryffschen Chronik, wasz es ergreyff, must hinweg. Hinweggetragen wurde auch der neue, sich gerade im Bau befindende Brunnen auf dem Kornmarkt – stock, dach, trog und alsz – mitsamt dem Gerüst, das der städtische Bauhof zu dessen Errichtung aufgeschlagen hatte. Man fand die Teile, als sich das Wasser verlaufen hatte, hinter der ‚Schal‘, dem öffentlichen Schlachthaus, wieder, dessen Metzgerbänke gleichfalls von der Flut weggespült worden waren.
Überhaupt widmen die Augenzeugen viel Aufmerksamkeit den Beeinträchtigungen am ‚Gemeinen Gut‘, den Schäden an Stadtmauer, Birsiggewölben, Brücken und Straßen. Überall im Stadtgebiet sei die Straßenpflasterung, so berichten sie, aufgerissen worden. Als die Flut wich, hätten sich Löcher aufgetan, die rund um den Fischmarktbrunnen so tief gewesen seien, dass man, wie Konrad Schnitt betont, die steinerne Überwölbung des Birsigs gesehen habe, worauf der Fischmarkt ruhte. Der Verfasser der Chronik des Fridolin Ryff beklagt besonders die Schäden im Kaufhaus. Zu schnell sei die Flut gekommen, so dass viele Waren, die dort lagerten, Samt, Seidenstoffe, Tuche und anderes, nicht hätten in Sicherheit gebracht werden können. Doch beließ man es nicht bei derlei einzelnen Schadensnachrichten – Beobachter von Katastrophen sind seit jeher gierig auf die ‚große Zahl‘. Und so erzählte man sich denn im entfernten Gebweiler über das Basler Unglück: mit hundert taussendt gulden möcht man den schaden nicht bezahlen. Von wahrhafftigen leüth, von Augenzeugen, habe er solches gehört, schreibt Hans Stoltz. Die Gesamteinnahmen der Stadt Basel betrugen im Haushaltsjahr 1529/30 gerade einmal 18.374 Rheinische Gulden.42 Insgesamt aber muss das Ausmaß der Zerstörung schon sehr groß gewesen sein. Denn die eher unverdächtigen Aufzeichnungen einer Untersuchungskommission aus Ratsherren und Werkmeistern, die der Basler Rat offenbar Wochen nach der Katastrophe im Juli 1530 damit beauftragte, die Schäden an öffentlichen Bauwerken und Anlagen aufzunehmen, geben auch in ihrer Ausschnitthaftigkeit einen guten Eindruck von den Folgen der Flut. Da fand man zahlreiche Gewölbe und Brücken der Birsig-Überbauung mechtig boß, was besonders dort problematisch war, wo wie am Fischmarkt Häuser darauf gegründet worden waren. An den Mauern der Stadtbefestigung beklagten die Sachverständigen, dass die Wasserflut durch Unterspülungen zahlreiche Löcher hinterlassen und vorgelagerte Wallanlagen hinweggetragen hatte. An der Barfüßermühle fehlten die Wasserräder und zahlreiche privets, die Abtrittgruben städtischer Häuser, waren voll vom Geschiebe des Birsigs.43