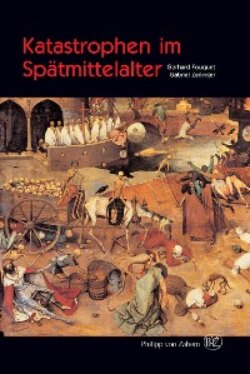Читать книгу Katastrophen im Spätmittelalter - Gerhard Fouquet - Страница 8
daß die leut alle sturben 21 – Die bedrohte Existenz in der Augsburger Chronik Burkard Zinks
ОглавлениеChronisten wie historische Zeitzeugen generell leiden in der Regel an Quellenamnesie, wie die moderne Gedächtnisforschung derartige Erscheinungen nennt. Sie vermischen ihre eigenen Erinnerungen, so lückenhaft sie auch immer sein mögen, mit angenommenen Vorstellungen von Gott und seiner Welt, mit herkömmlichen Meinungen des immer Gleichen, mit spektakulären und akzeptierten Erzählmustern, mit ihren Lebensformen und dem dadurch gelenkten Blick auf die Welt und mit manchem anderen mehr. Die derart erzeugten Mischungen werden dann, unbesehen, für den eigenen Gedächtnisinhalt genommen. Solche historischen Erzählungen sind daher keine bewussten Lügen, es sind Erzeugnisse verzerrender Gedächtnisbildung, mit denen historische Quellenkritik rechnen muss. Und doch sind gerade die Chroniken mit ihren spezifischen Erzählzusammenhängen faszinierende Fenster in die Vergangenheit.
Unter den deutschen Chronisten des Spätmittelalters nimmt der Augsburger Burkard Zink (1396–1474/75) eine besondere Stellung ein. In seiner in den 1450er und 1460er Jahren verfassten und in vier ‚Büchern‘ gegliederten Chronik, die einen Berichtszeitraum von 1368 bis 1468 hat, erzählt er meistenteils als Zeitgenosse über sein Leben, seine Familie, seine neue Heimatstadt Augsburg und seinen süddeutschen Nah- und Fernraum, folglich sowohl über vermeintlich ‚große‘ und vermeintlich ‚kleine‘ Begebenheiten. Der Sohn eines Memminger Handwerkers war nach Schul- und Wanderjahren 1419 gänzlich mittellos, weil um den Anteil am elterlichen Erbe gebracht, erneut nach Augsburg gekommen, blieb dort und arbeitete sich vom Hilfsschreiber und Kaufmannsgehilfen zum Faktor mehrerer großer Handelsfirmen empor. Zink war mit Haus und Kleinfamilie versehen, ging nacheinander vier Ehen ein und hatte insgesamt 20 Kinder, von denen wie damals häufig der Fall nur ein Teil den Vater überlebte. Seinen bemerkenswerten sozialen Aufstieg krönte er schließlich mit Ämtern der Reichsstadt Augsburg.22 Uns interessieren hier aber vor allem seine Wahrnehmung und Schilderung von Katastrophen, die bisweilen schwere Auswirkungen selbst auf ihn und seine Familie hatten. Ein nur kursorischer tabellarischer Überblick über die von ihm notierten extremen, nur zum Teil katastrophalen Ereignisse vornehmlich in Oberdeutschland zeigt, selbst wenn man die vielen, fast ständig irgendwo in der Region wütenden Kriege und Fehden sowie einzelne vermerkte Häuserbrände abzieht und obendrein nur seine eigene Lebenszeit berücksichtigt, wie bedroht Zink Leben und Wohlergehen wahrnahm bzw. erinnerte. Damit ist er zwar durchaus typisch für seine Zeit und für die Neigung nicht nur der städtischen Chronistik im Mittelalter, das Besondere, eben auch das Katastrophale hervorzuheben. Aber Burkard Zink gewährt uns insbesondere in dem dezidiert autobiographischen dritten Buch seiner Chronik immer wieder auch Einblicke in sein Haus, in seine Familie und in ihre Katastrophenerfahrung.
| 1417 | Viel Schnee in einem überaus kalten Winter schädigt das Korn. Dies führt zu hohen Kornpreisen. |
| 1418 | Der Schnee schmilzt spät, Teuerung bei Wein und Korn; Burkhart Zink (der Vater des Chronisten) stirbt an einer grassierenden ‚Pestilenz‘, Ernteausfälle in Folge der Seuche. |
| 1419 | Hochwasser und Überschwemmungen oberhalb von Meran beschädigen Häuser, Brücken etc. |
| 1420 | Großes Sterben in Augsburg (viele Menschen fliehen als Folge aus der Stadt). |
| 1424 | Haus des Hans Gossembrot an der Judengasse brennt nieder und 24 Gesellen werden bei Aufräumarbeiten erschlagen. |
| 1429/30 | Großes Sterben in Augsburg (unter den Toten auch Zinks Töchter Anna und Dorothea). |
| 1433/34 | Teuerung (besonders durch Anstieg der Kornpreise). |
| 1437–39 | Getreideknappheit und Teuerung in Oberdeutschland, Flandern und anderen Regionen, in der Folge Hungerkrise. |
| 1438 | Großes Sterben in Augsburg (angeblich 6.000 Tote, Zinks Sohn Konrad stirbt, während Zink und seine Frau genesen). |
| 1442/43 | Kalter und schneereicher Winter führt dazu, dass die Mühlen bei zugefrorenen Gewässern nicht mahlen können. Daher kommt es durch Mangel an Mehl und Brot zu einer Hungersnot. |
| 1446 | Raupenplage im Kohl; früh einsetzender Winter. |
| 1447 | Hall in Tirol brennt nieder (50 Tote); 36 Häuser in der Vorstadt von Landsberg am Lech abgebrannt; Gossensaß am Brenner verbrennt auch ganz. |
| 1448 | 12.09.: Großer Hagel zerstört Früchte in Gärten, Bäume und Dächer (u. a. auch Glasfenster in der Lieb-Frauen-Kirche). Ein weiterer Hagel fordert auch Menschen und Vieh das Leben. |
| 1450 | Gnadenjahr zu Rom: Bei Gedränge auf der Tiberbrücke sterben mehr als 300 Menschen. |
| 1457/58 | Andauernde Münzverschlechterung (‚böse‘ Münze), Inflation, Hunger; außerdem Trockenheit. |
| 1459 | 21. Mai: Beginn einer großen Kälte (Ware wie z. B. Wein erfriert); neue Münze führt auch zu Teuerung (niedrige Löhne für Arbeiter und Hunger in der Bevölkerung). |
| 1460 | 18.–24.05.: Haus der Chor- oder Domherren und Karmelitenkloster brennen nieder; Tollwut verbreitet sich auf Menschen (mehrere Tote) und später auch auf Schweine, Verbot von Fleischverkäufen. |
| 1462 | 27.08.: Großer Sturm in Augsburg und Umland; wieder Teuerung. |
| 1462–63 | Mehrere Seuchen suchen Augsburg heim, die rot ruer fordert viele Menschenleben in Augsburg angeblich bis zu 11.000 (wohl stark übertrieben). |
| 1463 | Raupenplage auf Obstbäumen. |
| 1466 | Mehltau an den Bäumen verdirbt wieder das Obst; Krankheit (Husten) fordert viele Kinderleben in Augsburg und Umgebung. |
| 1467 | Großes Sterben in Ulm, Memmingen und Umgebung. |
Zunächst einmal fällt an diesem Kaleidoskop größerer wie kleinerer Katastrophenfälle auf, welch große Rolle Getreide- und Obstknappheit, Fleischteuerung, Münzverschlechterung und die Konsequenz all dessen, nämlich Hunger bei den ärmeren Schichten, in den Beobachtungen Burkard Zinks spielen. Zink wusste genau, wovon er sprach. Seine Tätigkeit als städtischer Korn- und Weinungelter in Augsburg, also als Zuständiger für die Erhebung der Verkaufs- bzw. Verbrauchssteuer auf Getreide und Wein, dürfte seinen Blick auf diese Probleme geschärft haben. Zudem hatte er eigene Erfahrungen mit der Hungerleiderei machen müssen. Er war jahrelang als wandernder Scholar und Kaufmannsgehilfe durch das Land gezogen: ich petlet das prot. 23
Und harsch waren die Zustände nach klima- oder marktbedingten Lebensmittelverknappungen in und um Augsburg: Von 1437 bis 1439/40 herrschte in weiten Teilen des Reichs, ja Europas nach besonders kühlnasser Witterung ein ungeheurer Getreidemangel, wie noch eigens darzustellen sein wird.24 Diese Marktsituation bewirkte einen extremen Anstieg der Getreidepreise. Beides kam v. a. den Armen in Stadt und Land im wahrsten Sinne ‚teuer‘ zu stehen, bildete Getreide doch die Hauptgrundlage ihrer Speise. Die armen Leute aßen es vornehmlich als Muß, das ‚tägliche Brot‘ des ‚Vaterunsers‘ mussten sie erbetteln. Den Winter 1442/43 schildert Zink wieder als so hart. Man habe von Augsburg bis nach Venedig mit Schlitten fahren können. Da alle Gewässer gefroren waren, seien die Mühlen in Augsburg drei Wochen lang stillgestanden. Dies habe zu einem unerhörten Mangel an Grundnahrungsmitteln in der Stadt geführt. „Es war hier in der Stadt wegen des Hungerns eine so große Not unter den armen Leuten, sie hatten weder Brot noch Mehl. Acht Tage lang gab es zudem kein Fleisch und alle anderen Dinge, weil niemand bei der Kälte und dem Schnee unterwegs sein wollte. Gott, Herr, hilf uns und erbarm dich über uns!“25
Als guter Haushälter, der sich in wiederkehrenden Bilanzen über sein Leben, seine Vorräte und sein Vermögen Rechenschaft ablegte, gelang es Burkard Zink offenbar, seine Familie vor den schlimmsten Auswirkungen der Hungerkrisen in Augsburg zu bewahren. Gegen die alle paar Jahre wiederkehrenden Epidemien, gegen die Pest und gegen die schrecklichen sterb, die die Menschen auch immer heimsuchen mochten, waren Zink und seiner Familie freilich nicht immer hilfreiche Kräutlein gewachsen. Zinks Vater starb 1418 in Memmingen an der pestilentz, von der zwölf Jahre später auch Anna und Dorothea, seine neun und drei Jahre alten Töchter aus der ersten Ehe mit Elisabeth Störkler, dahingerafft wurden.26 1438 kam ein ‚großes Sterben‘, eine besonders letale Seuche nach Augsburg, an der ungefähr 6.000 Menschen gestorben sein sollen. „Und ich, Burkard Zink, lag auch schwerkrank darnieder.“ Er habe besonders an zwei Stellen an Symptomen gelitten: an dem hals und an dem bain bei den gemächten (Genitalien). Wenn es sich dabei naheliegenderweise um starke, schmerzhafte Lymphknotenschwellungen handelte, könnten diese als Indiz auf die ‚echte‘ Pest gedeutet werden. Zink und seine zu der Zeit hochschwangere und ebenfalls angesteckte Frau wurden so schwach, dass man beiden bereits die Sterbesakramente erteilte. Doch gab Gott zu, daß wir baide wider gesunt wurden, Gott sei gelopt.27 Der kleine Sohn Konrad hatte nicht genügend Widerstandskräfte, er starb an der Krankheit. Die Trauer und das Leid der Eltern über den Tod des Kindes bzw. wie so oft mehrerer Kinder muss genauso groß wie zu allen Zeiten gewesen sein, selbst wenn man in den Selbstzeugnissen jener Zeit (noch) nicht viele Worte dafür fand. Die lange behauptete vermeintliche Schicksalsergebenheit oder gar die Gefühlsarmut des Mittelalters sind typische Kopfgeburten der Neuzeit und ihres Modernisierungsmythos.28 In einem Brief ließ Martin Luther kurz nach dem Tod seiner nur knapp acht Monate alten Tochter Elisabeth im August 1528 seiner Trauer freien Lauf: „Gestorben ist mir mein Töchterlein Elisabethchen; es ist seltsam, welch trauriges, fast weibisches Herz sie in mir hinterlassen hat, so bewegt mich der Jammer über sie. Nie zuvor hätte ich geglaubt, daß die väterlichen Herzen bei ihren Kindern so weich werden“.29
In Augsburg schildert Burkard Zink besonders ausführlich das neuerlich heftige Seuchenjahr 1462, in dem gleich drei schwere Epidemien in der Stadt grassierten und entsprechend viele Tote zu beklagen waren: die wie auch immer geartete ‚Pestilenz‘, die „rote“ Ruhr und noch eine Krankheit, die Zink mit Kopf- und Leibschmerzen und als vergleichsweise weniger tödlich beschreibt. Der Tod habe bis in das Jahr 1463 hinein alle Alters- und Sozialgruppen heimgesucht, „aber es starben doch mehr junge denn alte Menschen“. Als die Todesraten im Sommer 1463 noch einmal anschwollen, ward den reichen leuten grausen und viele von ihnen seien aus der Stadt geflohen – vermutlich auf ihre Landsitze in der Umgebung der Stadt. Der Augsburger Stadtadel handelte dabei so, wie Giovanni Boccaccio das Verhalten der Florentiner Elite während des ersten Pestumzuges 1348 in der Rahmenhandlung seines ‚Decamerone‘ beschrieb. Zink kommentiert die Flucht der Mächtigen nicht näher – schließlich war er in Kontor und Rathaus die rechte Hand dieser Leute. So ruft er retrospektiv noch einmal Gott um Hilfe an – nur um ihm wenige Zeilen später dafür zu danken, dass die Lebensmittelpreise damals so günstig gewesen seien. Als der gewissenhafte städtische Amtsträger, der Zink in diesen Jahren war, beschreibt er außerdem ausführlichst die Probleme, welche die Bestattung der vielen Toten in der Stadt bereitete: Es mussten nicht wenige Massengräber ausgehoben werden.30 Vielleicht aus eigener Erfahrung heraus dauerten ihn besonders die vielen Kinder, welche im Herbst 1466 vermutlich einer Keuchhustenepidemie erlagen: und sturben vil kind an dem huesten, also daß sie erstickten.31
Doch Burkard Zink nahm auch katastrophale Ereignisse weit ab von Augsburg wahr, die er folglich nur vom Hörensagen kennen konnte. Freilich war das Hörensagen entlang der Augsburger Handelsrouten besonders dicht. So ist ihm ein heftiges Hochwasser im Passeiertal und in Meran im Jahre 1419 genauso einen Absatz wert wie der verheerende, von der Eisenschmiede außerhalb der Stadtmauer ausgehende Stadtbrand von Hall in Tirol 1447, bei dem über 50 Tote zu beklagen gewesen sein sollen. Über die eigentliche Kausalität aber war sich Burkard in diesem Fall ganz im Klaren: „Ich bin mir sicher, dass es eine Strafe und Plage von Gott wegen unserer großen Sünden war“. Doch es will sich laider niemant beßern.32 Die Sündhaftigkeit der Welt sei es auch gewesen, die so viele Gläubige zum Gnadenjahr 1450 nach Rom geführt habe. Dabei kam es an einem Tag auf einer Tiberbrücke zu einem heftigen Gedränge mit anschließender Panik, in der viele Menschen den Tod fanden. Seine beiden Gewährsmänner, die das Chaos überlebt hatten, seien noch beim Erzählen von dem grauenhaften Geschehen gezeichnet gewesen, schreibt Zink, weil etliche vor ihren Augen gestorben seien – im Heiligen Jahr, es möchte Gott erbarmen.33
Insgesamt zeigt sich, dass Burkard Zink wie praktisch alle seine Zeitgenossen Gottes Wirken als Motor der Naturereignisse ansah – „Gott argumentierte mit der Natur“ für die Menschen im Mittelalter.34 Wir werden das in den erzählten Exempeln von Extremereignissen dieses Buches immer wieder feststellen. In der vormodernen göttlichen Weltenmechanik mussten Extremereignisse, Katastrophen unweigerlich als Strafe angesehen werden. Aber es gab doch auch Ausnahmen: Ging es um die Folgen allzu menschlichen Handelns, wie etwa bei der bewusst herbeigeführten Emission schlechter, d. h. nicht werthaltiger Münzen durch die bayerischen Herzöge in den Jahren 1459/60, welche Inflation und Hunger bei den Armen zur Folge hatte, dann nennt Zink die Dinge durchaus bei ihrem irdischen Namen – „da ging es manchen schlecht und andere sind reich geworden“ – Katastrophen also auch von Menschenhand!35