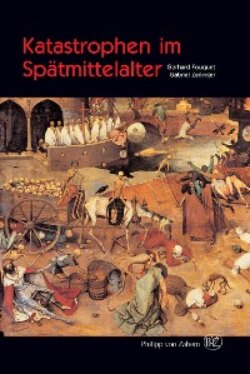Читать книгу Katastrophen im Spätmittelalter - Gerhard Fouquet - Страница 6
Einleitung –
Katastrophen als ‚conditio humana‘
Оглавление„Erdbeben und Tsunami in Japan: Eine Katastrophe mit unabsehbaren Folgen. Ein gewaltiges Erdbeben mit unabsehbaren Folgen schockiert Japan und die Welt: Der Erdstoß der Stärke 8,9 löste einen Tsunami aus. Eine gewaltige Flutwelle überspülte die Ostküste der japanischen Hauptinsel Honschu. Nach ersten offiziellen Angaben kamen Hunderte Menschen ums Leben. Zahlreiche Bewohner der Küstenregionen und betroffenen Städte wurden verletzt. Der ARD-Korrespondent Philipp Abresch berichtete, es würden viele weitere Opfer befürchtet.“ (ARD Tagesschau extra, 12.30 Uhr, 11. März 2011).
„Item als man nach Christi Geburt eintausend dreihundert und sechsunddreißig Jahre zählte, da erhob sich auf das Fest Simonis und Jude [28. Oktober 1336] ein großer Sturm, der verursachte große Schäden, der warf große (Stein-)Häuser, Holzbauten und Türme nieder und fällte große Bäume in den Wäldern.“ (Tilemann Elhen von Wolfhagen, Limburger Chronik, vor 1398)1
Die ersten Monate des Jahres 2011 waren in der Wahrnehmung der globalen Öffentlichkeit von einer Katastrophe größten Ausmaßes geprägt: Am 11. März wurde Japan von einem bislang in dieser Stärke (9,0) für unwahrscheinlich gehaltenen Erdbeben vor seiner Nordostküste erschüttert mit verheerenden Folgen: Es erhob sich ein gewaltiger Tsunami, der zusammen mit dem Beben weite Teile der Nordostküste überflutete, ungefähr achtundzwanzigtausend Menschen das Leben kostete und Hunderttausende ihrer Habe beraubte. Der Tsunami verursachte eine Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima, wodurch Meer und Region schwer verstrahlt wurden und Hunderttausenden wohl auf Dauer die Heimat nahm. Die materiellen Schäden werden auf rund 220 Milliarden Euro geschätzt – die teuerste Naturkatastrophe bisher. Selbst wenn die Wahrnehmungsweisen und Erklärungsansätze zu Katastrophen und ihren Folgen heutzutage grundsätzlich andere sind als im Mittelalter, so gehört die Katastrophenerfahrung der Betroffenen selbst doch zu den wenigen Aspekten menschlichen Lebens, die tatsächlich Gemeinsamkeiten über die Epochen der Geschichte hinweg erzeugen. Das wird eindringlich verdeutlicht in der Erdbeben-Meldung der ‚Tagesschau‘ vom März 2011 und in der Reminiszenz an einen Sturm im Jahre 1338, mit der Tilemann Elhen seine Limburger Chronik beginnt.
Was mit so unaufhaltsamer, plötzlicher Gewalt in das Alltagsleben eindringt, was diesen Zustand des Unbewussten radikal in Frage stellt und Geschichte auch als Teil der Geographie erweist, hat Menschen noch nie ruhen lassen. Katastrophen gehören ganz zentral zur „conditio humana“2, zu den natürlichen und kulturellen Grundgegebenheiten menschlicher Existenz. Sie sind ‚mitten im Leben‘, man hat mit ihnen zu rechnen. Katastrophen reißen Betroffene wie Beobachter aus dem Immergleichen des Alltags und fordern nach Bewältigung ihres zerstörerischen Werks. Sie bieten auch Überlieferungschancen, sie erzeugen sozusagen Quellen. Doch solcher Überlieferung waren die wissenschaftlich akzeptierten Erinnerungsräume mediävistischer Forschung lange verschlossen, Katastrophennachrichten eigneten sich bestenfalls für Jubiläen, für national- oder lokalgeschichtliche Traditionspflege. Lucien Febvre hat zwar schon 1922 eine verstärkte Hinwendung der historischen Forschung zu den geographischen Grundlagen der Geschichte gefordert3, die Mediävistik hat sich diesen Perspektiven freilich erst seit den 1970er Jahren geöffnet und als Humanwissenschaft vornehmlich die Auswirkungen der anthropogenen Umweltveränderungen auf die Daseinsbedingungen der Menschen untersucht. Die Fragen richteten sich darauf, wie sich die wirtschaftenden Individuen und Gemeinschaften die Natur (Klima, Boden, Flora und Fauna) aneigneten, wie sie in natürliche Prozesse eingriffen, wie überhaupt die Zeitgenossen ihre natürliche Umwelt wahrnahmen und von ihr beeinflusst wurden.4 In den 1990er Jahren entwickelte man in Konsequenz des sozialwissenschaftlichen Konzeptes ‚Historische Kulturwissenschaft‘ eine ‚Kulturgeschichte der Natur‘.5 Doch erst in den letzten Jahren fielen die methodischen Überlegungen, die Arno Borst seit 1974 unter dem Eindruck der Mentalitätsgeschichte über die extremen Ausnahmezustände im Verhältnis von ‚Natur‘ und ‚Mensch‘ vorlegte6, auch in der deutschsprachigen Mittelalterforschung auf fruchtbaren Boden.7
In diesem Buch werden mittelalterliche Katastrophenerfahrungen anhand von Quellenzeugnissen vornehmlich vom 13. bis zum beginnenden 16. Jahrhundert erzählt und analysiert. Als ‚Katastrophen‘ verstehen wir dabei jene „Extremereignisse“8, die nicht nur im materiellen Sinne zerstörerisch waren, sondern auch deutliche Auswirkungen auf die Lebensformen zumindest einer sozialen Gruppe am Ort des Geschehens hatten. Daher werden neben Naturkatastrophen, zu denen man auch Seuchen zählen kann, überdies Stadtbrände oder wirtschaftliche Extremlagen wie Teuerung und Hungerkrisen – sei es als eigenständiges Phänomen oder als Folgeerscheinung anderer Extremereignisse – betrachtet. Anders als in vielen Büchern zum Thema werden aber auch der Krieg, die soziale Katastrophe schlechthin, und die Geldkrise als öffentliche wie individuelle Extremereignisse berücksichtigt. Und schließlich sollen, in bewusster Überschreitung des hier angewandten Katastrophenverständnisses, mit den ‚Schiffskatastrophen‘ die wohl häufigsten und schwersten Verkehrsunglücke des Mittelalters erwähnt werden.