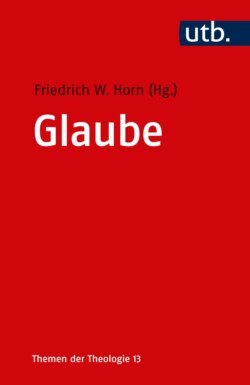Читать книгу Glaube - Группа авторов - Страница 16
9. Das Ecksteinwort Jesaja 28,16
ОглавлениеJes 28,16bβ ist der zweite Beleg im Buch Protojesaja: hammaʾamîn loʾ yāḥîš (»Wer glaubt, der weicht/eilt/flieht nicht!«). Wie in Jes 7,9b ist auch hier Ausdruck und Folge des Glaubens die Standhaftigkeit, und der Anlass für das Motiv ist wieder das Bündnisverbot.
Jes 28 beginnt in V. 1–13 mit einem »Wehe« gegen »die stolze Krone« von Ephraim, hoch »auf dem Haupt des fetten Tals« gelegen und voll lallender Trunkener. Die wütende Polemik richtet sich anscheinend gegen ein prosperierendes, auf einem Berg thronendes Heiligtum im Gebiet des (ehemaligen) Nordreichs. Ihm wird der Untergang durch einen Starken und Mächtigen angesagt, der wie ein schreckliches Unwetter dreinfahren und es einreißen wird (V. 2). In der Folge wird Jahwe selbst für den Rest seines Volkes wieder die herrliche Krone sein. Der Abschnitt mündet in V. 13 in ein »Wort Jahwes« – der Begriff ist im Buch Jesaja ungewöhnlich –, das das Lallen der Trunkenen »ṣaw lāṣāw ṣaw lāṣāw qaw lāqāw qaw lāqāw« zur Drohung werden lässt: »dass sie gehen und rücklings straucheln, zerbrechen, sich verstricken und gefangen werden.«
Im nächsten Abschnitt V. 14–22 folgt ein weiteres »Wort Jahwes«, nun als direkte Anrede. Diesmal richtet es sich nach Süden: gegen die Übermütigen, die über das Volk in Jerusalem herrschen. Sie werden mit ihren eigenen Worten überführt: »Denn ihr spracht: Wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich Vertrag gemacht. Die strömende Geißel, wenn sie einherfährt, wird uns nicht treffen« (V. 15abα). Die »strömende Geißel«, ein Attribut des dreinfahrenden Wettergotts (Gese 1970: 131f.), benennt eine ähnliche militärische Bedrohung, wie sie in V. 3 dem Norden galt. Die Rettung suchen die Oberen Jerusalems in der Bündnispolitik. Die aber, so die Polemik, trägt das Verderben in sich selbst: Die Bundesgenossen sind Tod und Totenreich. Mit ihnen im Bunde wird das Unheil nicht |20|abgewehrt, sondern im Gegenteil heraufbeschworen. Es kommt von Jahwe selbst: »Darum, so spricht […] Jahwe: […] Die strömende Geißel, wenn sie einherfährt, werdet ihr von ihr niedergewalzt werden« (V. 16aα.18b; dazu Müller 2014).
Anklage und Drohung, die wortgenau aufeinander bezogen sind, werden von einer Verheißung für den Zion auseinandergerissen: dem »Ecksteinwort«. Dieses Bildwort hat möglicherweise einst anders angeschlossen. »Es wäre doch zu merkwürdig, annehmen zu wollen, daß diese verheißenden Verse mitten in einer Unheilsweissagung ihren legitimen Ort haben sollten« (Herrmann 1965: 143). Sie klingen wie das positive Gegenstück zu der Drohung gegen die stolze Krone Ephraims:
16[…] Siehe, <ich lege> in Zion einen Stein, einen Festungsstein (?), einen kostbaren Eckstein als Fundament [<als Fundament>: Wer glaubt, der weicht nicht!] 17und mache das Recht zur Richtschnur (leqāw) und die Gerechtigkeit zum Senklot. Und Hagel wird wegfegen die lügnerische Zuflucht, und Wasser wird das Versteck wegschwemmen. 18Gesühnt werden wird euer Bund mit dem Tod, und euer Vertrag mit dem Totenreich wird nicht zustande kommen.
Während die Krone Ephraims ins Tal gerissen wird, ist der Tempel in Zion fest gegründet. Das Stichwort qaw (»Richtschnur«), das in dem Lallen der Trunkenen anklang, wird zum Anlass der Verheißung, dass Jahwe das Heiligtum von Jerusalem auf Recht und Gerechtigkeit gründen will.
Das Bildwort wird unterbrochen von der Mahnung »Wer glaubt, der weicht nicht!« (V. 16bβ). Man hat wieder und wieder versucht, diesen Satz als ursprünglichen Teil der Aussage zu deuten (vgl. zuletzt Hartenstein 2004). Doch das will nicht recht gelingen. »Tatsächlich spricht eine Reihe von Gründen dafür, die Wendung […] als Deutung der vorangehenden metaphorischen Rede zu begreifen« (Barthel 1997: 324). Deshalb ist auch hier am wahrscheinlichsten, dass das Motiv des Glaubens hinzugefügt worden ist. Das zweite mûsād (»als Fundament«) (Wildberger 1982: 1067: »zweifellos Dittographie«) könnte sogar das Stichwort (Lemma) für eine Randglosse gewesen sein. Die Masoreten haben es als Partizip mûssād (»gegründet«) gelesen, um dem jetzigen Text notdürftig einen Sinn abzugewinnen. Der Zusatz bewirkt, dass der ganze Vers nunmehr »als eine ins Positive gewendete Variante des Wortes vom Glauben in 7,9b zu lesen« ist (Barthel 1997: 325).
Nicht nur der Wortlaut beider Stellen hängt eng zusammen; auch der Anlass ist derselbe wie dort: Die Oberen Jerusalems machen Bündnisse, statt allein auf Jahwe und auf seine Verheißung zu vertrauen. »In diesem Zusammenhang gewinnt auch lʾ yḥyš [sc. ›der weicht nicht‹] |21|einen guten Sinn. Es beschreibt die politische Konkretion des Glaubens im Unterschied zur Politik der militärischen Bündnisse […]. Das ›nicht eilen‹ ist ein prägnanter Ausdruck für jene Haltung des Stilleseins, die ausführlicher in 30,15 und auf andere Weise auch in 7,4 beschrieben wird« (Barthel 1997: 324). Der Verweis auf Jes 30,15 trifft die Sache: »In Stillesein und Vertrauen läge eure Kraft.« Das isolationistische Gottvertrauen bestimmt nicht nur die Theologie der Chronik, sondern ist nachdrückliches Programm auch der späten Ergänzer des Jesajabuchs. Wieder ist auch an Ex 14,14 zu erinnern: »Jahwe wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein!« Wahrscheinlich stammt die polemische Verballhornung, die in V. 15bβ das Zitat der Oberen fortführt (vgl. Müller 2012: 59), von derselben Hand: »Denn wir haben Lüge zu unsrer Zuflucht gemacht und uns versteckt in Trug.« Als Reaktion auf den Unglauben wurde dem Ecksteinwort in V. 17b–18a eine Drohung angehängt: »Und Hagel wird wegfegen die lügnerische Zuflucht, und Wasser wird das Versteck wegschwemmen. Gesühnt werden wird euer Bund mit dem Tod, und euer Vertrag mit dem Totenreich wird nicht zustande kommen.« Dass der Ausdruck loʾ tāqûm (»wird nicht zustande kommen«) wörtlich mit Jes 7,7 übereinstimmt, dürfte kein Zufall sein.