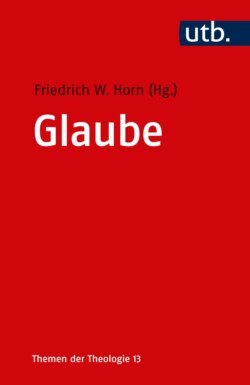Читать книгу Glaube - Группа авторов - Страница 20
13. Ein theologischer Schlüsselbegriff aus der Spätzeit des Alten Testaments
ОглавлениеMit dem Motiv des Glaubens hat die immer tiefer in den Text wie in die Sache eindringende theologische Reflexion den Kern der Gottesbeziehung auf einen schlüssigen Begriff gebracht. Wie gut das gelungen ist, zeigt die breite Wirkung im Neuen Testament und darüber hinaus. Gemessen daran erstaunt freilich, dass der Begriff im Alten Testament selbst nur an wenigen, wenn auch wichtigen Stellen begegnet. Der einfache Grund dafür ist, dass er erst in der Spätzeit entstanden ist.
Die meisten Belege sind erst nachträglich in ihren Kontext gekommen. Schon die ältesten von ihnen setzen das Bündnisverbot voraus, das für die Theologie der Chronik leitend gewesen ist. Dem Paktieren mit äußeren Mächten wird die Forderung des bedingungslosen |27|Glaubens an Jahwe entgegengestellt. Dieses Motiv hat auch im Buch Jesaja ein breites Echo gefunden. Der zeitgeschichtliche Anlass ist in der hellenistischen Zeit zu vermuten.
Der Begriff des Glaubens kann weder auf den Propheten Jesaja zurückgehen, wie man früher angenommen hat, noch stammt er aus der deuteronomistischen Theologie oder der Theologie der Priesterschrift, wenn er auch mit alldem gut zu vereinbaren ist, wie die Zusätze im Buch Jesaja sowie in den deuteronomistischen und priesterschriftlichen Texten zeigen. Eine besondere Affinität besteht zum Motiv der Gerechtigkeit (bes. Gen 15,6; Hab 2,4b). Die Anrechnung des Glaubens zur Gerechtigkeit steht im Horizont des (eschatologischen) Gottesgerichts.
Von anderen Verben, die die Gottesbeziehung beschreiben, unterscheidet sich hæʾæmîn darin, dass der Glaube auf die vorausgehende heilvolle Zuwendung Jahwes antwortet, auf Gottes Verheißungen und auf seine Wunder. Glaube, wie er im Alten Testament verstanden wird, ist seinem Wesen nach Antwort. Gerade deshalb ist der Unglaube, der Gottes Zuwendung ausschlägt, ein so schweres Vergehen. »Mit negiertem hʾmyn b/l wird […] ein theologischer Begriff […] gebraucht, mit dem das Mißtrauen gegenüber Jahwes Verheißen und Wirken zugunsten Israels als Mangel an Vertrauen auf Jahwe selbst, also als Schuld bezeichnet werden kann. […] Wenn durch solche Vertrauensverweigerung aber alle Landverheißungen und Führungszusagen praktisch zu Lügen erklärt werden, wird Gott selbst zum Lügner, wie das in 1Joh 5,10 gesagt wird: ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν« (Perlitt 2013: 111). »Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht.« Mit dem Glauben steht tatsächlich alles auf dem Spiel: »Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht!«
Das bedingungslose Festhalten an Gott ist das Wesen des Glaubens. Dabei gibt es eine Entwicklung, in deren Verlauf das »Sich-Festmachen« von einer Gegenstandsbeziehung – dem Festhalten an den Wundern, den Verheißungen, dem Wort – immer mehr zu einer personalen Beziehung wird, zum »glauben an«. In dieser Form wurde hæʾæmîn (»glauben«) zu einem Begriff eigenen Rechts für – man kann es nicht besser sagen – den »Glauben« an Gott. Die Semantik ist am Ende so eindeutig, dass man sie auch ohne Ableitung versteht.