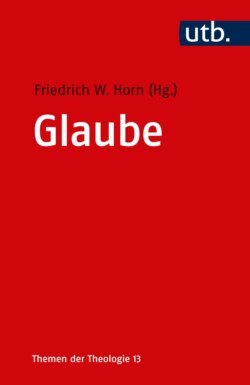Читать книгу Glaube - Группа авторов - Страница 17
10. Abrahams Glaube nach Genesis 15,6
ОглавлениеDer erste Beleg in der Lesefolge des Alten Testaments ist zugleich der bekannteste, weil Paulus ihn in Röm 4 und Gal 3 zitiert: »Und er (Abraham) glaubte an Jahwe (wehæʾæmin beyhwh), und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an.« Voran ging Abrahams Klage, keinen rechtmäßigen Nachkommen zu haben. Die Verheißungen, die Abraham erhalten hatte, drohten ins Leere zu gehen. Jahwe antwortet, indem er ihn auffordert, zum gestirnten Himmel aufzublicken: »So werden deine Nachkommen sein!«
Ursprünglich endete die Szene an dieser Stelle. Abrahams Reaktion ist später ergänzt worden. »Und er glaubte« (wehæʾæmin) ist grammatisch ein aramaisierendes Perfectum copulativum (Hoffmann 2006: 85f.), das oft am Einsatz literarischer Zusätze steht. Die Feststellung steht in Spannung zur anschließenden Erzählung von Jahwes Bundesschluss mit Abraham in V. 7–21, für die noch immer Abrahams Zweifel der Anlass ist. Die Szene Gen 15,1–5, die durch V. 6 gedeutet wird, gehört zu den Stücken, die erst lange nach der Verbindung von Jahwist |22|und Priesterschrift in den Pentateuch kamen, das heißt nicht vor Mitte bis Ende des 5. Jahrhunderts (Levin 2004).
Die Ergänzung ist folglich noch jünger. Abraham wird nachträglich als Vorbild dargestellt, als Vater des Glaubens. Die Feststellung setzt voraus, was sie begründen will: Abrahams Gerechtigkeit. Abraham, der Jahwe bald darauf als Anwalt der Gerechten entgegentritt (Gen 18,23–32), weil die Zerstörung Sodoms auch Gerechte treffen könnte, musste selbst ein Gerechter gewesen sein. Worin bestand seine Gerechtigkeit?
Die älteren Erzählungen kreisen darum, dass Abraham von Jahwe die Verheißung empfing. Jahwe verheißt ihm seinen Beistand und Segen, zahlreiche Nachkommen (Gen 12,2f.) und schließlich das Land (Gen 13,15). Auf diese Verheißung hin hat Abraham sein Vaterhaus verlassen, um in ein ihm unbekanntes Land zu ziehen. Auf diese Verheißung hin hat er Lot bei der Wahl, wo er siedeln wolle, den Vortritt gelassen (Gen 13,9). Das tat er gegen den Augenschein, hatte doch Jahwe das Land ihm und seinen Nachkommen zugesprochen. Aber Abraham zweifelte nicht, dass Jahwe seine Verheißung dennoch erfüllen werde. Vielleicht kann man auch Abrahams größten Gehorsam einbeziehen, als er bereit war, auf Gottes Geheiß den verheißenen Sohn zu opfern (Gen 22), denn sogar als Gott sich selbst widersprach, hielt Abraham an der Verheißung fest. Daraus zieht Gen 15,6 die Folgerung: Abraham »glaubte«. Wieder gibt es gute Gründe, dass Jes 7,9b das Muster dafür gewesen ist, das Festhalten an der Verheißung mit dem Wort hæʾæmin zu bezeichnen (Smend 1967: 247f.).
Abrahams Glaube war »die Leistung seines gesammten Lebens, die Gott von ihm forderte« (Smend 1899: 393), und dieser Glaube wurde ihm, vergleichbar dem Verfahren im kultischen Gottesbescheid (vgl. von Rad 1951a), zur Gerechtigkeit angerechnet. »Alles Gewicht liegt auf Gott und seiner Verheißung. Das einzig mögliche Verhalten des Menschen gegenüber der Verheißung ist das des Glaubens, des Entgegennehmens, des Sich-Einlassens auf die Verheißung« (Schmid 1980: 408). Unter dieser Voraussetzung bildet die Gerechtigkeit, und zwar die Gerechtigkeit aus dem Glauben, das Kriterium im (eschatologischen) Gottesgericht (vgl. Ez 18 u.ö.). Die Deutung, die Paulus gegeben hat, trifft genau: »Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs allergewisseste: was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch ›zur Gerechtigkeit gerechnet worden‹« (Röm 4,20–22).
|23|Hab 2,4b, der andere für Paulus ausschlaggebende Beleg (vgl. Röm 1,17; Gal 3,11), ist der Sache nach hier anzuschließen: »Der Gerechte wird durch seine Treue (bæʾæmûnātô) am Leben bleiben.« »Die ʾæmûnāh ist die unwandelbare Treue, das unverrückbare Vertrauen auf Gott, mit einem Worte: der Glauben, dass das Festhalten an Gott und seinem Willen das Heil bedinge. Leben hat hier den prägnanten Sinn von ›verschont werden im Gericht, Rettung, Heil erfahren‹ und die Aussage von V. 4b fasst das jesajanische Wort Jes 7,9 zusammen« (Marti 1904: 337). Auch dieser Satz steht nicht ursprünglich in seinem Kontext, sondern dürfte ein Nachtrag sein. »Die Zusammenbindung von 2,1–3 mit 2,4 bleibt problematisch« (Perlitt 2004: 66).