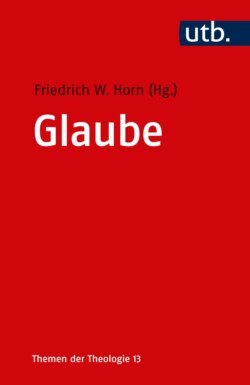Читать книгу Glaube - Группа авторов - Страница 19
12. Die Unbedingtheit der Glaubensforderung
ОглавлениеDas vorbehaltlose Vertrauen auf Gott ist Inbegriff der richtigen religiösen Haltung und zugleich eine ständige Herausforderung. »Es ist […] bedeutsam, daß von den 50 Stellen mit hʾmyn allein 33 Stellen verneint sind. Diese negierten Stellen bezeichnen, sofern sie in theologischem Zusammenhang stehen, nun alle mehr oder weniger deutlich das ›Nicht-Glauben‹ als die vor Gott unmögliche Haltung, ja als Sünde. Dagegen wird der Glaube als das rechte Verhalten, als die Grundhaltung des Frommen vor Gott deutlich« (Pfeiffer 1959: 154). Die Erinnerung an die Geschichte wird zur Mahnung an die Gegenwart.
Als die Kundschafter zurückkehren und berichten: »Das Land frisst seine Bewohner« (Num 13,32), und die Gemeinde sich daraufhin anschickt, nach Ägypten zurückzukehren (Num 14,1–5), und sie Mose und Aaron, die das verhindern wollen (V. 5–10a), mit Steinigung drohen, erscheint die Herrlichkeit Jahwes:
|25|11Und Jahwe sprach zu Mose: Wie lange soll dieses Volk mich lästern! [Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben (loʾ yaʾamînû bî) bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe!] 12Ich will es schlagen mit Pest und will es vernichten und dich zu einem größeren und stärkeren Volk machen als dieses.
Die Doppelung »und wie lange« zeigt, dass der Satz über den Unglauben ein »ungeschickt eingefügter« Nachtrag ist (Noth 1966: 96). Auch hier hat der Zweifel an der Autorität der religiösen Amtsträger das Motiv des Glaubens auf den Plan gerufen.
Anders als in Ex 4 lassen die Israeliten sich diesmal von den Wunderzeichen nicht überzeugen. In der Nacherzählung Dtn 1–3 findet sich das »traurige Fazit« (Perlitt 2013: 110): »Doch selbst daraufhin wart ihr ohne Glauben (ʾênekæm maʾamînim) an Jahwe, euren Gott« (Dtn 1,32). Als die Israeliten den Rückweg nach Ägypten einschlagen wollten, bedeutete dies, dass sie der Landverheißung den Glauben verweigerten. So hat auch Ps 106,24 es gedeutet: »Sie verachteten das kostbare Land; sie glaubten nicht (loʾ hæʾæmînû) seinem Wort.« »Die richtige Reaktion des Gottesvolkes auf die erfahrene Güte wäre […] gläubiges Vertrauen auf Jahwe gewesen, worin im Jahwekrieg die einzige angemessene Einstellung zu Gott lag (Ex 14,31; Jes 7,9; 28,16), und als Israel nun am Mangel des Vertrauens scheiterte […], wurde aus seinem Verhalten ein Paradigma des Unglaubens« (Veijola 2004: 39).
Auch in Dtn 9,23 hat Num 14,11 ein Echo gefunden (vgl. Schmitt 2001: 319): »Als Jahwe euch aus Kadesch-Barnea sandte und sprach: Geht hinauf und nehmt das Land ein, das ich euch gegeben habe!, da lehntet ihr euch auf gegen den Befehl Jahwes, eures Gottes, [und glaubtet nicht an ihn (weloʾ hæʾæmantæm lô)] und gehorchtet seiner Stimme nicht.« Die Doppelung zeigt, dass auch an dieser Stelle der Ungehorsam nachträglich als Unglaube bestimmt worden ist.
Bevorzugt richtete sich der Vorwurf des Unglaubens in der Spätzeit gegen die Bewohner des ehemaligen Nordreichs, die die Geschichte, wie Jahwe sein Volk in der Frühzeit geleitet und gerettet hatte, mit den Jerusalemern teilten, aber nicht entfernt daran dachten, ihren eigenen Kult aufzugeben. In dem großen Geschichtspsalm Ps 78, der »die Verwerfung Ephraims und die Erwählung Judas« (Hupfeld 1860: 354) begründet, wird die Heilsgeschichte zum Grund der Anklage. Trotz der Rettungswunder während des Wüstenzugs »glaubten sie nicht (loʾ hæʾæmînû) an Gott und vertrauten nicht auf seine Hilfe« (V. 22). Sogar als Jahwe die Wunderzeichen wiederholte, blieben die Israeliten bei dieser Haltung: »Sie sündigten weiter und glaubten nicht (weloʾ |26|hæʾæmînû) an seine Wunder« (V. 32). »Ihr Herz war nicht beständig bei ihm, und sie standen nicht fest (weloʾ næʾæmnû) in seinem Bund« (V. 37). In dem immer weiter vermehrten Geschichtsresümee 2Kön 17,7–23, das auf den Untergang des Nordreichs folgt, lautet ein zentraler Satz, Jahwe habe alle seine Knechte, die Propheten, zu ihnen gesandt, »aber sie gehorchten nicht, sondern waren halsstarrig wie ihre Väter, die nicht glaubten (loʾ hæʾæmînû) an Jahwe, ihren Gott« (2Kön 17,14). Die Halsstarrigkeit, die die Väter mit der Sünde des Goldenen Kalbs an den Tag gelegt haben (Ex 32,9; 33,3.5; 34,9; Dtn 9,6.13), wird nunmehr als Unglaube bestimmt.
Der Vorwurf blieb nicht auf die Polemik gegen die (Nord-)Israeliten beschränkt. Als die Rolle des Mose immer mehr an Bedeutung gewann, wurde der Umstand, dass in der Landnahme-Überlieferung nicht Mose, sondern Josua der Führer des Volkes war, zum Problem. Warum hatte Mose den Jordan nicht überschritten? In der Murr-Erzählung Num 20,12 wird in einem Nachtrag, der die Ätiologie von Meriba in V. 13 von ihrem Anlass in V. 11 trennt, die Anklage hinzugefügt: »Jahwe aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt (loʾ hæʾæmantæm bî), um mich vor den Augen der Israeliten zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe.« Es musste ein schwerwiegendes Vergehen gewesen sein, das verhinderte, dass Mose das Volk in das Land der Verheißung geführt hat, wie es seines Amtes gewesen wäre. Der Unglaube galt als die Sünde schlechthin.