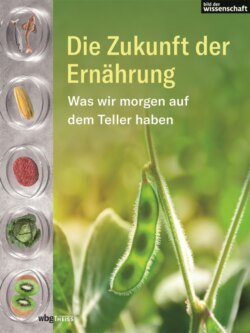Читать книгу Die Zukunft der Ernährung - Группа авторов - Страница 12
Ein auffallender Entwicklungssprung
ОглавлениеÜber Zeitpunkt und Hergang der Erfindung des Kochens ist, wie eingangs erwähnt, nichts Genaues bekannt. Der älteste jemals gefundene „Kochtopf“ (eine Tonschüssel mit Resten von erhitzten Meeresfrüchten) ist etwa 12 000 bis 15 000 Jahre alt und stammt aus der Jomon-Kultur in Japan. Der früheste hieb- und stichfeste Beweis für eine gezielte Garung von Nahrungsmitteln ist wesentlich älter: An der Fundstätte von Gesher Benot Ya’aqov im heutigen Israel kamen eine vor ca. 790 000 Jahren genutzte Herdstelle sowie verbrannte Essensreste zu Tage. Doch Richard Wrangham von der Harvard University ist sich sicher: Bereits vor weit über einer Million Jahren muss erhitzte Nahrung im Spiel der Evolution gewesen sein. Etwa zu jener Zeit, so Wrangham in seiner 1999 aufgestellten „Koch-Hypothese“, machte das menschliche Gehirn einen signifikanten Entwicklungssprung: von rund 40 Milliarden Neuronen beim Homo habilis, der vor etwa 2,1 bis 1,5 Millionen Jahren auf der Erde lebte, auf über 60 Milliarden Neuronen beim Homo erectus, der vor etwa 1,8 Millionen Jahren auf unserem Planeten auftauchte und erst vor ca. 40 000 Jahren wieder abtrat. Einen größeren Wachstumsschub habe es in der Evolution zum modernen Menschen kein zweites Mal gegeben; das sei einzig durch die Entdeckung des Kochens zu erklären, meint Wrangham.
Die ersten Kochtöpfe wurden vermutlich in der japanischen Jomon-Kultur zum Kochen von Meerestieren eingesetzt. Die Art der Keramik eignet sich zum Schmoren und Dampfgaren.
Eine gegenläufige Entwicklung zum Gehirn nahmen derweil unser Magen-Darmtrakt und der Kauapparat: Sie schrumpften allmählich. Beim Homo habilis, das belegen Skelettfunde, hatte die Gesamtkaufläche der drei großen Backenzähne noch 478 Quadratmillimeter betragen. Beim frühen Homo erectus hingegen waren es nur noch 377 Quadratmillimeter. Niemals in der menschlichen Evolution haben sich die Zähne stärker verkleinert wie beim Übergang von Homo habilis zu Homo erectus. Zusätzlich schrumpfte auch die Kaumuskulatur – das belegt der „Turkana-Junge“, ein ca. 1,5 Millionen Jahre altes Homo-erectus-Skelett, das im heutigen Kenia gefunden wurde: Die Schädelwand an seinen Schläfen ist viel dünner als beim Homo habilis. Der Homo erectus besaß demnach eine ähnlich geringe Kaukraft wie der moderne Mensch, der kein intaktes Gen MYH16 mehr besitzt, das für den Aufbau überdimensionierter Kiefermuskeln verantwortlich zeichnet. Der US-Genetiker George Perry wies nach: Bereits der Homo erectus hatte diese Funktion im Laufe der Evolution eingebüßt – jener Homo erectus also, der laut Richard Wrangham vor weit über einer Million Jahre die Kunst des Feuermachens und des Kochens erlernt hatte. Natürlich erntet Wrangham auch wissenschaftlichen Widerspruch: Der Homo erectus sei nicht intelligent genug gewesen, um seine Nahrung zu erhitzen, heißt es. Ein Experiment des Psychologen Felix Warneken und der Biologin Alexandra Rosati von der Harvard University legt etwas anderes nahe: Selbst Menschenaffen, die laut Anzahl ihrer Hirn-Neuronen gerade mal halb so intelligent sind wie der Homo erectus, können kochen – zumindest in Ansätzen. Warneken und Rosati ließen verschiedene Schimpansen eine Wahl zwischen gekochten oder rohen Süßkartoffeln treffen, durch Zeigen oder Berühren. Dabei stellten die Forscher fest, dass die Tiere gekochte Knollen eindeutig bevorzugten, selbst dann, wenn sie länger darauf warten mussten. Einige waren sogar bereit, ihre Nahrungsmittel eigenhändig zum Herd zu tragen, statt dem Drang nachzugeben, das verfügbare Rohfutter sofort zu fressen. Dazu passt auch die Beobachtung, dass wildlebende Schimpansen nach Waldbränden besonders gern geröstete Pflanzensamen fressen.
Ein in der kenianischen Koobi-Fora-Region gemachter Fund spricht ebenfalls für Wranghams „Koch-Hypothese“: ein angesengter Sedimentfleck und Steinwerkzeuge, die offensichtlich einem Feuer ausgesetzt waren. Ein Wissenschaftler-Team, das die Hinterlassenschaften analysierte, bezifferte deren Alter auf rund 1,5 Millionen Jahre. In Chesowanja, ebenfalls in Kenia, fand man eine ähnliche Feuerstelle mit Steinwerkzeugen, Tierknochenresten und Lehmbrocken. Bloße Arrangements des Zufalls? Eher nicht.
Der Turkana-Junge: Nachbildung eines etwa neunjährigen Homo erectus, dessen Skelett 1984 in der Nähe des Turkana-Sees in Ostafrika gefunden wurde.
Keine Hemmschwelle: obwohl sie in der Natur nur Rohes fressen, nehmen Schimpansen das Angebot von gekochtem Essen an, etwa weich gekochte Süßkartoffeln.
Die Hadza aus Tansania, die bis heute als Jäger und Sammler umherstreifen, garen ihre Nahrung (vorrangig Knollen und Zwiebeln, gelegentlich etwas Wild) noch immer an derartig improvisierten und meist nur einmal genutzten Feuerstellen. Sie entzünden kleine Zweige oder trockenen Tierkot und rösten ihre Speisen drei bis fünf Minuten lang in den Flammen, um schwerverdauliche oder giftige Inhaltsstoffe zu vernichten. So hat das Kochen auch die Auswahl an Nahrungsmitteln erweitert, die für uns Menschen verträglich sind.
Dass die Hadza während der Essenszubereitung dicht beim Feuer kauern können, ohne über tränende Augen oder Hustenanfälle zu klagen, ist wohl ebenfalls der langen menschlichen Kochtradition und einem entsprechenden evolutionären Anpassungsprozess zu verdanken: Der US-amerikanische Ernährungsforscher Gary Perdew von der Penn State University fand eine schützende Mutation im Bauplan unserer Aryl-Hydrocarbon-Rezeptoren (AhR). Die AhR steuern bestimmte Abwehrreaktionen in den menschlichen Körperzellen, wenn wir auf beißenden Rauch oder krebserregende Kohlenwasserstoffe in angebranntem Grillgut treffen – ein Mechanismus, über den Menschenaffen so nicht verfügen. Das uralte Spiel mit dem Feuer hat uns also nicht nur wohlgenährt und schlau werden lassen, sondern auch ziemlich hart im Nehmen.
Im Norden Tansanias lebt das kleine Volk der Hadza noch fast genauso, wie seine Vorfahren zehntausende Jahre zuvor. Feuer machen gehört zum Alltag.