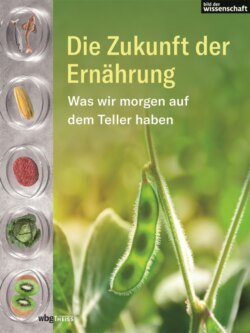Читать книгу Die Zukunft der Ernährung - Группа авторов - Страница 17
Erfindungen bringen die Landwirtschaft voran
ОглавлениеDerweil sorgte die Landwirtschaft regionen- und epochenübergreifend für zahlreiche technische Errungenschaften wie etwa Keramikgefäße zum Einlagern von Korn (ab ca. 6500 v. Chr.). Um ca. 6000 v. Chr. folgte eine kreisrunde waagerechte Fläche, die sich um eine zentrale Achse dreht: die am Indus ersonnene Töpferscheibe. Ab ca. 5000 v. Chr. entstand die Verbindung des jungsteinzeitlichen geschliffenen Steins mit einem Holzstiel zur Axt. Dank Letzterer konnte der Wanderfeldbau in zuvor bewaldete Areale expandieren, dazu mussten die Bäume nicht einmal brachial gefällt werden: Per Axt ließ sich rund um den Stamm ein Streifen Rinde herausschlagen, was den hölzernen Riesen die Lebensgrundlage raubte, denn die Rinde befördert lebenswichtige Stoffwechselprodukte (Assimilate) aus der Baumkrone in Stamm und Wurzeln. War diese Versorgung unterbrochen, trocknete der Baum aus, sodass man ihn leicht per Brandrodung entfernen konnte. Praktischer Nebeneffekt: Die entstehende Asche düngte den neu gewonnen Ackerboden.
Um 4500 v. Chr. wurde an Euphrat und Tigris erstmals der hölzerne Hakenpflug eingesetzt. Um 3500 v. Chr. folgte – basierend auf der Idee der Töpferscheibe – das Wagenrad, das fortan die Felder Asiens und Europas überrollte. Neben derlei technischen Hilfsmitteln nutzten die Bauern auch immer mehr Vierbeiner zur Arbeitserleichterung, denn gezogen wurden Pflug und Wagen von zahmen Rindern oder Pferden. Deren Muskelkraft wurde dringend benötigt, denn die weltweite Anbaufläche wurde größer und größer, und die Bevölkerungszahl wuchs mit ihr um die Wette. Mit steigendem Nahrungsbedarf entwickelten die Menschen immer mehr Kenntnisse über Erhaltung und Optimierung der Bodenfruchtbarkeit. Schon die antiken Griechen erfanden um ca. 1000 v. Chr. die Zweifelderwirtschaft: Ein Acker wurde bestellt, die Fläche nebenan lag brach, damit der Boden regenerieren konnte. Im frühen Rom (ab ca. 750 v. Chr.) frönte man der Cultura Promiscua, zu Deutsch: gemischter Anbau. Oliven, Wein und Getreide wurden auf demselben Feld gezogen. Dadurch waren die Böden ganzjährig bedeckt, was die Erosion stark reduzierte. Die immensen Nährstoffverluste durch Dauerbewirtschaftung kompensierte man mit Dung, der dank Stallhaltung ausreichend zur Verfügung stand.
Die ältesten europäischen Funde von Karren, Rädern oder Wagen stammen aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr. Es waren vorrangig Zweiachser.
Mähdrescher statt mühseliger Handarbeit. Was nach geglücktem Fortschritt aussieht, ist nur ein Teil der Wahrheit. Aufs Ganze gesehen, sind die Herausforderungen der Landwirtschaft heute nicht kleiner als früher.
Doch das Primat der Nachhaltigkeit sollte schon bald in Vergessenheit geraten. Als die Landgüter Roms immer größer wurden, wich man von der arbeitsintensiven Cultura Promiscua ab, was ebenso wie die fortschreitende Entwaldung zu einer Flächenverödung führte, die sich bis heute global fortsetzt: Laut Umweltbundesamt gehen der Erde pro Jahr ca. zehn Millionen Hektar an nutzbarem Acker verloren, das entspricht etwa der gesamten in Deutschland bewirtschafteten Fläche. Die Römer mussten bereits um Christi Geburt ca. 200 000 Tonnen Weizen pro Jahr aus ihren nordafrikanischen Territorien importieren, was auch dort die Erosion und Versalzung der Böden vorantrieb. Der um 200 n. Chr. in Karthago (heutiges Tunesien) lebende Schriftsteller Tertullian orakelte: „Wir sind zu viele auf dieser Erde ...“
Das Ende des Römischen Reichs und die Völkerwanderung verschafften zumindest im klimatisch begünstigten Mitteleuropa vielen erschöpften Böden die dringend benötigte Regenerationszeit, denn nun wurden zahlreiche ehemals kultivierte Flächen vom Wald zurückerobert. Auch größere Kriege, kleinere Klimaveränderungen, wiederholte Missernten oder Pandemien wie die Pest sorgten für Erholungsphasen für die Natur, doch diese waren stets von kurzer Dauer und zogen meist eine noch großflächigere und extensivere Bodennutzung nach sich. Heute nimmt allein der weltweite Weizenanbau über zwei Millionen Quadratkilometer in Anspruch – das entspricht etwa der sechsfachen Fläche der Bundesrepublik Deutschland.
War die landwirtschaftliche Revolution also eine Erfolgsstory oder doch ein „Betrug“, wie Yuval Noah Harari schreibt? „Das Bauerntum hat ein rasantes Wachstum der Menschheit und einen immensen technischen Fortschritt nach sich gezogen – mit allem, was dazugehört“, urteilt Johannes Müller. „Zudem geht die technologische Veränderung immer schneller vonstatten, denn die heutigen acht Milliarden Menschen entwickeln nun mal mehr Ideen als acht Millionen.“ Ob die Landwirtschaft nun eine Erfolgsgeschichte sei, könne man noch nicht abschließend beurteilen, meint Müller: „Die Antwort wird auch davon abhängen, wie wir unser technologisches Knowhow künftig einsetzen.“