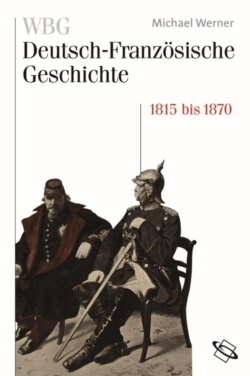Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. IV - Guido Braun - Страница 12
Vom Westfälischen Frieden bis zum Ende des ersten Rheinbundes (1648–1668)
ОглавлениеIn den ersten beiden Jahrzehnten der Herrschaftszeit Ludwigs XIV. intensivierte die französische Politik ihre zum Teil seit dem 16. Jahrhundert, besonders seit der Zeit Heinrichs II., traditionell guten Kontakte zu einer Reihe deutscher Reichsstände. Frankreich versuchte seither mit schwankender Intensität und wechselndem Erfolg, im Reich eine Fürstenopposition gegen die Habsburger zu konstituieren, um den kaiserlichen Einfluss in Deutschland einzudämmen und dem Haus Österreich damit eine seiner wichtigsten Machtgrundlagen in den europäischen Konflikten streitig zu machen. Seit den späteren 1660er Jahren vollzog sich ein Übergang von Formen der Schaffung kollektiver Sicherheit zu französischen Allianzen mit einzelnen mächtigen deutschen Fürsten in der Form bilateraler Vertragsverhältnisse.
Der Rheinbund von 1658, der nach dem Urteil Jean Bérengers das „diplomatische Meisterwerk“ Mazarins bildete39, stellte hingegen einen klassischen Versuch dar, die französischen Interessen im Rahmen einer kollektiven Sicherheitspolitik zu vertreten40, welche durchaus noch in der Tradition von Richelieus Plan einer deutschen Fürstenliga stand. Unter dem Eindruck des fortdauernden französisch-spanischen Krieges hatten sich im Reich bereits seit 1650 verschiedene Assoziationen gebildet. In den folgenden Jahren behielten die Einungsbestrebungen wie am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges eine konfessionelle Färbung bei. Mazarin war jedoch an einem überkonfessionellen Bündnis gelegen, weil bei einer konfessionellen Aufspaltung die katholische Vereinigung eventuell unter den Einfluss des Kaisers zu geraten drohte. Die Beteiligung wichtiger Reichsfürsten beider Konfessionen war die Voraussetzung dafür, dass Frankreich die Fürstenassoziation erfolgreich gegen den Kaiser wenden konnte. Der Fürstenbund vom August 1658 entsprach diesen französischen Erwartungen. In dem zunächst auf drei Jahre befristeten Abkommen verbanden sich die geistlichen Kurfürsten von Mainz und Köln sowie Pfalz-Neuburg mit den drei welfischen Herzögen von Braunschweig, mit Hessen-Kassel und mit Schweden in seiner Eigenschaft als Reichsstand für Bremen und Verden. Diese als erster Rheinbund bezeichnete Assoziation vom 14. August 165841, der Ludwig XIV. am folgenden Tag beitrat, hatte für Frankreich und die beteiligten Stände den doppelten Zweck, zum einen die politischen Ordnungsbestimmungen des Westfälischen Friedens zu sichern und zum anderen – im Zusammenspiel mit der Leopold I. auferlegten Wahlkapitulation – die kaiserliche Macht im Reich zu begrenzen. Die Kombination der Wahl eines habsburgischen Kaisers mit dem Abschluss des französischen Bündnisses hatte aus reichsständischer Sicht den Vorteil, dass sie die eigenen Freiheiten gegen beide Großmächte absicherte. Eine der wesentlichen Triebfedern bei den Verhandlungen war der Mainzer Kurfürst Johann Philipp von Schönborn gewesen, dessen Interessen sich im Hinblick auf den Wunsch, kaiserliche Hilfeleistungen für Spanien zu unterbinden, mit den Anliegen Mazarins deckten42. Der Rheinbund als Instrument der Friedensassekuration war für die beteiligten deutschen Fürsten von Vorteil, solange Frankreich im deutschen Grenzraum eine friedliche Politik verfolgte. Dies war unter Mazarin nach dem französisch-spanischen Ausgleich 1659 sicherlich der Fall. Das Bündnis wurde im August 1660 und dann im März 1663 mit Wirkung bis zum 15. August 1667 verlängert und richtete in Frankfurt ein Direktorium unter dem Vorsitz des Kurfürsten von Mainz ein. Die Truppenstärke belief sich auf fast 10.000 Mann. Weitere Stände schlossen sich an. Mit den Beitritten Kurtriers 1662 und schließlich Kurbrandenburgs 1665 gelangte der Rheinbund noch zu einer späten Blüte. Zudem war Ludwig XIV. in einem Sonderbündnis mit dem Kurfürsten von der Pfalz alliiert. Das deutsche Interesse am Rheinbund verminderte sich aber im Verlaufe der späteren 1660er Jahre, ebenso wie sich die französischen diplomatischen Prioritäten im Zuge der expansiveren Ausrichtung der Politik Ludwigs XIV. veränderten. 1668 wurde der Rheinbund daher nicht verlängert.
Ein weiteres zentrales politisches Anliegen der französischen Reichspolitik im Jahre 1658 war neben der Gründung des Rheinbundes die schließlich missglückte Verhinderung der Wahl eines neuen Römischen Königs aus dem Hause Habsburg. Im April 1657 hatte mit dem Tode Ferdinands III. ein Interregnum begonnen, das der französischen Regierung eine günstige Gelegenheit zur Verwirklichung eines ihrer Grundziele zu bieten schien: dem Hause Habsburg die Kaiserkrone zu entreißen und damit eine Verschiebung der europäischen Machtverhältnisse zu den eigenen Gunsten zu erwirken. Denn Ferdinands ältester, gleichnamiger Sohn war nach seiner Wahl zum Römischen König 1654 noch vor seinem Vater verstorben und der zweitälteste, Leopold, noch keine 18 Jahre alt. Nachdem bis September 1657 die Wahl des Erzherzogs Leopold Wilhelm, des Onkels des jungen Leopold, erwogen worden war, erschien seither Leopold selbst trotz seiner Jugend als der einzige aussichtsreiche Kandidat aus dem Hause Habsburg43. Mazarin favorisierte die Bewerbung des Pfalzgrafen von Neuburg und besonders des Kurfürsten Ferdinand Maria von Bayern, der sich jedoch letztlich nicht für eine Kandidatur gewinnen ließ und den Wiener Hof bereits im August 1657 schriftlich von seinem Verzicht auf die Bewerbung gegen einen Habsburger unterrichtete44. Zwischen Mai und Juli 1657 erwog der Kardinal zudem eine Kandidatur Ludwigs XIV. Die Ernsthaftigkeit dieser Überlegungen, die eine der schillerndsten Seiten der Beziehungen zwischen regnum und imperium seit der Kandidatur Franz’ I. 1519 darstellten, wurde in der Geschichtswissenschaft seit dem 19. Jahrhundert kontrovers diskutiert45. In der Praxis kam es jedenfalls weder zu einer förmlichen Kandidatur des französischen Königs noch zu ernsthaften Verhandlungen über seine eventuelle Bewerbung zwischen Frankreich und den Kurfürsten oder im Kurkolleg selbst46. Anders lagen die Dinge in der deutschen und französischen politischen Publizistik und in der reichsöffentlichen Diskussion. Dort spielte die Eventualität einer französischen Kandidatur durchaus eine gewichtige Rolle. Die Spezialisten des Staatsrechts stellten zum Teil die Wählbarkeit eines ausländischen Bewerbers in Frage47. Der internationale Druck veranlasste die in Frankfurt tagenden Kurfürsten zu dem Beschluss, ausländische Vertreter inskünftig von den Wahlverhandlungen fernzuhalten. Als die Kurfürsten am 18. Juli 1658 mit Leopold I. wieder einen Habsburger zum Kaiser wählten, scheiterte die französische Regierung in der Wahlfrage fast völlig. Allein das dem neuen Kaiser in seiner Wahlkapitulation nach einem Beschluss der Kurfürsten vom 15. Mai 1658 auferlegte Verbot, Madrid in seinem andauernden Krieg gegen Frankreich zu assistieren, konnte als französischer Erfolg verbucht werden. Diese Klausel lag jedoch auch im eigenen Interesse der Reichsstände zur Wahrung des Friedens48.