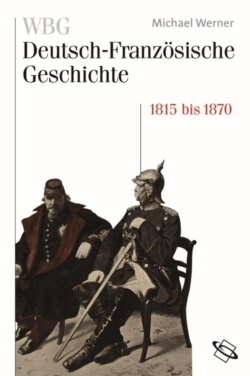Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. IV - Guido Braun - Страница 21
Der Spanische Erbfolgekrieg (1701–1714)
ОглавлениеDer Tod Karls II. von Spanien am 1. November 1700 eröffnete die spanische Erbfolgekrise und damit den zweitlängsten militärischen Konflikt des 18. Jahrhunderts nach dem Großen Nordischen Krieg (1700–1721). Mehrere Fürsten konnten aus verschiedenen rechtlichen Gründen Ansprüche auf das spanische Erbe ableiten. Dies galt vor allem für die Bourbonen und die österreichischen Habsburger, die sich durch ihre enge Verwandtschaft mit dem spanischen Königshaus legitimierten: Ludwig XIV. war der Sohn Annas von Österreich, der ältesten Tochter Philipps III. von Spanien, und seit 1660 der Gatte der ältesten Tochter Philipps IV., Maria Theresia; beide Infantinnen hatten zwar feierlich auf ihre Thron- und Erbansprüche verzichten müssen – zuletzt Maria Theresia eidlich 1662/63 –, aber das Pariser Parlament kassierte diesen Verzicht, dessen Gültigkeit durch den Heiratskontrakt vom 7. November 1659 an die – niemals erfolgte – Auszahlung der Mitgift gebunden war. Kaiser Leopold I. war der Sohn der jüngsten Tochter Philipps III., Maria Anna, und der Gatte der jüngsten Tochter Philipps IV., Margarete Theresia; im Gegensatz zu den mit französischen Königen verheirateten ältesten Töchtern waren die Erbansprüche der jüngeren, die Eheverbindungen mit den Wiener Habsburgern angeknüpft hatten, explizit gewahrt worden. Das Rechtsprinzip des Majorasco verfügte darüber hinaus die Einheit des habsburgischen Gesamthauses, und der Oñate-Vertrag von 1617 hatte der jüngeren, Wiener Linie der Habsburger im Falle des Aussterbens des spanischen Zweiges den gesamten Besitz der spanischen Krone vermacht. Daneben standen jedoch weitere Fürstenhäuser innerhalb der durch mannigfaltige dynastische Beziehungen verknüpften europäischen société des princes zu den spanischen Königen in verwandtschaftlichen Verhältnissen, durch die sich Erbansprüche legitimieren ließen; dies galt auch für deutsche Fürstenhäuser wie die bayerischen Wittelsbacher.
Seit der Thronbesteigung des kränklichen und schwachen Karl II. von Spanien (1665) lebte die europäische Diplomatie – mehr als drei Jahrzehnte lang – in der Erwartung einer spanischen Erbfolgekrise nach dem Ableben dieses kinderlosen Herrschers. Mehrere Versuche, die Krise im Vorfeld zu entschärfen, scheiterten im Laufe der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts trotz zum Teil durchaus chancenreicher Ansätze. Am 19. Januar 1668 unterzeichneten in Wien der kaiserliche Vertreter Auersperg und der französische Gesandte Grémonville ein Geheimabkommen über die künftige Aufteilung des spanischen Erbes107. Der Gedanke, dass eine Teilung der spanischen Monarchie unter den wichtigsten Erbberechtigten die beste Lösung sei, war schon vor dem Tode Philipps IV., 1663 am Hofe des Kurfürsten von Mainz, Johann Philipp von Schönborn, formuliert worden. Auch der Kurfürst von Köln, dessen Friedensinteressen mit den kurmainzischen konvergierten, hatte nach dem Ausbruch des Devolutionskrieges im Sommer 1667 einen Versuch mit der Entsendung seines Emissärs Wilhelm von Fürstenberg nach Wien unternommen, der jedoch gleichfalls erfolglos geblieben war, weil der Kaiser den frankophilen Fürstenbergern – Wilhelm trat zeitweise geradezu als Koordinator der französischen Deutschlandpolitik in Erscheinung – zutiefst misstraute108.
Faktisch handelte es sich bei dem Geheimvertrag von 1668, der erst im 19. Jahrhundert durch die Recherchen Mignets bekannt wurde109, nicht nur um ein Teilungsabkommen des spanischen Erbes, sondern um einen Allianzvertrag. Für die kaiserliche Anerkennung der französischen Ansprüche sprach weniger die Rechtslage als die europäischen Machtverhältnisse, die einen Wiener Anspruch auf die spanische Erbschaft in toto kaum durchsetzbar erscheinen ließen. Dennoch wurde über den Teilungsvertrag von 1668 in der Geschichtswissenschaft ein zum Teil vernichtendes Urteil gesprochen, weil der Kaiser damit nicht nur prinzipiell die französischen Ansprüche auf das spanische Erbe akzeptierte, sondern vor allem die Beziehungen zum spanischen Verwandten in Madrid, der in seiner Notlage vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, nachhaltig schädigte, ohne dass der König von Frankreich tatsächlich auf den Weg zu einer Friedenspolitik geführt werden konnte. Weder Ludwig XIV. noch Leopold I. waren bereit, sich dauerhaft an diese geheime Vereinbarung gebunden zu sehen. Die erste bourbonisch-habsburgische Annäherung von 1668 erwies sich vor allem nach dem Tode Lionnes als inkompatibel mit der Kriegspolitik Ludwigs XIV. Daran änderten auch die am französischen Hof 1687 und 1692 greifbaren Tendenzen zu Sondierungen in Rom bzw. in Wien nichts, zumal die schließlich angebahnten Geheimgespräche sowohl kaiserlicher- als auch französischerseits nur mit wenig Nachdruck betrieben wurden und daher folgenlos blieben.
Wenige Monate nach dem Friedensschluss von Rijswijk unternahm Ludwig XIV. zwar erneut einen Versuch, mit dem Kaiser eine Übereinkunft über das spanische Erbe zu erzielen, aber die eigentliche Lösung der spanischen Erbfolgefrage schien ihm nicht in Wien, sondern in einer Einigung zwischen Versailles und den Seemächten zu liegen. Anders als die Bourbonen und die österreichischen Habsburger erhoben England und die Generalstaaten selbst keine Ansprüche auf das Erbe. Die spanische Erbfolge stellte jedoch nicht nur ein rechtliches, sondern auch ein politisches Problem dar, weil die Seemächte eine Störung des europäischen Gleichgewichts befürchteten, wenn Frankreich oder Österreich das gesamte spanische Erbe anträte. Die Seemächte waren daher an einer Erbteilung interessiert, und für diese Lösung ließ sich auch der französische König gewinnen. Eine Einigung mit Versailles stellte für den Kaiserhof eine in diesen Jahren ernsthaft erwogene Option dar, der man sich allerdings auch auf österreichischer Seite nur mit größter Vorsicht nähern wollte. Das jahrhundertealte Misstrauen zwischen beiden Höfen war jedoch letztlich der Grund dafür, dass Ludwig den Weg per tertios beschritt. Am 11. Oktober 1698 teilte Ludwig daher mit Wilhelm von Oranien, der als Wilhelm III. englischer König war, das spanische Erbe ohne vorherige Konsultation mit dem Kaiser auf: Die spanischen Kernlande, die südlichen Niederlande und die Kolonien in Übersee sollten dieser Abmachung gemäß an den Kurprinzen Joseph Ferdinand von Bayern, Mailand an den zweitgeborenen Kaisersohn Erzherzog Karl und Neapel-Sizilen mit dem Stato dei Presìdi (eine Reihe von Festungen an der toskanischen Küste) und Finale an die Bourbonen in Person Philipps von Anjou fallen.
Die jüngere Forschung hat pointiert, der Tendenz nach aber wohl nicht zu Unrecht behauptet, dass mit dem Tode des bayerischen Erbprinzen, einem Enkel des Kaisers und Großneffen des Katholischen Königs110, am 6. Februar 1699 ein Erbfolgekrieg unausweichlich geworden war. Denn Karl II. von Spanien hatte nach Kenntnisnahme des ersten Teilungsvertrages von Den Haag vom 11. Oktober 1698, der ohne spanische Beteiligung geschlossenen worden war, das gesamte spanische Erbe diesem Prinzen vermacht, weil er wie der spanische Staatsrat die Aufteilung und Zerstückelung des spanischen Weltreiches kategorisch ablehnte. Nachdem diese Lösung unmöglich geworden war und kein ernsthafter, das europäische Gleichgewicht bewahrender111, nicht-habsburgischer und nicht-bourbonischer Thronprätendent mehr zur Verfügung stand, machte Karl II. testamentarisch den Herzog von Anjou, einen Enkel Ludwigs XIV., zum spanischen Universalerben. Im Falle, dass dieser das Erbe nicht annähme, sollte es an zweiter Stelle seinem Bruder, dem Herzog von Berry, zufallen und an dritter Stelle dem 1685 geborenen, zweiten Sohn Kaiser Leopolds I., Erzherzog Karl. Diese Frankreich favorisierende Erbfolgeregelung wurde am 8. Juni 1700 im Consejo de Estado beschlossen, weil allein das Königreich Ludwigs XIV. in der Lage erschien, die Reichsteilung zu verhindern112. Das Testament wurde am 3. Oktober 1700 unterfertigt und auf den Vortag zurückdatiert.
Der französische König hatte nach dem Tode Joseph Ferdinands zunächst weiterhin eine vertragliche Teilungslösung angestrebt und am 11. Juni 1699 mit den Seemächten den zweiten Teilungsvertrag zur spanischen Erbfolge vereinbart, der im März 1700 in London und in Den Haag unterzeichnet wurde. Der durch den siegreichen Türkenkrieg und den Frieden von Karlowitz (1699) gestärkte Kaiser Leopold I. mochte diesem Vertrag jedoch nicht zustimmen, weil der Verlust Mailands die Kommunikation zwischen Österreich und Spanien empfindlich gestört hätte. Obwohl beide Hauptkontrahenten es aus machtpolitischen Gründen kaum für möglich hielten, das spanische Gesamterbe zu behaupten, trat nun an die Stelle der Teilungsoption das Prinzip „Alles oder nichts“ und damit die Unausweichlichkeit des martialischen Konfliktaustrags.
Das spanische Testament, dessen Zustandekommen der französische Botschafter in Madrid, bei Kardinal Porto-Carrero, vermutlich gefördert hatte, brachte den französischen König jedoch in eine prekäre Lage, denn seine Annahme bedeutete sicherlich Krieg nicht nur mit den übrigen am spanischen Erbe direkt interessierten europäischen Mächten, sondern auch mit den indirekt (durch die Verschiebung des Kräftegleichgewichts) daran Anteil nehmenden. Doch auch beim Verzicht auf die Thronfolge der Herzöge von Anjou und Berry drohten erhebliche Schwierigkeiten: In diesem Falle wäre die Nachfolge auf Erzherzog Karl, einen Habsburger, gefallen, was der französischen Staatsräson diametral zuwiderlief. Sollte Ludwig XIV. das Testament schlechthin anfechten und die Exekution des Teilungsvertrages von 1699 verlangen, war ebenfalls mit einem Krieg zu rechnen, weil Spanien und der Kaiser diese Teilung voraussichtlich nicht akzeptiert hätten. Nach intensiven Beratungen und einer feierlichen Sitzung des Conseil am 16. November 1700 erklärte Ludwig XIV. daher die Annahme des Testaments und damit des spanischen Thronerbes für den Herzog von Anjou.
Im Mai 1701 brach daraufhin der Spanische Erbfolgekrieg aus. Während Frankreich bereits am 6. April ein Bündnis mit Savoyen abgeschlossen und Mantua besetzt hatte, errang das österreichische Herr, das unter Prinz Eugen von Südtirol aus operierte, erste Waffenerfolge. Nach Roosen ist die Entscheidung Ludwigs XIV. zwar als Auslöser, nicht jedoch als alleinige Ursache des Kriegsausbruches zu werten, denn in diesem Konflikt verquickten sich eine Reihe unterschiedlicher Interessen der europäischen Staaten113. Die unmittelbare Konsequenz aus dem Vorgehen Ludwigs XIV. war die Wiederannäherung der Seemächte an Österreich, weil der Sonnenkönig durch seinen vermeintlichen Griff nach der bourbonischen Universalherrschaft wiederum als Störer des europäischen Gleichgewichts erschien. Am 7. September 1701 unterzeichneten die kaiserlichen, englischen und niederländischen Bevollmächtigten in Den Haag die sogenannte Haager Große Allianz. Dieser gegen Frankreich gerichtete Beistandspakt rief in Artikel 13 andere Mächte und namentlich die Reichsstände zum Beitritt auf, um verlorenes Reichsgebiet wiederzugewinnen.
Der Spanische Erbfolgekrieg spaltete trotz der Reichskriegserklärung an Frankreich (1702) die Reichsstände. Neben Savoyen (das 1703 die Seite wechselte) und Mantua konnte Ludwig XIV. den Kurfürsten von Bayern und dessen Bruder, den Kölner Kurfürsten, für sich gewinnen. Joseph Clemens war zwar ursprünglich gegen den französischen Kandidaten Wilhelm von Fürstenberg zum Erzbischof von Köln gewählt worden, stellte sich aber zu Beginn des Spanischen Erbfolgekrieges wie Max Emanuel von Bayern auf die Seite Ludwigs XIV. Er wurde wie dieser in die Reichsacht erklärt, aus seinen Kurlanden vertrieben und musste nach Frankreich flüchten.
Die meisten Reichsstände, darunter Brandenburg-Preußen am 30. Dezember 1701, stellten sich jedoch auf die Seite des Kaisers und der Haager Allianz. Andere Stände und Reichskreise folgten 1702: Braunschweig-Lüneburg-Celle, Hannover und Wolfenbüttel, Mecklenburg-Schwerin sowie der fränkische, der schwäbische, der kurrheinische, der niederrheinisch-westfälische und der oberrheinische Reichskreis; am 15. Januar 1703 akzeptierte schließlich auch Hessen-Kassel die Allianz. Das Wohlwollen der wichtigen norddeutschen Kurstaaten, Hannovers und Brandenburg-Preußens, hatte sich der Kaiser durch die weiterhin von ihm favorisierte neunte Kur und die preußische Königserhebung (1701) zu sichern gewusst.
Der Kriegsausbruch führte unmittelbar zu einer drastischen Verschlechterung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage Frankreichs. Von direkten Kriegseinwirkungen blieb das Land jedoch verschont, da der Krieg auf den vier Schauplätzen Spanien, Italien, Niederlande und Deutschland ausgetragen wurde. Der Kriegsverlauf war für Frankreich in den ersten Jahren äußerst ungünstig114. Es reihte sich Niederlage an Niederlage, besonders gegen die verbündeten Armeen des kaiserlichen Feldherrn Prinz Eugen von Savoyen und des Engländers Lord Marlborough: Höchstädt 1704, Turin 1706, Oudenaarde 1708 markieren einige wichtige Kriegsstationen, bei denen Frankreich schwerste militärische Rückschläge erlitt.
Wie in den Kriegen zuvor, wurden die militärischen Aktionen von Friedensfühlern und -verhandlungen begleitet. Die Sondierungen gingen nun vorrangig – fast einseitig – von Ludwig XIV. aus, zumal sich der französische Hof, durch die militärischen Misserfolge veranlasst, rasch an einem Friedenschluss interessiert zeigte: zunächst offiziös 1704 und 1706/07, dann 1709/10 in Den Haag und in Gertruidenberg mit einem bevollmächtigten Außenminister, Colbert de Torcy, an der Delegationsspitze. Diesmal war nicht die sonst übliche Intransigenz Ludwigs XIV. die Ursache für das Scheitern der ersten Verhandlungsrunde, sondern die durch den holländischen Verhandlungsführer und Ratspensionär Heinsius vorgetragene Forderung der geschlossen auftretenden Kriegsgegner, Ludwig möge vor einem Waffenstillstand militärisch gegen seinen eigenen Enkel Philipp V. von Spanien vorgehen und bei dessen Vertreibung aus seinem Königreich mithelfen. Diese mit der Reputation Ludwigs XIV. unvereinbare Forderung wurde von Colbert de Torcy kategorisch zurückgewiesen.
Die entscheidende Kriegswende trat durch zwei verschiedene Ereignisse von großer politischer Tragweite ein: Ein innenpolitischer Umschwung in London zugunsten der friedenswilligen Tories ließ die Große Allianz brüchig werden. Im April 1711 verstarb Kaiser Joseph I., der als Verfechter einer entschiedenen Kriegspolitik gegenüber Frankreich gegolten hatte. Er überließ die österreichischen Erblande seinem jüngeren Bruder Karl VI., dem letzten männlichen Habsburger, der durch die Wahl der Kurfürsten im Oktober 1711 (ohne Beteiligung der beiden geächteten Wittelsbacher) schließlich auch die Kaiserkrone erhielt. Da Karl gleichzeitig der alliierte Prätendent für den spanischen Thron war, drohte eine Personalunion beider Kronen, die nicht im Sinne der Gleichgewichtspolitik der Seemächte lag.
Unter diesen veränderten Auspizien gelang Ludwig XIV. auf dem seit 1712 tagenden Friedenskongress von Utrecht eine lange Zeit für unmöglich gehaltene Wiederholung des Erfolges von Rijswijk durch die Aufbrechung der geschlossenen Phalanx der Alliierten und den Abschluss separater Friedensverträge115. Das Auseinanderfallen der Großen Allianz wurde durch den Utrechter Friedensschluss vom 11. April 1713 besiegelt. Nunmehr stand der Kaiser isoliert gegen Frankreich und gegen Spanien im Felde.
Da Frankreich in der letzten Kriegsphase erfolgreicher operierte als zuvor, konnte Ludwig XIV. 1713 in Utrecht und 1714 in Rastatt und Baden letztlich sogar günstigere Friedenskonditionen aushandeln, als er 1709/10 in höchster Not zuzugestehen bereit gewesen war. Dieses Friedenswerk von Utrecht trug konzeptionell jedoch ganz die britische Handschrift, in dem die Leitvorstellung vom Gleichgewicht116 zur grundlegenden „Philosophie“ der internationalen Beziehungen erhoben und erstmals als „Metapher im Sinn eines völkerrechtlichen Postulats“ in internationalen Friedensverträgen benutzt wurde117. Nachdem in Münster und Osnabrück 1648 dem Staatengleichgewicht eine in der Forschung umstrittene118, offenbar aber doch eher sekundäre und jedenfalls nicht ausdrücklich vertraglich formulierte Rolle zugekommen war, hatte das aus der norditalienischen Staatenwelt entlehnte Gleichgewichtskonzept sich als Idealvorstellung des Staatensystems im späteren 17. Jahrhundert gerade auf dem Wege über Großbritannien und die Niederlande ausbreiten können und stellte ideologisch „die Antwort Europas auf Ludwig XIV.“ und seine Hegemonialpolitik dar119. Doch auch bei Richelieu und Mazarin waren Begriff und Ideal der balance für die zwischenstaatlichen Beziehungen sowie für die Machtverhältnisse innerhalb des Reiches (Stände vs. Kaiser; Konfessionen) bereits gelegentlich gebraucht bzw. formuliert worden. Im 18. Jahrhundert war die Gleichgewichtsmetapher auch im Hinblick auf die innere Verfassung des Reiches bei den Franzosen gebräuchlich. Im Reich selbst wurde sie ebenfalls benutzt und reflektiert, wenige Jahre nach dem Utrechter Frieden bereits in der aufstrebenden Wissenschaft von den internationalen Beziehungen, im späteren 18. Jahrhundert im Hinblick auf die inneren Verhältnisse des Reiches und zumindest an der Hofburg auch bezogen auf den Gegensatz Österreich vs. Preußen.
Infolge des Utrechter Friedens unterzeichneten zunächst Prinz Eugen für den Kaiser und Marschall Villars für den französischen König in Rastatt den kaiserlich-französischen Friedensvertrag. Anschließend verhandelte ein Kongress im Schweizer Baden, an dem neben Gesandten des Kaisers und der Reichsstände die französischen Unterhändler du Luc und Saint-Contest teilnahmen, über den Friedensschluss mit dem Reich. Im Wesentlichen wurden die in Rastatt vereinbarten Artikel vom Französischen ins Lateinische übertragen und bestätigt. Österreich erhielt die ehemaligen Spanischen Niederlande, die für Madrid einstmals ein wichtiger wirtschaftlicher, politischer und strategischer Bestandteil ihres Herrschaftsraumes gewesen waren. Aus österreichischer Sicht stellten die neuen niederländischen Besitzungen allerdings ein im Verteidigungsfall kaum haltbares, peripheres Randgebiet dar. Daher wurden im Verlauf des 18. Jahrhunderts mehrfach Tauschpläne erwogen, durch die man sich eine Stärkung des Kerngebietes um die österreichischen Erblande herum erhoffte. Diese Tauschprojekte wurden durch die belgischen Sezessionsbestrebungen in den 1780er Jahren zwar beflügelt, letztlich jedoch nicht verwirklicht. Die südlichen Niederlande, die der Habsburgermonarchie in den 1780er Jahren immerhin 10 Mio. Gulden Jahreseinkünfte bescherten, blieben daher bis zur Französischen Revolution österreichisches Herrschaftsgebiet. Sie gehörten formalrechtlich dem Burgundischen Reichskreis an, der jedoch bereits seit dem 16. Jahrhundert nur lockere Beziehungen zum Reich pflegte und in dem es mit Österreich als Herzog von Burgund nur einen einzigen Kreisstand gab.