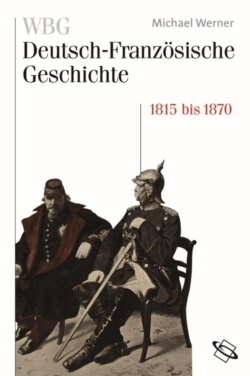Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. IV - Guido Braun - Страница 17
Die Krise der 1680er Jahre und das Ende der französischen Hegemonialstellung
ОглавлениеDie im Zeitalter Ludwigs XIV. begründete französische Leitkultur erwies sich als dauerhafter als die sich bereits wenige Jahre nach Nimwegen abschwächende politische Vormachtstellung des Sonnenkönigs. Zu Beginn der 1680er Jahre rückten die meisten deutschen Verbündeten unter dem Eindruck dieser nach innen integrativen, nach außen – das heißt vor allem dem Reich gegenüber – aber aggressiven Reunionspolitik zunehmend von Frankreich ab. Insbesondere Bayern und Sachsen lösten sich allmählich von Ludwig XIV. Auch die Beziehungen zu Schweden gestalteten sich schwierig, seit die Metzer Reunionskammer Zweibrücken, das Stammland des schwedischen Königs Karl XI., kurzerhand zu einem Lehen des Fürstbistums Metz erklärt hatte. Im Frühjahr 1681 wurde die Reichskriegsverfassung verabschiedet, die als letztes, bis 1806 gültiges, „Reichsgrundgesetz“82 zunächst eine Antwort auf die traumatische Erfahrung der Hilflosigkeit der Reichsdefension gegenüber den Reunionen darstellte83. Die französischen Gesandten im Reich konstatierten zur gleichen Zeit eine zunehmend bedrohlichere Stimmung gegen Frankreich. Doch es konnte zunächst weiterhin auf das brandenburgische Bündnis zählen, und eben Kurbrandenburg und seine Klientel unter den Reichsständen hintertrieben am Reichstag erfolgreich eine Reichskriegserklärung. Trotz der Befreiung Wiens von der osmanischen Belagerung erschien sowohl dem Kaiser als auch den Kurfürsten ein Ausgleich mit Frankreich dringend geboten, da es diplomatisch und durch militärische Drohgebärden auf die Anerkennung seiner Reunionen drängte. Am 15. August 1684 schlossen Kaiser und Reich mit Ludwig XIV. den auf zwanzig Jahre befristeten Regensburger Stillstand. Die darin vollzogenen Gebietsabtretungen an Frankreich – das heißt der seit 1679 reunierten Territorien – waren jedoch zumindest rechtlich noch nicht unwiderruflich. Manche Historiker haben im europäischen Krisenjahr 1683 den Zenit der Hegemonie Ludwigs XIV. und die Verschiebung der europäischen Machtverhältnisse zugunsten Österreichs erblickt, das seine Stellung in Ungarn und darüber hinaus im südosteuropäischen Raum nun (auch zum Nachteile Frankreichs) festigen konnte, während der fortschreitende Zusammenbruch der osmanischen Herrschaft Ludwig XIV. einer entlastenden, zweiten Front gegen Habsburg beraubte84. Aber diese Entwicklung brachte Frankreich durchaus auch Vorteile: Der für Ludwig XIV. vorteilhafte Regensburger Stillstand war auch Ergebnis der österreichischen Interessenverlagerung auf Ungarn und den Balkan und eines daraus resultierenden partiellen Desinteresses am Westen des Reiches, am Elsass und an Straßburg. Sicher ist, dass 1683 insofern eine Zäsur in der Geschichte des frühneuzeitlichen Europa bildete, als im Zuge der türkischen Belagerung Wiens letztmals „ein gemeineuropäisches Solidaritätsgefühl entstanden und politisch wirksam geworden“ war, dem sich nicht einmal Ludwig XIV. entzog85.
Seit 1683 konnte Leopold I. durch die Siege seiner Armee gegen die Osmanen nicht nur die habsburgische Stellung auf dem Balkan ausbauen, sondern auch im Reich als Schutzherr gegen die „Reichsfeinde“ neues Ansehen und neuen Einfluss gewinnen86. Erst in der späteren Erinnerungskultur verlor Leopold, der zu seinen Lebzeiten sein Amt und seine Person propagandistisch geschickt aufzuwerten verstand, den Kampf gegen Ludwig XIV. um den Rang des „Sonnenmo-narchen“87. Auch vor diesem Hintergrund erklärt sich, dass in den gedruckten französischen Büchern über Reichsrecht und -geschichte weiterhin die (freilich minderheitliche) Auffassung vertreten wurde, es handele sich beim Reich um eine Monarchie (zum Beispiel: Bruneau 1675, um 1660 aber bereits auch: Du May88). Demgegenüber vertrat der für das französische Reichsbild seit den 1680er Jahren vermutlich einflussreichste Autor, der aus Kleve stammende, in Frankreich naturalisierte, als Publizist, Informant des Kriegsministeriums und Diplomat tätige Johann Heiss die wohl im 17. Jahrhundert erfolgreichste Staatsformen-Lehre, indem er dem Reich eine Mischverfassung (status mixtus) attestierte – allerdings auch hier bezeichnenderweise mit einem Übergewicht der monarchischen Elemente89. 1690 gelang Leopold mit der Wahl seines erst elfjährigen Sohnes Joseph zum Römischen König darüber hinaus die vorzeitige Sicherung der Kaiserkrone im Haus Habsburg – ein weiteres Indiz für die gestärkte Stellung des Reichsoberhauptes.