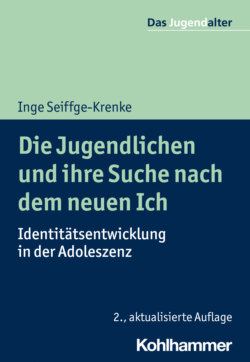Читать книгу Die Jugendlichen und ihre Suche nach dem neuen Ich - Inge Seiffge-Krenke - Страница 17
3.1.1 Selbstwahrnehmung in der frühen Kindheit
ОглавлениеDie meisten Studien über die frühe Kindheit arbeiten mit dem Spiegelparadigma, untersuchen also, an welchen Merkmalen Kinder sich selbst im Spiegelbild erkennen und wie sie auf ihr Spiegelbild reagieren. Zumeist wurde dabei der Ansatz mit dem roten Punkt auf der Nase gewählt (Lewis et al., 1989). Selbstwahrnehmung stand demnach in der entwicklungspsychologischen Forschung im Fokus, teilweise auch die Unterscheidung von anderen.
Einige Zeit vor dem zweiten Geburtstag erkennen Kinder einen roten Fleck auf ihrer Stirn oder der Nase im Spiegel als zu sich selbst gehörig. Dieses Erkennen beruht auf einem schon existierenden, wenn auch noch rudimentären Identitätsgefühl, aufgrund dessen das Kind die Identität des Spiegelbildes mit sich selbst erschließen kann. Das Kind weiß damit, dass es außerhalb seines gefühlten Selbst repräsentiert werden kann. Etwa in diesem Alter beginnen Kinder auch, Pronomina für sich selbst zu verwenden. Mit diesem kognitiven Entwicklungsschritt ist die Entstehung wesentlicher zugehöriger Emotionen verbunden (Emde, 1989). Grundlegende kognitive Kapazitäten, welche als Voraussetzung für die selbstreferenziellen Emotionen angesehen werden, sind die früh bestehende Fähigkeit, zwischen dem Selbst und dem Anderen zu unterscheiden, und die Objektpermanenz, welche mit etwa acht Monaten beginnt (Piaget & Inhelder, 1972). Piaget war stark kognitiv orientiert; Emde ist einer der wenigen Entwicklungspsychologen, die den dualen Kern des Selbst (wie er es nennt) beschreiben, nämlich der Bezug zu biologischen Motiven und der Interaktion mit Bezugspersonen.
Identität entsteht aus Beziehungen, und so ist es wichtig zu unterstreichen, dass sich interaktive Ansätze vor allem bei Theoretikern und Forschern mit psychoanalytischem Hintergrund finden. So gehen verschiedene Theoretiker (Kernberg, 1983; Winnicott, 1965; Mahler 1985) davon aus, dass auf der ersten Stufe der Selbstentwicklung noch keine Trennung zwischen Selbst und Objekt erfolgt ist; erst in einer nächsten Entwicklungsstufe stehen voneinander abgegrenzte, positive bzw. negative Selbst- und Objektrepräsentanzen einander gegenüber. Die Entwicklung und Ausdifferenzierung der Selbst- und Objektrepräsentanzen geschieht in enger Interaktion mit dem »caregiver«, d. h. der Mutter oder dem Vater, die die emotionalen Zustände des Babys interpretieren, spiegeln und markieren, so dass das Baby sie als zu sich gehörig erleben kann. Alle Theoretiker sind sich darin einig, dass die Entwicklung einer Selbstrepräsentanz in der Interaktion mit wichtigen Bezugspersonen vonstatten geht, dass die Ausdifferenzierung eine klare Trennung von Selbst und Objekt hervorbringt und dass in späteren Stadien das Selbst bewusste und unbewusste Lebenserfahrungen integriert.
Die Entwicklung des Selbst im Licht der psychoanalytischen Säuglingsforschung wurde eindrücklich von Stern (1985) durch zahlreiche Untersuchungen untermauert. Er untergliederte das Kernselbst, das in der frühen Kindheit entsteht, in das Gefühl der Urheberschaft (self-agency), der Selbstkohärenz (z. B. in Bezug auf den Ort, die eigenen Bewegungen und die zeitliche Struktur) und der Selbstkontinuität (z. B. bzgl. der gleichen Empfindungen bei den gleichen Ereignissen). Interessanterweise unterscheidet er ferner zwischen einem intersubjektiven Selbst (6.–9. Monat, wo der Säugling stark auf Andere anspricht), dem sprachlichen Selbst (ab dem 18 Monat), wo die Sprache als Medium hinzukommt, und dem narrative Selbst (ab 3 Jahren), wo das Erlebte in Worte gefasst und mitgeteilt werden kann. Auch Stern beobachtete, dass die frühe Entwicklung des Selbstempfindens parallel und in wechselseitiger Abhängigkeit zu der Entwicklung kognitiver, motorischer und verbaler Fähigkeiten verläuft. Das Besondere am psychoanalytischen Ansatz ist allerdings, dass die frühe Selbstentwicklung gebunden ist an einen engen Austausch mit den Eltern. Diese Interaktionen, die unzählige Male zwischen Mutter und Kind ablaufen, werden generalisiert und repräsentiert als Interaktionsstrukturen. Solche Austauschprozesse werden in der psychoanalytischen Literatur als »mirroring« beschrieben (Kohut 1971; Winnicott 1971): Das Gesicht der Mutter wird hier als Spiegel betrachtet, das dem Baby seine eigenen Emotionszustände und Erlebnisse zurückspiegelt. Da dies mit einer gewissen Übertreibung geschieht, kann das Baby sie gut wahrnehmen und sich zuordnen. Demnach kann das Kind sein Selbst nur wahrnehmen, wenn dieses durch die Mutter zurückgespiegelt wird. Beebe & Lachmann (1988) sowie Stern (1985) haben auch darauf hingewiesen, dass keine Spiegelung perfekt ist. Es kommt also in der Mutter-Kind-Interaktion zu geringfügigen Diskordanzen. Dieser »mismatch« erfährt im Folgenden eine »Reparatur«. Gerade diese geringfügigen Reparaturen sind notwendig, um ein Bewusstsein der Getrenntheit und Eigenständigkeit aufzubauen.
Bei den frühen Selbstbeschreibungen des Kindes, etwa im Alter von 2–3 Jahren, werden vor allem Aktivitäten, Aussehen und Vorlieben genannt, das Kind verwendet »mein«, »ich« und »mir« und kann sich auch die Kategorie »Junge« oder »Mädchen« zuordnen. In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse von Toth et al. (1997) wichtig. Die Autoren fanden, dass vernachlässigte oder missbrauchte Vorschulkinder negative Selbstrepräsentationen und Störungen im Selbstsystem aufweisen. Misshandelte Kleinkinder nutzen weniger Gefühls-Sprache und zeigen negative Affekte in Reaktion auf ihr Spiegelbild. Die Befunde von Crittenden und DiLalla (1988), dass misshandelte Kinder bereits im zweiten Lebensjahr ihren negativen Affekt unterdrücken und einen falsch positiven Affekt zeigen, zeigen den frühen Beginn eines falschen Selbst (Winnicott 1965), ein Phänomen, das wir auch bei Jugendlichen kennenlernen werden, die einem problematischen elterlichen Verhalten ausgesetzt sind ( Kap. 9).