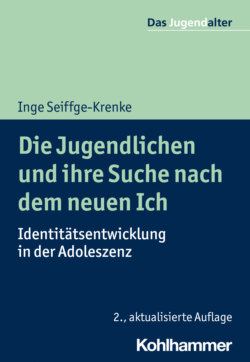Читать книгу Die Jugendlichen und ihre Suche nach dem neuen Ich - Inge Seiffge-Krenke - Страница 18
3.1.2 Selbstwahrnehmung und Selbstcharakterisierung in der mittleren Kindheit
ОглавлениеIn der mittleren Kindheit sind weitere bedeutende Fortschritte in der Selbstwahrnehmung und -beschreibung zu benennen, die in die Identitätsentwicklung einfließen. In der Schulzeit überwiegen positive Selbstcharakterisierungen, psychologische Charakterisierungen finden sich noch nicht. In den Interviews, die Broughton (1978) mit Kindern machte, stellte sich heraus, dass sie das Selbst als einen Teil ihres Körpers wahrnehmen. Etwa um das 8. Lebensjahr sind die Selbstbeschreibungen darauf konzentriert, Unterschiede zwischen sich und anderen zu markieren (»Ich bin anders als Tom, weil ich blond bin und Fahrrad fahren kann«). Zugleich wird bemerkt, dass Freunde und Eltern andere Gefühle und Wahrnehmungen haben als man selbst. Fonagy & Target (1997) haben die reflexive Funktion als ein implizites Verständnis von Vorstellungen, Emotionen und Beziehungen der anderen bezeichnet, welches nicht notwendigerweise verbalisierbar sein muss. Diese für die Selbstorganisation so zentrale reflexive Funktion kann wiederum erst dadurch entstehen, dass die Bezugsperson in der Lage ist, ihrerseits ein Verständnis für die Bedeutsamkeit und Andersartigkeit des kindlichen Selbst zum Ausdruck zu bringen. Eine sichere Bindung ist in diesem Zusammenhang sehr entscheidend.
Die Unterteilung des Selbst in subjektives und objektives Selbst ist ein weiterer Entwicklungsfortschritt in der mittleren Kindheit. Später wird Selman (1980) beschreiben, dass das Kind am Übergang zur Adoleszenz zwischen einem wahren inneren Selbst und einer äußeren Fassade unterscheiden lernt – Aspekte, die in der Adoleszenz zunehmend wichtiger werden. Kinder in der zweiten Klasse benutzen bereits psychologische Charakterisierungen für sich und andere, aber nur sehr selten; Damon und Hart (1988) nennen einen Prozentsatz von 13 %. In dieser Altersstufe wird auch die Grundlage für »agency« gelegt, d. h. dass man selbst etwas bewirken kann.
Der Körper ist zwar im Selbst, in der Identität präsentiert, aber durchaus variabel, wie sich in den Arbeiten von De Bono (1980, S. 168) zeigt. Da haben Schulkinder sich beispielsweise gewünscht, mehr Arme und mehr Beine zu haben, vor allem mehr Finger an einer Hand, denn damit »kann ich die Arbeit schneller machen«, oder etwa »die Nase an den Beinen« zu haben, »damit man besser riechen kann«– also ganz nah am Geschehen! Diese für die Kindheit charakteristische Experimentierlust und Variabilität wird sich später, wie noch zu zeigen sein wird, drastisch verändern in Richtung auf eine höchstmögliche Konformität – und zwar in einer Zeit, in der nichts so variabel ist wie der Körper, nämlich in der Pubertät.
Interessant ist, wie Kinder in der mittleren Schulzeit die Geschlechtsidentität konstruieren und aufrechterhalten. Die Zuordnung des eigenen Geschlechts erfolgt schon recht früh, allerdings muss diese Zuordnung spielerisch immer wieder abgesichert werden. Bereits ab dem Alter von 5 Jahren ist im Spiel eine Geschlechtssegregation deutlich, die Spitze liegt allerdings in der Grundschulzeit, wo in streng nach dem Geschlecht getrennten Gruppen gespielt wird: Jungen spielen nur Jungenspiele und Mädchen spielen nur Mädchenspiele, doch es findet auch viel Spiel an den Geschlechtsgrenzen statt (»borderwork«, vgl. Aydt & Corsoro, 2003). Dies signalisiert, dass das, was Ich und Nicht-Ich ist, immer wieder neu und spielerisch gefestigt werden muss, und dazu gehört auch die Geschlechtsidentität und das typische Verhalten als Junge oder Mädchen. Konformität mit den anderen Geschlechtsgenossen ist sehr wichtig, das bezieht sich auf Kleidung, bevorzugte Spiele und Interessen. »Cross-sex-play« findet selten statt (bei 2–10 % aller Kinder). Ebenso wie Jungen spielen Mädchen zunächst streng in nach dem Geschlecht segregierten Gruppen, d. h. sie spielen überwiegend mit Mädchen, und nur eine kleine Gruppe ist mit Jungen befreundet bzw. spielt in Jungengruppen (Seiffge-Krenke, 2012a), ihr Spiel ist aber deutlich gehemmter und unsicherer.
In diesem Zusammenhang ist übrigens bemerkenswert, dass »Tomboy«-Verhalten, das heißt Mädchen, die sich jungenhaft kleiden und jungenhaft spielen, ein Verhalten ist, das in allen Kulturen beobachtet werden kann (Seiffge-Krenke, 2017a). Dieser Begriff tauchte zum ersten Mal im 16. Jahrhundert auf. »Tomboy«-Verhalten wird bis zur späten Kindheit geduldet, teilweise auch von Vätern und Brüdern unterstützt, danach aber werden Mädchen mit »Tomboy«-Verhalten ausgegrenzt und isoliert, das heißt die Toleranz endet abrupt mit Eintritt in die Pubertät. Insbesondere die Gleichaltrigen wirken dem »Tomboy«-Verhalten mit zahlreichen Sanktionen entgegen.
Die ethnische Selbstkategorisierung ist ein Forschungsgebiet, welches in den USA schon sehr lange verfolgt wird, in Deutschland aber praktisch kaum Interesse geweckt hat, von wenigen Arbeiten abgesehen, die nachgewiesen haben, dass sich das Gefühl für das Selbst und die ethnische Identität in der Adoleszenz verstärkt. Zugleich aber scheint durch die besondere deutsche Geschichte die ethnische Identität keine einfache Facette der Identität zu sein (Seiffge-Krenke & Haid, 2012). Aus amerikanischen Untersuchungen wissen wir, dass die ethnische Selbstkategorisierung ein langdauernder Entwicklungsprozess ist, in dem erst ab dem Alter von etwa 6–12 Jahren ethnische Diskrimination bemerkt wird, aber erst mit etwa 15 Jahren eine Generalisierung der eigenen ethnischen Gruppe erfolgen kann.