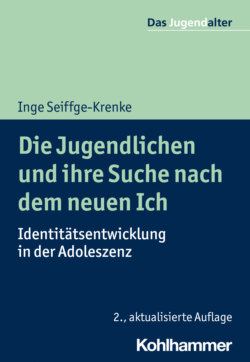Читать книгу Die Jugendlichen und ihre Suche nach dem neuen Ich - Inge Seiffge-Krenke - Страница 21
3.2.2 Spannungsbogen zwischen nicht abgeschlossener Hirnentwicklung, Verfrühung der körperlichen Reife und Verspätung der Identitätsentwicklung
ОглавлениеWährend es im Bereich der Identitätsentwicklung zu einer Verzögerung kommt (Jugendliche dürfen heute viel länger und extensiver explorieren als ihre Eltern, und dies wird auch gesellschaftlich unterstützt), steht die schwierige Aufgabe des Umgangs mit der körperlichen Reife, der Integration der physisch reifen Genitalien ins Körperbild, viel früher an. Dieser Spannungsbogen zwischen Verfrühung bezüglich körperlicher und sexueller Reife und Verspätung bezüglich einer elaborierten Identität ist schwer auszuhalten – besonders für Mädchen, aber auch für die Eltern, die Familie.
Entwicklung vollzieht sich nicht nur im Sinne einer linearen Progression. Manchmal scheinen sich auch Rückschritte in der sozialen, kognitiven und emotionalen Entwicklung anzudeuten. Nachdem Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren gelernt haben, sich in die Perspektive eines anderen hineinzuversetzen, entsteht im Jugendalter erneut eine egozentrische (so nennt es die Psychologie) oder narzisstische (so nennt es die Psychoanalyse) Haltung, wenn Jugendlichen die adäquate Bezugnahme auf das Denken und Fühlen anderer kurzzeitig abhandenkommt (Seiffge-Krenke, 2002a). Die überstarke Beschäftigung damit, wie die anderen einen sehen, hat zu den Phänomenen der erlebten Einzigartigkeit (»personal faible«) und der imaginären Audienz (»imaginary audience«, Elkind, 1974) geführt, d. h. dem Erleben, dass man etwas Besonderes, Einzigartiges sei, sich völlig von anderen unterscheide und dabei so bedeutsam sei, dass andere einen ständig beobachten und bewerten. In diesen beiden Phänomenen kommt einerseits der erhöhte Narzissmus der Frühadoleszenz zum Ausdruck, zum anderen aber bereits der Einbezug der vielen anderen bei der Identitätsbildung, die beurteilen und kritisieren.
Tiefpunkt der Selbstwertentwicklung scheint das 13. Lebensjahr zu sein (Zinnecker et al., 2002). Der Selbstwert des Jugendlichen muss sich dann im Spannungsfeld zwischen den Erfahrungen der Kompetenz und Akzeptanz neu konstituieren. Durch die zunehmende Kritikfähigkeit und Selbstreflexion kann es zu einer kritischen Entwicklung kommen. Wenn Kompetenz und Akzeptanz den eigenen Idealvorstellungen nicht Rechnung tragen, kann dies zur Selbstwertkrise führen. Die narzisstische Selbstüberschätzung macht sich u. a. auch an einem fragiles Selbsterleben mit hohen Ambitionen, Neigung zu Idealisierung und Abwertung von Nicht-Erreichbarem, verstärkter Kränkbarkeit und Wuterleben bemerkbar. Der phasenspezifische Narzissmus besitzt aber eine protektive Funktion. Er lässt den Jugendlichen aus einer vorübergehenden Position der Unsicherheit Entwürfe der eigenen Person vornehmen, die weit ins Erwachsenenalter hineinreichen können.
Die neu gewonnenen Fähigkeiten, das Denken nicht nur in dyadischen Beziehungen, sondern auch das vieler anderer in Betracht zu ziehen, führen demnach zu einem kurzzeitigen Anstieg des Egozentrismus bzw. Narzissmus. Ganz entscheidend für eine rasche Auflösung des egozentrischen Durchgangsstadiums ist die Interaktion mit gleichaltrigen Freunden. Um bei den engen Freunden »bestehen« zu können, müssen Jugendliche schnell lernen, sich angemessen auf deren Gefühle einzustellen und über eigene Emotionen und die der Freunde angemessen zu kommunizieren, ohne jemand zu schädigen.
Wie in Kapitel 4 ( Kap. 4) und 5 ( Kap. 5) zu zeigen sein wird, verläuft die Selbst- und Identitätsentwicklung bei männlichen und weiblichen Jugendlichen unterschiedlich, sind unterschiedliche Faktoren bestimmend. In diesem Zusammenhang ist auch auf Unterschiede in der Hirnentwicklung hinzuweisen. So zeigt die Neurobiologie, dass insgesamt die Hirnentwicklung noch andauert, vor allem aber, dass ein Ungleichgewicht zwischen der Entwicklung limbischer Hirnregionen und Regionen des präfrontalen Kortex besteht (Schmidt & Weigelt, 2019). Das limbische System umfasst eine Gruppe tieferliegender Hirnstrukturen, die an der Verarbeitung emotionaler Inhalte und Gedächtnisprozesse beteiligt sind. Es wird am Beginn der Pubertät, mit etwa 10 bis 12 Jahren, noch aktiver und trägt damit zu den Stimmungsschwankungen bei. Demgegenüber beginnt die Reifung des präfrontalen Kortex, der für kognitive Funktionen wie Handlungsplanung, vorausschauendem Denken etc. zuständig ist, später. Diese zeitliche Diskrepanz erklärt teilweise das Risikoverhalten. Da sich der Beginn der körperlichen Reife immer mehr verfrüht, zugleich aber die Entwicklung des präfrontalen Cortex bis ins dritte Jahrzehnt andauern kann, entsteht ein immer größeres Zeitfenster des Ungleichgewichts, das es zu bedenken gilt.