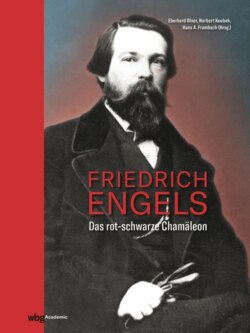Читать книгу Friedrich Engels - Jürgen Herres - Страница 21
ERINNERUNGEN AN DIE 48ER REVOLUTION IN ZEITEN DES SOZIALISTENGESETZES
ОглавлениеEngels wollte eine Marx-Biographie oder eine Geschichte der IAA schreiben – beides gehörte für ihn insofern zusammen, als er die Tätigkeit in der IAA als Höhepunkt von Marx’ politischer Wirksamkeit betrachtete, und zudem er der einzige sei, der aufgrund eigener Kenntnis die grassierenden Verleumdungen widerlegen könne.47 Dazu ist Engels nicht gekommen; er hat nur 1884/85 Texte veröffentlicht, die sich auf Marx während der Revolution 1848/49 konzentrieren. Sie entstanden im Kontext einer publizistischen Offensive der Wochenzeitung Sozialdemokrat unter der Redaktion von Bernstein, der mit Engels in stetigem Briefkontakt stand, und des ebenfalls in der Schweiz gegründeten Verlags, der Volksbuchhandlung in Hottingen (bei Zürich) unter Leitung von Hermann Schlüter. Man wollte zum ausdauernden Widerstand gegen das Sozialistengesetz mobilisieren, richtete sich damit auch gegen diejenigen Teile der Partei48 und namentlich der Reichstagsfraktion, die angesichts des Verfolgungsdrucks zu Konzessionen an die Regierung bereit waren.
Bernstein hat zum 1. Todestag von Marx (14. März 1884) bei Engels einen Artikel über „Marx und die Revolution“ erbeten und als mögliche Schwerpunkte 1848 oder die Pariser Kommune 1871 genannt. Engels entschied sich für die erste Variante, schrieb über „Marx und die ‚Neue Rheinische Zeitung 1848–49‘“,49 vermutlich weil es ihm darum ging, das Beispiel einer kämpferischen Zeitung vorzuführen. Engels gibt einige Informationen zur Geschichte der Zeitung: die handstreichartige Übernahme durch Marx, die Probleme mit den Aktionären, von denen viele wegen der Radikalität des Blattes wieder abgesprungen waren, die Auflagenhöhen, die autoritäre Führung durch Marx („die Verfassung der Redaktion war die einfache Diktatur von Marx“50), die als Notwendigkeit für eine Tageszeitung von allen Beteiligten akzeptiert worden sei. Ausführlich wird auch dargelegt, welchen Schutz für die Pressefreiheit das im Rheinland noch geltende französische Recht geboten habe.51 Abenteuerlich klingt, in der Festungsstadt Köln „mit einer Garnison von 8000 Mann“ habe das Militär „wegen der acht Bajonettgewehre und 250 scharfen Pistolen im Redaktionszimmer und der rothen Jakobinermützen der Setzer“ keinen Handstreich gegen diese „Festung“ unternehmen wollen.52 Die große Zeitung mit Anspruch auf Wirkung in Deutschland habe die äußerste Linke der demokratischen Bewegung repräsentiert, sei kein „kleines Winkelblättchen“ zur Verkündigung des Kommunismus gewesen.53 Ihr Programm habe aus zwei „Hauptpunkten“ bestanden: „Einige, untheilbare, demokratische, deutsche Republik und Krieg mit Rußland, der Wiederherstellung Polens einschloß“.54 Ersteres erforderte die Bekämpfung des „parlamentarischen Kretinismus“55 der Nationalversammlungen in Frankfurt und Berlin (wobei man von der deutschen von Anfang an nichts erwartet habe, die preußische aber besonders deren linken Flügel, da nicht radikal genug, kritisiert habe); letzteres die Propagierung eines revolutionären Krieges, ohne den es keine Zerschlagung des Habsburgerreiches und Preußens geben konnte. Das ist eine konzise Zusammenfassung der von Marx und Engels in ihren Leitartikeln verfolgten Politik, hinsichtlich des Krieges wohl mit einer Zuspitzung, die über die Wahrnehmung des damaligen Publikums hinausgeht.56
Die Freie Presse, 1848.
Das Heer der Reaktion, 1848.
Neben der im Frühjahr 1849 immer stärker propagierten Hoffnung auf diesen großen Krieg und auf Volksaufstände in Deutschland habe man sich immer mehr „dem sozialen Ziel unserer Politik“ zugewendet, wie die Artikelserien von Wilhelm Wolff, „Die Schlesische Milliarde“57, und Marx, „Lohnarbeit und Kapital“58, sowie die „Abschiedsnummer“ (19. Mai) mit der Proklamation „Emanzipation der arbeitenden Klasse!“ gezeigt habe.59 Fazit: „Keine deutsche Zeitung, weder vorher noch nachher, hat je die Macht und den Einfluß besessen, hat es verstanden, so die proletarischen Massen zu elektrisiren, wie die Neue Rheinische“ – eine kontrafaktische Behauptung.60 Während Bernstein im Sozialdemokrat kleinere Stücke aus der NRhZ abdruckte,61 deren aktuelle Relevanz selbstevident sein sollte, wollte Schlüter in einer Schriftenreihe der Volksbuchhandlung („Sozialdemokratischen Bibliothek“) längere ältere Texte wieder veröffentlichen. Er begann mit Marx’ Verteidigungsrede in Köln (8. Februar 1849) gegeneine Anklage wegen des Aufrufs des Kreisausschusses der rheinischen Demokraten zur Steuerverweigerung (15. September 1848).62 Engels hat auf Schlüters Wunsch ein Vorwort geschrieben.63 Die Broschüre erschien im Oktober 1885 unter dem Titel: Karl Marx vor den Kölner Geschwornen. In dem Prozess, der mit Freispruch für die Angeklagten geendet hatte, hatte Marx die Anklage rhetorisch gegen die preußische Regierung gewendet, die mit dem Vorgehen gegen die preußische Nationalversammlung Rechtsbruch begangen habe. Engels begnügte sich damit, auf die aktuellen Implikationen hinzuweisen: Bekenntnisse zur Legalität von einer Partei zu fordern, die unter Ausnahmerecht gestellt sei, sei „grundkomisch“.64
Parallel dazu hatte Schlüter den Nachdruck von Marx, Enthüllungen über der Kommunisten-Prozeß zu Köln, geplant. Marx hatte in seiner Darstellung des Verfahrens gegen tatsächliche oder vermeintliche Mitglieder des BdK, das im November 1852 (zu seiner und der Öff entlichkeit Überraschung) mit der Verurteilung von sieben (von elf) Angeklagten geendet hatte,65 die Rechtsbrüche der preußischen Polizei angeprangert, zugleich aber der anderen, von August Willich und Karl Schapper geführten Fraktion des seit September 1850 gespaltenen BdK Zusammenarbeit mit der preußischen Polizei unterstellt. Die Schrift war in Basel und Boston 1853 gedruckt worden, in Deutschland wegen Beschlagnahmungen aber nicht zugänglich gewesen. Ein Nachdruck war 1874/75 erfolgt im Hinblick auf die schon damals (noch vor dem Sozialistengesetz) stattfi ndenden Repressalien gegen beide sozialdemokratische Parteien. Für die erneute Aufl age wurde wieder mit Engels ein Vorwort vereinbart. Er schrieb es Ende September / Anfang Oktober 1885. Es wurde noch im Oktober in drei Folgen im Sozialdemokrat veröff entlicht, anschließend in der Buchausgabe, die Anfang 1886 ausgeliefert wurde.
Noch einmal das Off ensichtliche hinsichtlich der Parallelen zur Gegenwart zu betonen, hätte wenig Sinn gemacht. Engels schrieb deshalb „Zur Geschichte des ‚Bundes der Kommunisten‘“.66 Er begann mit der Vorläuferorganisation, dem „Bund der Gerechten“, schilderte die Pionierrolle von Wilhelm Weitling (und auch dessen spätere „Exkommunikation“), hob die Rolle der neuen Londoner Führung dieser Organisation (Karl Schapper, Heinrich Bauer, Joseph Moll – die „ersten revolutionären Proletarier, die ich [1843] sah“67) hervor und ihre Verhandlungen mit Marx und Engels 1847, die schließlich zur Umgründung in den Bund der Kommunisten geführt hatten, der als erster das Prinzip der Internationalität realisiert habe und dessen Manifest „in fast alle Sprachen“ übersetzt worden sei und „noch heute in den verschiedensten Ländern als Leitfaden der proletarischen Bewegung“ diene.68 Er erwähnte die Verlegung der Führung des BdK nach Paris im März 1848 und druckte die Ende dieses Monats aufgestellten (17) „Forderungen der Kommunistischen Partei in Deutschland“ ab.69 Detaillierter als in den früheren Darstellungen begründete er, warum man in Paris die Aufstellung einer Deutschen Legion durch Georg Herwegh bekämpft hatte,70 und schilderte, wie man in Verhandlungen mit der provisorischen französischen Regierung Unterstützung für die Rückführung „von drei- bis vierhundert Arbeiter[n] nach Deutschland, darunter die große Mehrzahl Bundesglieder“ erhalten habe.71
Der politische Struwelpeter, 1848.
Als Organisation habe der BdK nach Rückkehr seiner Mitglieder nach Deutschland keine Rolle spielen können, sich gleichwohl als „eine vorzügliche Schule der revolutionären Thätigkeit“ erwiesen. In verschiedenen Regionen hätten Bundesmitglieder an der „Spitze der extrem-demokratischen Bewegung“ gestanden.72 (Zu der folgenden Attacke auf Stephan Born siehe weiter unten).
Höchst erfolgreich sei dagegen die von London seit Ende 1849 ausgehende Reorganisation des BdK in Deutschland gewesen, die ihn innerhalb kürzester Zeit zur „einzige[n] revolutionäre[n] Organisation“ werden ließ, „die in Deutschland eine Bedeutung hatte“. Aber Marx und Engels hätten dann erkannt, dass die Hoffnung auf eine baldige Revolution völlig illusorisch sei. Ihre Absage an unsinnige Revolutions-macherei habe zur Spaltung des Bundes geführt. Die andere Fraktion, die sich mit den weiterhin auf Revolution drängenden Kräften der europäischen Emigranten in London verbündete, wurde geführt von Willich, ein „Gemüthskommunist“ und „vollständiger Prophet“, der von seiner „persönlichen Mission als prädestinirter Befreier des deutschen Proletariats überzeugt, und als solcher direkter Prätendent auf die politische nicht minder als auf die militärische Diktatur“ gewesen sei,73 und Schapper, der seinem „alten Revolutionsdrang“ gefolgt sei.74 Mit den Verhaftungen im Frühjahr 1851 und schließlich dem Kölner Prozess sei alles vorbei gewesen. „Unmittelbar nach der Verurtheilung lösten wir unseren Bund auf; wenige Monate nachher ging auch der Willich-Schapper’sche Sonderbund ein zur ewigen Ruhe“.75
Engels’ Rabulistik ist atemberaubend, erfordert einen ausführlichen Kommentar. Es seien nur wenige Punkte genannt. Engels hebt die „Forderungen der Kommunistischen Partei in Deutschland“ hervor, erwähnt aber nicht, dass Marx und er nach der Rückkehr nach Deutschland an deren Propagierung kein Interesse hatten, da dies das Scheitern des Zeitungsprojekts bedeutet hätte, das auf Anwerbung von Aktionären basierte.76 Die Reorganisation des BdK in Deutschland, um den Marx sich seit seiner Rückkehr nicht mehr gekümmert hatte,77 ist bereits im November 1848, und zwar gegen den Willen von Marx, in Angriff genommen worden.78 Was immer Willich über seine Führungsrolle gedacht haben mag, es war Marx gewesen, der ihm Anfang 1851 einen gefälschten Brief mit der Aufforderung zukommen ließ, als Militärdiktator einen Aufstand der rheinischen Landwehr zu leiten, um ihn anschließend damit bloß zustellen.79 Aber das – und vieles mehr – konnte das damalige Publikum nicht wissen.
Die hämischen Bemerkungen zu Willich sind nicht überraschend, wohl aber die zu Stephan Born, der Marx und Engels 1846–1848 in Brüssel und Paris engagiert unterstützt hatte. Im Anschluss an die Ausführungen zu den Aktivitäten, die Bundesmitglieder 1848 verfolgt hatten, geht Engels länger auf die von Born initiierte „Arbeiterverbrüderung“ ein. „Born, ein sehr talentvoller junger Mann, der es aber mit seiner Verwandlung in eine politische Größe etwas zu eilig hatte, ‚verbrüderte‘ sich mit den verschiedenartigsten Kreti und Plethi, nur um einen Haufen zusammen zu bekommen […]“. Die Organisation habe einen kruden Mischmasch von theoretischen Versatzstücken (Kommunistisches Manifest; Proudhon; Louis Blanc) und praktischen Forderungen präsentiert, aber in der entscheidenden Phase im Frühjahr 1849 versagt. Da sie „großentheils nur auf dem Pa-pier bestand“, habe es die Reaktion erst 1850 für notwendig gehalten, sie zu verbieten. Born (damals erst 23 Jahre alt) hatte seit April 1848 zunächst in Berlin eine Arbeiterorganisation und seit Herbst die überregional agierende „Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung“ aus Vereinen und Gewerkschaften aufgebaut, die politische wie soziale Forderungen vertrat und auf Distanz zum Bürgertum ging. Marx bzw. die NRhZ hat Borns Aktivitäten nicht unterstützt, aber auch nicht bekämpft. Nachdem Born Ende Januar 1849 auf einem Heidelberger Kongress auch süddeutsche Vereine für die Arbeiterverbrüderung gewonnen hatte, besuchte er die Familie Marx und die NRhZ-Redaktion; die Begegnung scheint durchaus harmonisch verlaufen zu sein.80 Als Marx Mitte April 1849 einen Kursschwenk machte und zusammen mit Schapper und anderen seinen Austritt aus dem Verbund der demokratischen Vereine erklärte, schloss sich der Kölner Arbeiterverein sofort der Arbeiterverbrüderung an und wollte Delegierte zu deren geplanten (aber nicht mehr zustande gekommenen) Kongress entsenden.81
Die Arbeiterverbrüderung zählte 1849/50 ca. 15 000–18 000 Mitglieder.82 Der BdK hat nie mehr als ein paar Hundert Mitglieder gehabt.83
In der Arbeiterverbrüderung waren auch viele BdK-Mitglieder engagiert, die aber keine, von einer Zentrale steuerbare „Kader“ waren, wie Engels suggeriert,84 und in ideologischen und pragmatischen Fragen genau jenen Eklektizismus pflegten, den Engels der Arbeiterverbrüderung insgesamt vorwarf.85 Es sind damals Netzwerke angelegt worden, die Arbeitervereinen ein Überleben auch im Jahrzehnt der Repression seit 1850 ermöglichten, und an die später der ADAV anknüpfen konnte, in dem in der Arbeiterverbrüderung und / oder dem BdK sozialisierte Aktivisten eine wichtige Rolle spielten.
Was war eigentlich in den Augen von Engels der große politische Fehler von Born – sein selbständiges Agieren?86 Warum Engels sich zu dieser verzerrenden, zudem mit persönlichen Invektiven unterfütterten Darlegung verstiegen hat,87 ist jedenfalls erklärungsbedürftig. Born war für ihn oder Marx seit langem kein Thema mehr,88 und Borns Rolle 1848/49 in der Öffentlichkeit weitgehend vergessen. Auf die erste Anfrage von Schlüter hatte Engels geantwortet, er wolle „den alten Lassalleanern“ wieder einmal beweisen, dass in Deutschland „auch vor dem großen Ferdinand schon etwas los war“.89 Dass sich die Aggression im fertigen Text nicht mehr gegen Lassalle, sondern gegen Born richtete, folgte anscheinend daraus, dass Engels in der Zwischenzeit das gerade erschienene Buch von Georg Adler über die Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung ca. 1840–1850 erhalten hatte. Für Adler war Born „die bedeutendste Persönlichkeit der Berliner und überhaupt der allgemeinen Arbeiter-Bewegung“ gewesen, ausgezeichnet durch „vorzügliches Redetalent, durch persönlichen Mut, und durch Energie im Handeln“.90 Zusammenfassend hieß es zu Führern der frühen Arbeiterbewegung: „Neben einem schöpferischen Denker allerersten Ranges wie Karl Marx finden wir bedeutsame Talente wie Friedrich Engels, Wilhelm Weitling, Karl Grün und Born“.91 Engels vermutete, Adlers Informationen gingen auf Born selbst zurück, deshalb müsse Born nun Prügel bekommen.92
Das galt auch für Adler. Engels übergab sein mit Randnotizen versehenes Exemplar von Adlers Buch an Karl Kautsky, der eine Rezension schrieb,93 in der er mit kleinlicher Detailkritik – wie Nennung von Datierungsfehlern,94 die Engels ebenso unterlaufen sind95 – nachweisen wollte, dass Adler keine Ahnung habe. Kautsky verließ sich allein auf Engels’ Notizen und Hinweise,96 wobei (wohl beiden) peinliche Schnitzer unterliefen.97 Kautsky hatte nur insofern recht, als Adler seine Quellen oft unkritisch ausgeschrieben hatte. Aber das von Adler präsentierte Material, das u. a. auf der Auswertung einer Vielzahl weitgehend verschollener Zeitschriften und Dokumente beruhte,98 war für damalige Verhältnisse überwältigend. Wenn sich Engels’ Hoffnung erfüllt hätte, „das von Marx und mir gesammelte reichhaltige Material zur Geschichte jener ruhmvollen Jugendzeit der internationalen Arbeiterbewegung [1836–1852] einmal zu verarbeiten“,99 hätte er gewiss auch auf Adler zurückgreifen müssen.100 Aber Adler hatte sich in den Augen von Engels und Kautsky schon zuvor dadurch „disqualifiziert“, dass er zu jenen gehörte, die Karl Rodbertus für den Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus hielten.101 Engels’ Attacke auf Born hatte den nichtintendierten Effekt, die in Vergessenheit geratene Arbeiterverbrüderung wieder in Erinnerung zu rufen. Franz Mehring hat dies 1897 getan und die Kritik von Engels an Born stark relativiert,102 was wiederum diesen dazu motivierte, seine Memoiren aufzuschreiben (kurz vor seinem Tod 1898). Diese wurden auch zu einer Quelle für die Jahre von Marx und Engels in Brüssel und Paris – auch mit Fehlinformationen, sei es aufgrund von Gedächtnisfehlern, sei es als „Revanchefouls“.103