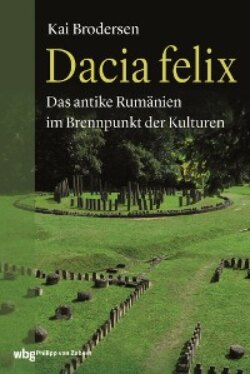Читать книгу Dacia felix - Kai Brodersen - Страница 10
2.2 Epigraphik
ОглавлениеNeben »stummen« sind auch »sprechende«, weil schriftliche Zeugnisse erhalten, die unmittelbar aus ihrer Entstehungszeit stammen. Dies gilt insbesondere für Inschriften, wie sie die Wissenschaftsdisziplin der Epigraphik (Inschriftenkunde) erschließt. Seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. hatte sich in der Mittelmeerwelt und den an sie angrenzenden Regionen für die griechische Sprache eine Alphabetschrift durchgesetzt, die aus der Welt am Ostrand des Mittelmeeres übernommen worden war. Sie ermöglichte nun allen, die schreiben und lesen konnten, die Aufzeichnung und Aufbewahrung von Listen und Texten. Auch das lateinische Alphabet, das wir noch heute verwenden, geht auf diese griechische Alphabetschrift zurück. Vor allem für das Römische Reich hat man geradezu von einer »epigraphischen Kultur« gesprochen, da eine Vielzahl von Inschriften angefertigt und öffentlich zur Schau gestellt wurde. Auch aus der Region innerhalb und außerhalb des Karpatenbogens sind mehrere Tausend antiker griechischer und vor allem lateinischer Inschriften erhalten und ermöglichen so einen direkten Einblick in die antike Welt.
Beschreibstoffe waren dabei oft organischen Ursprungs, so wurden etwa Papyrus (eine aus den Stängeln der vor allem in Ägypten beheimateten Papyrusstaude hergestellte Vorform des erst später in Europa eingeführten Papiers), aber auch Holz- und Rindenstücke sowie Tierhaut (Pergament) beschriftet. Geschrieben wurde darauf mit aus Rohrstängeln oder Federkielen fließender Tinte. Ebenfalls einen organischen und daher vergänglichen Beschreibstoff nutzen zwei am Rand miteinander verbundene und auf der Innenfläche mit Wachs überzogene, jeweils etwa handtellergroße Holztäfelchen; die Wachsschicht konnte man mit einem harten Griffel einritzen und den so geschriebenen Text durch Zusammenklappen und ggf. Verschnüren oder gar Versiegeln der beiden nun aufeinanderliegenden Täfelchen sichern.
Aus der Antike erhalten geblieben sind solche beschrifteten Papyri, Holz- und Rindenstücke und Pergament sowie Holz-Wachs-Täfelchen allerdings nur unter sehr speziellen Bedingungen: Die meisten der antiken Papyri stammen aus dem heißen und trockenen und damit der Verwesung des organischen Stoffes widerstrebenden Wüstensand Ägyptens und sind daher für die Geschichte Dakiens nur selten von Bedeutung; immerhin zwei werden wir unten (in → Kap. 6.2 und 8.1) als historische Quellen kennenlernen. Beschriftete Holz- und Rindenstücke sind in Mooren und Morasten bewahrt geblieben, die ebenfalls eine Verwesung verhinderten; auch diese Erhaltungsbedingungen sind in Dakien rar. Holz-Wachs-Täfelchen schließlich sind sonst fast nur in Pompeji erhalten geblieben, wo der Vesuvausbruch 79 n. Chr. an manchen Stellen eine luftdichte Schicht bildete und so eine Verrottung des Holzes verhinderte. Es gibt aber auch Zeugnisse solcher Täfelchen aus einem römischen Goldbergwerk in Alburnus Maior (Roșia Montană/Goldbach, Kreis Alba, Rumänien), die damit zu einer in der Antike weit verbreiteten, sonst aber fast vollständig verlorenen Quellengruppe von Inschriften auf organischem Material gehören (→ Bild S. 132 oben). Wir werden diese Täfelchen und ihren Wert als historische Quelle unten (in → Kap. 7.3) kennenlernen.
Ähnlich wie die Klapptafeln aus Holz ist eine besondere Gruppe von Texten auf Metalltafeln gestaltet, die man als »Militärdiplom« bezeichnet (→ Bild S. 132 unten). Das römische Heer war in Legionen gegliedert; jede Legion bestand aus zehn Kohorten (cohors) von Fußsoldaten und vier Reiterabteilungen (ala) sowie einigen weiteren Soldaten mit besonderen Aufgaben und hatte insgesamt eine Sollstärke von 5500 Soldaten. Die Legionssoldaten waren römische Bürger, auf Feldzügen kam oft etwa die gleiche Anzahl an sogenannten Hilfstruppen (auxilia) hinzu, deren Mitglieder aus verbündeten oder als Provinz beherrschten Gebieten kamen, aber nicht römische Bürger waren. Der Oberbefehl über eine Legion lag bei einem Mann aus dem Senatorenstand, der als Legat (legatus) bezeichnet wurde. Er war entweder Statthalter der Provinz mit dem Titel propraetorischer Legat des Augustus (also des jeweiligen Kaisers, auf Latein legatus Augusti pro praetore) oder – so in Provinzen mit mehreren Legionen – Legat einer Legion (legatus legionis). Sein Stellvertreter war der Praefekt (praefectus castrorum), dem fünf Tribune (tribuni) unterstanden. Wir werden diese Ämter im Folgenden in den durch Inschriften belegten Lebensläufen antiker Militärs immer wieder genannt finden.
Die Soldaten in den Hilfstruppen erhielten am Ende der 25-jährigen Dienstzeit bei ehrenhafter Entlassung das römische Bürgerrecht für sich und ihre Angehörigen. Dies wurde in einer Urkunde dokumentiert, deren Original in Rom hinterlegt wurde. Der Soldat selbst erhielt eine Abschrift, eben ein Diplom, das aus zwei Metalltäfelchen bestand; der Text der Urkunde ist darauf doppelt niedergelegt, einmal auf der Innenseite der beiden zusammengeklappten Tafeln, die verschnürt und versiegelt wurden, und ein zweites Mal auf der Außenseite. Solange das Siegel nicht erbrochen war, konnte man im Zweifelsfall durch Öffnen der Tafeln beweisen, dass der frei lesbare Außen- dem durch Versiegeln gesicherten Innentext entsprach.
Der Nachweis über die Verleihung des Bürgerrechts war wegen des sicheren Rechtsstatus, den es mit sich brachte, für den Empfänger und seine Familie von hohem Wert. Das dem Soldaten übergebene Militärdiplom auf haltbarem Metall wurde deshalb sicher in den Familien als Erbstück weitergereicht und in Notsituationen wie ein Schatzhort (s.u. → Kap. 2.3) vergraben. Insbesondere durch Zufallsfunde von Metallsondengängern kommen immer wieder Militärdiplome ans Licht – allerdings oft ohne Dokumentation des Fundkontextes und damit unter Verlust wichtiger Informationen zu ihrer Deutung (s.o. → Kap. 2.1). Ein Beispiel für den Text auf einem Militärdiplom soll dessen Aussage veranschaulichen; da sein Fundkontext unbekannt ist, können wir ihm allerdings nicht mehr entnehmen als eben diese Aussage:
Imperator Cae[sar, Sohn des vergöttlichten] Traianus Parthicus, [Enkel] des vergöttlichten Nerva, Traianus Hadrianus Augustus, Oberpriester, zum 3. Mal Inhaber der Tribunicia Potestas, dreimal Kon[sul], hat den Reitern und Fußsoldaten, die Dienst getan haben in ein[er] Ala (Reitereinheit) [und sechs Kohorten (von Fußsoldaten), die da heißen] Hispanorum, [?] Alpinorum, I. Br[itannica milliaria römischer Bürger und II. Brittonum römischer Bürger] Pia Fidelis und V. Gall[orum und VIII. Raetorum, die in] Dacia su[perior unter Marcius Tur[bo sind und die nach] 25 [oder mehr Dienstjahren außer Dienst treten, wenn sie] ehren[voll entlassen sind, und deren Namen] unten aufgeschrieb[en si]nd, ihnen selbst, ihren Kindern und ihren N[ach]kommen das Bürgerrecht gegeben und das Recht zur (rechtsgültigen römischen) Ehe mit den Gattinnen, [die sie zu dem Zeitpunk]t schon hatten, als ihnen das B[ürgerrech]t verliehen wurde, oder, wenn sie unverheiratet sind, mit denen, die sie später noch ehelichen, und zwar jeweils nur ein Mann eine Frau, am Vortag der Iden des November, als Gaius Herennius Capella und Lucius Coelius Rufus Konsuln waren, von der VIII. Kohorte Raetorum, denen Lucius Avianius […]ratus vorsteht, von den Fußsoldaten dem Demuncius, Sohn des Avesso, Eraviscus und seinem Sohn Primus und seinem Sohn Saturninus und seinem Sohn Potens und seiner Tochter Vibia und seiner Tochter Comatumra; abgeschrieben und geprüft anhand der Bronzetafel, die angebracht ist in Rom hinter dem Tempel des vergöttlichten [Augustus] bei der Minerva.
(Lateinische Inschrift auf einem Militärdiplom unbekannter Herkunft, EDCS-69000074)
Die in der Kaisertitulatur genannte Tribunicia Potestas, die auf ein altes republikanisches Jahresamt zurückgeht, wurde den römischen Kaisern in der Regel alljährlich neu verliehen und eignet sich deshalb zur Umrechnung der in einer Inschrift genannten Datierung. Der in dem Militärdiplom genannte Kaiser Trajan hatte die Tribunicia Potestas zum dritten Mal vom 10.12.98 bis zum 9.12.99 n. Chr. inne; die im Militärdiplom dokumentierte Bürgerrechtsverleihung fällt also in das Jahr 98/99 n. Chr.
Die Soldaten hatten in aus Nichtbürgern zusammengesetzten Einheiten des römischen Heeres gedient, in einer Ala als Reiter oder in einer Kohorte als Fußsoldaten. Nun erhielten sie das römische Bürgerrecht für sich, für (jeweils nur) eine bereits vorhandene bzw. künftige Ehefrau und für die Nachkommen aus dieser Ehe. Viele Soldaten waren also längst verheiratet, aber noch nicht in einer nach dem römischen Recht gültigen (und somit u.a. die Erbfolge sichernden) Ehe.
Auf haltbarem Material bewahrt sind sonst vor allem Inschriften auf Stein. Sie widmen sich oft Göttern und Menschen: So gibt es Texte, die in Tempeln und Heiligtümern aufgestellt wurden, aber auch Inschriften, die an große Ereignisse erinnern, wie zum Beispiel an die Gründung einer Stadt oder an wichtige Bauvorhaben wie die Errichtung eines Forumsgebäudes, oder aber an zu Ehrende, denen die Stadt ein Denkmal geweiht hat, und nicht zuletzt an Verstorbene, denen Angehörige einen Grabstein setzen.
Eine besondere Inschriftengattung sind die Angaben auf den Meilensteinen, die bei römischen Straßen in regelmäßigen Abständen aufgestellt waren und nicht nur die für den Straßenbau Verantwortlichen – allen voran den jeweiligen Kaiser – verzeichnen, sondern auch die Entfernung zur nächsten größeren Station. Ebenfalls auf haltbarem Material finden sich aber auch alltäglichere Inschriften, etwa Abdrücke von Stempeln, die auf Ziegel oder Keramikgefäße vor dem Brennen aufgebracht wurden und so ihren Hersteller und/oder den Besteller und damit künftigen Besitzer verzeichnen. Ferner gibt es nach dem Brennen eingetragene Ritzungen auf Ton und auch in Putz, die als Graffiti angebracht wurden und so erhalten blieben. Meilensteine und Inschriften auf Keramikgefäßen werden wir in diesem Band (in → Kap. 7.1 und 8.4 bzw. → Kap. 5.3 und 5.5) als Quellen kennenlernen.
Voraussetzung dafür, dass es überhaupt epigraphische Zeugnisse gibt, ist natürlich, dass in der jeweiligen Kultur die Kenntnis und der Einsatz von Schrift hinreichend weit verbreitet sind. Für die antike Geschichte der Region des Karpatenbogens ergibt sich hieraus eine besondere Problematik: Während eine Vielzahl von Inschriften in der griechischen und vor allem in der von den Römern gesprochenen lateinischen Sprache erhalten sind, kennen wir kein einziges Schriftzeugnis in der Sprache der dort bereits vor den Römern ansässigen Menschen – wahrscheinlich, weil es keine solchen Inschriften gab. Nach einem römischen Bericht nutzten die Daker einmal für einen lateinischen Text, den sie dem römischen Kaiser als Aufschrift auf einem großen Pilz (wohl einen Baumschwamm) überreichten, lateinische Buchstaben (man hat übrigens überlegt, ob genau diese Szene auch auf der Trajanssäule – s.o. → Kap. 2.1 – dargestellt ist):
Als Trajan in seinem Feldzug gegen die Daker sich Tapae annäherte, wo das Lager der Barbaren war, wurde ihm ein großer Pilz gebracht, auf dem in lateinischen Buchstaben eine Botschaft geschrieben war, dass die Burer und andere Verbündete Trajan rieten, umzukehren und den Frieden zu wahren.
(Cassius Dio, Historien 68,8,1)
Ganz offenbar verstanden sich also nach Auffassung des römischen Historikers Cassius Dio – wir werden die Szene unten (in → Kap. 6.1) in ihren historischen Kontext einordnen – bereits vor der römischen Eroberung manche Daker darauf, lateinische Buchstaben zu schreiben und lateinische Texte zu formulieren (oder durch Dolmetscher formulieren zu lassen), um dem römischen Kaiser eine Botschaft zu übermitteln. Ein Beleg für eine »dakische Schriftkultur« ist diese Nachricht freilich nicht.
Eine Zeitlang hielt man es übrigens für möglich, dass im Karpatenbogen sogar eine uralte Schrift genutzt wurde: 1961 waren in der Ortschaft Tărtăria (Gemeinde Săliștea, Kreis Alba, Rumänien) ungebrannte Tontäfelchen ans Licht gekommen, die man rasch in das 6. Jahrtausend v. Chr. datierte und damit zum ältesten Schriftsystem der Welt erklärte, freilich nicht entziffern konnte. Allerdings wurde seinerzeit der Fundkontext nicht dokumentiert, außerdem wurden die Täfelchen selbst zur Haltbarmachung gebrannt, womit der Einsatz von naturwissenschaftlichen Methoden für eine Altersbestimmung unmöglich gemacht wurde. Freilich ist es mehr als wahrscheinlich, dass es sich um eine schlichte und nicht einmal besonders geschickte Fälschung aus der Zeit handelt, in der die Täfelchen angeblich gefunden worden waren. Dasselbe gilt für Bleitafeln, die 1875 dem Museum in Bukarest übergeben wurden. Sie stellten moderne Kopien angeblich original »dakischer«, in griechischen Buchstaben auf Goldplatten aufgeschriebener und ebenfalls nicht deutbarer Texte und Bilder dar. Als Fundort wurde seinerzeit Sinaia genannt, ein Ort nahe der Sommerresidenz des rumänischen Fürsten und späteren Königs Carol I. (s.u. → Kap. 3.2), ohne dass die Fundumstände dokumentiert worden wären; die Goldplatten selbst seien zudem – so hieß es – seit der Herstellung der Kopien verschollen. Es überrascht nicht, dass man auch diese Tafeln nicht als Belege für antike Originale ansehen kann; die angeblichen Kopien gelten heute vielmehr als durch den Wunsch beseelte Fälschung, der seinerzeit jungen rumänischen Nation (s.u. → Kap. 3.2) »dakische« Texte präsentieren zu können.
Es bleibt also bei der Asymmetrie unserer Quellenlage: Für die Geschichte des Karpatenbogens stehen griechisch-römische, nicht aber einheimische »dakische« Schriftzeugnisse zur Verfügung. Es sind folglich fast nur griechische und lateinische Texte, die in diesem Band zu Wort kommen. Bei der Präsentation von Inschriften ist es dabei üblich, dass verlorene, aber anhand von ähnlichen Texten rekonstruierbare Textteile in eckigen Klammern geboten und nicht mehr rekonstruierbare Teile durch drei Punkte markiert werden. Beides ahmen wir in diesem Band in den deutschen Übersetzungen nach (in denen außerdem ein paar Erläuterungen in nur dafür genutzten runden Klammen erscheinen), um so auch in der deutschen Version anzuzeigen, welche Textteile tatsächlich erhalten sind.