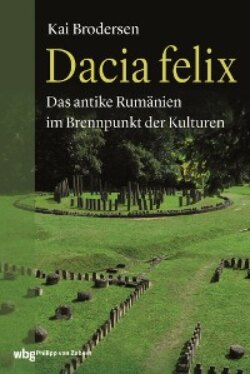Читать книгу Dacia felix - Kai Brodersen - Страница 8
Оглавление1. Einführung
1.1 Ein europäisches Land
Das antike Dakien war im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. ein Teil des römischen Reiches. Sein Gebiet entspricht heute großen Teilen Rumäniens. Der antiken Geschichte dieser Region widmet sich der vorliegende Band.
Das Römische Reich endete um die Zeitenwende unter Kaiser Augustus im Norden an Rhein und Donau. Von 101 n. Chr. an wurde dann das nördlich der Donau gelegene Dakien innerhalb kurzer Zeit für das Imperium Romanum erobert und rasch mit Straßenbau und Städtegründungen zu einer Provinz ausgebaut. Mit seinen Bodenschätzen – allen voran Gold und Salz – und mit seinen für die antike Landwirtschaft günstigen Boden- und Klimaverhältnissen war Dakien von beachtlicher Bedeutung für das Römische Reich. Im späteren 3. Jahrhundert sah sich das Imperium Romanum zunehmend Angriffen von Stämmen ausgesetzt, die in jenseits von Dakien gelegenen Gebieten aufbrachen. Schließlich wurde die Provinz nach nicht einmal zwei Jahrhunderten römischer Verwaltung aufgegeben.
Heute zeugen bauliche Reste und archäologische Fundstücke, Inschriften, Münzen und literarische Zeugnisse von der römischen Vergangenheit der Region. Auch blieben die Kultur und die Sprache der Römer, das Lateinische, lange in Gebrauch, ja, das Rumänische ist in Wortschatz und Grammatik eine romanische Sprache mit einem besonders hohen lateinischen Anteil. Nicht zuletzt ist Rumänien, Romȃnia, der einzige moderne Staat, der in seinem Namen einen direkten Bezug zu den Römern der Antike herstellt.
Rumänien ist ein europäisches Land mit knapp 20 Millionen Einwohnern. 18 Minderheiten – darunter eine deutschsprachige – werden im Land anerkannt und gefördert (zum Vergleich: in Deutschland sind es vier). Rumänien ist Mitglied von EU und NATO und ein immer beliebter werdendes Reiseland. Fast eine Dreiviertelmillion Menschen aus Rumänien lebt in Deutschland: Rumänien und seine Menschen sind uns also in vielerlei Hinsicht nahe. Dieser Band möchte alle, die sich für die Antike, und auch alle, die sich für die Vergangenheit Rumäniens interessieren, in die antike Geschichte Dakiens einführen. Die historischen Quellen sollen dabei ausführlich zu Wort kommen und Grundlage der Darstellung sein, denn unser ganzes Wissen über diese Vergangenheit beruht auf historischen Zeugnissen und deren Interpretation – kurz (wie wir unten in → Kap. 2 und 3 ausführlich sehen werden) auf Quellen und Modellen.
In demselben Verlag wie der vorliegende Band sind drei Bücher zum antiken Dakien lieferbar, die hier nicht verdoppelt werden sollen: 2006 kam das reich bebilderte, die Romanisierung Dakiens veranschaulichende Buch Dacia von Nicolae Gudea und Thomas Lobüscher heraus, 2007 der Parallelband über Thraker, Griechen und Römer an der Westküste des Schwarzen Meeres von Manfred Oppermann, und gleichzeitig mit diesem Band erscheint 2020 die monumentale Publikation Die Trajanssäule von Alexandre Simon Stefan. Auf diese Bücher (s. → Anhang) sei nachdrücklich verwiesen.
DACIA FELIX – das antike Rumänien im Brennpunkt der Kulturen: Der Titel dieses Bandes könnte so missverstanden werden, als habe es ein »antikes Rumänien« gegeben, das mit »Dacia Felix« gleichzusetzen sei, und als habe dieses keine eigene »Kultur« gehabt, sondern sei nur von »Kulturen« umgeben gewesen, die es zu ihrem »Brennpunkt« gemacht hätten. Tatsächlich ist der heutige Staat Rumänien erst vor gut einem Jahrhundert entstanden; ein »antikes Rumänien« gibt es also nicht. Tatsächlich ist es nicht angemessen, die Sichtweise der griechisch-römischen Quellen zu übernehmen und die antiken Bewohner Dakiens als durchweg kulturlos zu beschreiben; vielmehr ist gerade aus der Mischung innerer und äußerer kultureller Einflüsse etwas Eigenes entstanden. Und tatsächlich bezog sich »Dacia Felix« in der Antike auf ein Gebiet, das … nein, mehr wird jetzt noch nicht verraten: Lesen Sie selbst!
1.2 Raum und Zeit
Worum also geht es in diesem Band? Es geht um die antike Geschichte einer europäischen Region nördlich des Unterlaufs der Donau, deren – wie man sagen könnte – Rückgrat der Karpatenbogen ist (→ Karte S. 129). Das fruchtbare Becken westlich und nördlich dieser Hochgebirgskette liegt mitten im heutigen Rumänien. Es hat im Lauf der späteren Geschichte immer wieder unter verschiedenen Herrschaften gestanden und ist heute als Teil des Staats Rumänien auch unter Namen wie Siebenbürgen, Transsilvanien, Ardeal oder Erdély bekannt; in der Geographie spricht man daher vom »Siebenbürgischen Becken« (Podișul Transilvaniei). Umgeben ist dieses Becken im Norden und Osten von den Ostkarpaten, jenseits derer im Nordosten die Bucovina und im Südosten Moldova (Moldau) liegen (noch weiter im Osten, jenseits des Flusses Pruth, folgt dann die heutige Republik Moldavien). Im Süden liegt jenseits der Südkarpaten die Walachei; als Große Walachei oder Muntenien bezeichnet man dabei das Gebiet östlich des Flusses Olt (Alt) – an diese Region schließt sich bis zum Schwarzen Meer die Region Dobrudscha an –, als Kleine Walachei oder Oltenien das westlich davon gelegene Gebiet südlich des Karpatenbogens. Im Süden grenzt die Walachei an die Donau; an deren anderem (südlichen) Ufer liegen heute Serbien und Bulgarien, zu dessen Gebiet die römische Provinz Moesien gehörte.
Über die Ost- und Südkarpaten waren in der Antike Übergänge schwierig. Einzig der Fluss Olt bricht sich aus dem Gebiet innerhalb des Karpatenbogens in spektakulären Schluchten einen Lauf durch das Gebirge und mündet schließlich in die Donau. Die so geschaffene natürliche Verbindung heißt nach einem frühneuzeitlichen Bauwerk auch »Roter-Turm-Pass« (→ Bild S. 130). Heute führen die Europastraße 81 als rumänische Nationalstraße DN7 (Drum naţional 7) und die Bahnstrecke 201 durch die Schluchten. Ein spätantiker Autor, Jordanes, den wir unten (s. → Kap. 5.1) kennenlernen werden, blickt vom Gebiet südlich der Donau aus nach Norden und bezeichnet diesen Pass wahrscheinlich als »Boutae«:
Ich spreche vom alten Dakien. … Dieses Land, das von Moesien aus gesehen jenseits der Donau liegt, wird von einem Kranz von Bergen (corona montium) eingeschlossen und hat nur zwei Zugänge, einen durch Boutae, den anderen durch Tapae.
(Jordanes, Getica 74)
Den »Kranz von Bergen« bilden nach Norden, Osten und Süden also die Karpaten; nach Westen ergänzen ihn an Bodenschätzen reiche Gebirge (heute Munții Apuseni). Jenseits von diesen liegt südwestlich – im Anschluss an die Kleine Walachei – das Banat, nördlich davon das Kreisch-Gebiet und ganz im Norden Maramureș. Einen Zugang zum Siebenbürgischen Becken aus Südwesten bot und bietet vor allem das Bistra-Tal zwischen Caransebeș (Kreis Caraș-Severin, Rumänien) und Haţeg (Hatzeg, Kreis Hunedoara, Rumänien); heute verläuft hier die rumänische Nationalstraße DN68 (die Bahnstrecke 911 wurde 1995 stillgelegt). Diesen Durchgang bezeichnet der eben genannte Autor als »Tapae«.
Bereits in vorgeschichtlicher Zeit war das in diesem »Kranz von Bergen« gelegene Siebenbürgische Becken als günstiges Siedlungsland gegenüber weiter vom Karpatenbogen entfernten Regionen ausgezeichnet, aber auch in mancher Hinsicht etwas isoliert. Die Donau war vor allem an ihrem Durchbruch am sogenannten Eisernen Tor zwischen den Serbischen Karpaten und dem Banater Gebirge für die durchgehende Schifffahrt ungeeignet. Die im Westen des Kreisch-Gebiets vom Fluss Theiß durchflossene ungarische Tiefebene blieb bis ins 19. Jahrhundert, in dem sie durch Flussregulierung und Trockenlegungen erschlossen wurde, so sumpfig, dass sie landwirtschaftlich kaum nutzbar und durch von Mücken übertragene Krankheiten auch kaum bewohnbar war. Nicht zuletzt galten die Wälder in den Gebirgen, die östlich dieser Tiefebene und nördlich der Donau liegen, als fast undurchdringbar. Dies erlebte schon im 1. Jahrhundert v. Chr. ein römischer Befehlshaber (mehr zu ihm erfahren wir unten in → Kap. 5.2), der von Moesien, also vom Gebiet südlich der Donau aus aufbrach:
Curio kam bis nach Dakien, schreckte aber vor der Dunkelheit der Wälder zurück.
(Florus, Epitome 1,39)
Im späteren westeuropäischen Begriff »Transsilvanien« (Land jenseits der Wälder) schlägt sich diese Schwierigkeit des Zugangs nieder.
Die guten Böden mit ebenso guter natürlicher Bewässerung, ein mildes Klima, für Holzernte und Jagd nutzbare Wälder in den Mittel- und Hochgebirgen und reiche Bodenschätze machen das Gebiet innerhalb des Karpatenbogens und seine Nachbarregionen gleichsam vom Glück begünstigt, eben »glücklich«, lateinisch FELIX.
Was lässt sich anhand der historischen Quellen, wie sie uns für die Zeit ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. erhalten sind, über jene Welt aussagen? Welche »Kulturen« gab es, die auf die Menschen in jenem Gebiet Einfluss nahmen? Wie machten Griechen, Perser und Makedonen es zu einen »Brennpunkt«? Und was können wir über seine Struktur und Kultur vor der römischen Eroberung aussagen? Wann und warum geriet die Region des Karpatenbogens dann in den Fokus der Römer? Wie wurde es zur römischen Provinz? Und wann und warum wurde diese Provinz wieder aufgegeben? Der vorliegende Band nimmt vor allem die zwei Jahrhunderte vor der römischen Eroberung Dakiens und dann die römische Beherrschung des Gebiets in den Blick.
Nicht nur die in der populären rumänischen Geschichtsauffassung gefeierten dakischen Könige Burebista im 1. Jahrhundert v. Chr. und Decebal im 1. und frühen 2. Jahrhundert n. Chr. wollen wir kennenlernen, sondern anhand der Quellen Fragen wie die eben genannten zu beantworten versuchen. Dakien war vom frühen 2. bis ins späte 3. Jahrhundert n. Chr., von Trajan (53–117 n. Chr., Kaiser seit 98) bis Aurelian (214–275 n. Chr., Kaiser seit 271), Teil des Römischen Reichs und bereicherte dessen kulturelle Vielfalt. Die antike Geschichte der Welt innerhalb und außerhalb des Karpatenbogens wollen wir nun anhand der antiken Quellen behandeln.