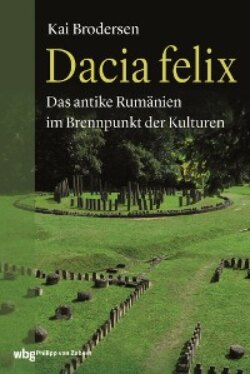Читать книгу Dacia felix - Kai Brodersen - Страница 9
2. Quellen 2.1 Archäologie
ОглавлениеWenn man versucht, eine fast zwei Jahrtausende zurückliegende Vergangenheit zu rekonstruieren, ist man auf historische Quellen und auf Modelle für ihre Deutung angewiesen. Im Spannungsfeld von Evidenz und deren Interpretation arbeiten Historikerinnen und Historiker, wenn sie sich mit antiker Geschichte befassen. In diesem Kapitel sollen zunächst archäologische Zeugnisse, Inschriften und Münzen behandelt werden, da uns diese Quellen – wenn auch oft nur in Fragmenten – unmittelbar so erhalten sind, wie sie in der Antike angefertigt wurden. Danach widmen wir uns den literarischen Quellen.
In der Wissenschaftssystematik unterscheidet man traditionell zwischen der »Vorgeschichte« (Prähistorie, Ur- und Frühgeschichte) und der »Geschichte« anhand der von den Disziplinen behandelten Quellen und der zu ihrer Deutung eingesetzten Methoden. Die »Vorgeschichte« befasst sich mit materiellen Zeugnissen aus der Vergangenheit, die mit den Methoden der Archäologie erschlossen und anhand ihrer Erscheinung und ihres Fundkontextes gedeutet werden. Beim Fach »Geschichte« hingegen stehen die überlieferten schriftlichen Zeugnisse und ihre methodisch fundierte Deutung im Mittelpunkt, auch wenn die nichtschriftliche (und im Vergleich zu den Texten oft als »stumm« charakterisierte) Evidenz ihre Bedeutung nicht verliert.
Wie dieser Band zeigt, stellen bei einer Darstellung der Geschichte der Antike die überlieferten Texte die am klarsten »sprechende« Quellengattung dar. Doch kann auch in der Zeit, für die uns schriftliche Zeugnisse vorliegen, die archäologische Evidenz – also die durch Fernerkundung (etwa Luftbilder oder Radaraufnahmen), Ausgrabungen vor Ort oder Erfassung von Streufunden erschließbare materielle Kultur – mit Recht den Anspruch erheben, einen besonders unmittelbaren Bezug zur Antike zu vermitteln: So, wie ein Fundstück – vom Ziegelstein bis zur Mauer, vom Alltagsgegenstand bis zum Schmuckstück – in der Antike vorhanden war, so ist es nach seiner Auffindung auch uns heute zugänglich. Zudem erlaubt oft der ebenso »stumme« Fundkontext eine weitergehende Deutung, etwa wenn andere Funde oder Befunde eine zeitliche Einordnung des Fundstücks ermöglichen.
Man darf freilich nicht übersehen, dass die archäologische Erkundung einer Region (wie auch die historische Deutung) keine »ewigen Wahrheiten« festlegen kann, da ihre Erforschung verständlicherweise stets durch zeitgenössische Interessen und Fragestellungen geleitet ist. Schon die Auswahl der für Fernerkundung, Ausgrabung oder Erfassung von Streufunden vorgesehenen Gegenden ist oft durch aktuelle politische Vorgaben oder aber »Sachzwänge« bedingt: Die bereits im 18. Jahrhundert begonnenen Ausgrabungen der als Sarmizegetusa Regia bekannten Anlage in den Bergen bei Grădiștea de Munte (Gemeinde Orăștioara de Sus, Kreis Hunedoara, Rumänien; s.u. → Anhang) deuten die Stätte mit phantasievollen, aber nicht immer ausreichend gesicherten »Rekonstruktionen«, die von der Annahme einer kultischen und politischen Funktion der einzelnen Befunde ausgehen (→ Bild S. 131). Luftbilder oder moderne Formen der Fernerkundung waren in der Region im Karpatenbogen in der Zeit des Kalten Kriegs bis 1989 kaum zugänglich, da ihre Publikation, wie man meinte, den »Feinden« militärisch von Nutzen sein könnte; so blieben Teile der antiken Gegebenheiten in jener Region lange unentdeckt. Großflächige Notgrabungen im Vorfeld des seither laufenden Ausbaus der modernen Infrastruktur des Landes durch Autobahnen und verbesserte Bahntrassen kennzeichnen nun manche neuere archäologische Maßnahme und erschließen so – anders als punktuelle Grabungen an bereits bekannten Orten – bisher unentdeckte Zeugnisse für die Nutzung und Besiedlung des Landes.
Zu den von der Archäologie erschlossenen Zeugnissen gehören aber auch antike Kunstwerke, die auch aus anderen Teilen der antiken Welt stammen, vor allem bewusste Schöpfungen von flächigen Bildwerken. Allerdings waren Zeichnungen und Gemälde in der Antike ebenso wie in späteren Epochen meist auf organischem Material wie Holz oder Leinwand geschaffen und sind so im Lauf der Zeit untergegangen. Reliefs und Plastiken aus Bronze und insbesondere aus Stein hingegen hatten bessere Chancen, erhalten zu bleiben. Das wohl wichtigste erhaltene bildliche Zeugnis für die im vorliegenden Band erzählte Geschichte ist das Marmor-Reliefband auf der Trajanssäule, die noch heute auf dem Forum des Kaisers Trajan in der Hauptstadt des Imperium Romanum steht: in Rom. In einer langen, im Original erhaltenen Reihe von Szenen stellt es die Siege der Römer und des Kaisers Trajan im Krieg gegen die Daker zur Schau (s.u. → Kap. 6.4). Die Reliefbilder sollten dabei ohne jeden Text verständlich sein (und sind insofern ebenfalls »stumm«), erklärten sich vielfach gleichsam von selbst und blieben auch für die spätere Wahrnehmung der römischen Eroberung prägend.