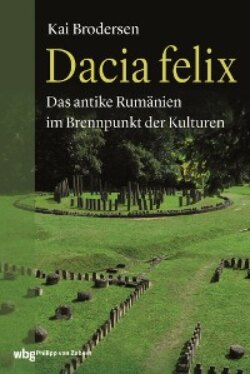Читать книгу Dacia felix - Kai Brodersen - Страница 12
2.4 Literarische Zeugnisse
ОглавлениеSowohl die »stummen« materiellen Zeugnisse als auch die – zwar Texte bewahrenden, aber ebenfalls selten ihren historischen Kontext direkt offenbarenden – epigraphischen und numismatischen Zeugnisse bedürfen einer Deutung, die erst dann möglich wird, wenn wir die erhaltenen literarischen Belege in die Rekonstruktion einbeziehen. Überliefert sind beachtlich viele antike Texte nicht unmittelbar, sondern durch Abschriften von Abschriften von Abschriften usw. Die uns so bewahrten Texte wurden also durch wiederholte Kopien in einer ununterbrochenen Kette so lange abgeschrieben, bis eine Textfassung erhalten geblieben ist. Die meisten Abschriften wurden auf Pergamentblättern – also auf einem aus Tierhaut hergestellten Beschreibstoff – angefertigt, die dann zu einem Codex (Plural Codices) genannten Buch zusammengebunden wurden. Die meisten uns erhaltenen Codices stammen aus dem Hochmittelalter und sind damit weit über ein Jahrtausend von der Entstehungszeit eines Textes entfernt! Es versteht sich, dass dieses Verfahren Folgen für die Qualität und für die Quantität erhaltener antiker literarischen Zeugnisse hat.
Was die Qualität der dank der mittelalterlichen Kopien überlieferten Texte betrifft, führt das Verfahren wiederholter Abschriften zu einer unvermeidlichen Verschlechterung, da in einer Abschrift eingeführte Fehler – einfache Schreibfehler, aber auch das Fehlen oder die Doppelschreibung von Buchstaben, Wörtern, Zeilen und ganzen Passagen – bei der nächsten Abschrift einfach übernommen wurden; man kann dies mit der Weitergabe von Fehlern beim Kinderspiel »Stille Post« vergleichen. Die Rekonstruktion des vom Autor gewollten Originaltextes aus späteren Abschriften ist das Ziel der Editionsphilologie, auf deren Ergebnissen jede historische Rekonstruktion notwendig beruht. Im vorliegenden Band sind für antike Texte die heute jeweils maßgeblichen Editionen verwendet und eigens ins Deutsche übersetzt worden.
Was die Quantität der Texte betrifft, sind die allermeisten Werke, die in der Antike umliefen, verloren; nur ein kleiner Bruchteil ist überhaupt erhalten. Man kann versuchen, den Umfang dieses Verlusts zu beziffern, indem man in erhaltenen Texten zitierte antike Buchtitel in ein Verhältnis zu den tatsächlich mit diesen Titeln erhaltenen Büchern setzt, und kommt damit bestenfalls auf eine sehr kleine einstellige Prozentzahl von uns aus der Antike durch Abschriften erhaltenen Werken.
Anschaulich macht dies die Tatsache, dass wir von fünf antiken Werken zu der in diesem Band behandelten Geschichte wissen, dass aber keines davon erhalten ist und allenfalls Fragmente bewahrt sind, die heute in den Sammlungen Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrHist) und The Fragments of the Roman Historians (FRH) zusammengestellt sind: Dion von Prusa (um 40–um 115 n. Chr.), der schon in der Antike angesichts seiner rhetorischen Kunst den Beinamen Chrysostomos (»Goldmund«) erhielt, schuf ein griechisches Werk mit dem Titel Getika (FGrHist 707), das völlig verloren ist (s.u. → Kap. 5.9). Kaiser Trajan schrieb ein mehr als ein Buch umfassendes lateinisches Werk Dacica (FRH 96), aus dem nur fünf Wörter erhalten sind (s.u. → Kap. 6.1). Von Trajans Leibarzt Titus Statilius Kriton kannte man in der Antike Getika (FGrHist 200), die heute bis auf winzige Fragmente verloren sind. Der römische Autor Gaius Plinius Secundus d. J. (61/62–113/115 n. Chr.) spricht in einem Brief (8,4) davon, dass sein (uns nur aus Plinius’ Briefen bekannter) Altersgenosse und Freund Caninius Rufus ein griechisches Gedicht über die Dakerkriege Trajans schrieb (s.u. → Kap. 6.1–2); von diesem Werk, wenn es je fertiggestellt wurde, ist nichts erhalten. Und das vorletzte Buch der – wie Homers Ilias 24 Bücher umfassenden – Römischen Geschichte des griechischen Historikers Appianos von Alexandreia (Appian, 90/95–um 160 n. Chr.) schließlich trug nach Ausweis der Inhaltsverzeichnisse jenes Geschichtswerks den Titel Dakike, ist aber ebenfalls völlig verloren. Für das Thema des vorliegenden Bandes zeigt sich an diesen fünf vom Titel her bekannten, uns aber verlorenen antiken Werken zur getischen und dakischen Geschichte der Umfang des Verlusts antiker Literatur besonders deutlich.
Die Menge der tatsächlich erhaltenen Literatur ist heute fast völlig stabil; es geschieht nur äußerst selten, dass ein bisher nicht bekannter Text identifiziert wird. Dies gelingt entweder durch einen Zufallsfund – wie zuletzt bei der Wiederentdeckung einer Schrift über Gelassenheit des römischen Mediziners Galen – oder durch die Identifizierung einer älteren Abschrift, die für eine neue Nutzung desselben Beschreibstoffs ausradiert wurde, im Falle von Pergament durch Abschaben der Pergamentoberfläche. Ein solches Artefakt nennt man »Palimpsest« (von griechisch palin, »wieder«, und psestos, »abgeschabt«); mit chemischen oder neuerdings optischen Methoden kann man aber versuchen, die erste Beschriftung wieder lesbar zu machen. Wir werden ein für die Geschichte Dakiens im 3. Jahrhundert n. Chr. wichtiges Palimpsest unten (in → Kap. 8.3) kennenlernen.
Manche antike Werke sind nur teilweise in späteren Auszügen erhalten, für die einzelne Passagen ausgewählt worden sind, während das vollständige Werk im Lauf der Zeit verloren ging. Drei Beispiele können dies verdeutlichen: Die Historische Bibliothek des griechischen Historikers Diodoros (Diodor) von Agyrion aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. umfasste einst 40 Bücher, das um die Zeitenwende entstandene lateinische Geschichtswerk Historia Philippica des Pompeius Trogus zählte 44 Bücher und die griechischen Historien des Lucius Cassius Dio (2./3. Jahrhundert n. Chr.), der die römische Geschichte von den Anfängen bis in das Jahr seines eigenen Konsulats 229 n. Chr. behandelte, bestanden sogar aus 80 Büchern. Keines dieser drei Werke ist vollständig erhalten geblieben: Die Bücher des Pompeius Trogus wurden ein paar Jahrhunderte später von einem sonst unbekannten Marcus Iunianus Iustinus (Justin) exzerpiert; das vollständige Werk ging bis auf die Inhaltsübersichten der einzelnen Bücher verloren, nur Justins Auszüge sind erhalten geblieben. Von den Werken des Diodor und des Cassius Dio sind nur jeweils einige Bücher bewahrt, andere müssen wir späteren Auszügen entnehmen.
Eine besondere Bedeutung haben dafür Exzerpte, die im 10. Jahrhundert n. Chr. auf Anweisung des byzantinischen Kaisers Konstantinos VII. Porphyrogennetos (900–959 n. Chr., Kaiser seit 945) angefertigt wurden und deshalb als »Konstantinische Exzerpte« bezeichnet werden. Mindestens 26 griechische Geschichtswerke wurden für den Kaiser nach 53 thematischen Kategorien durchgesehen und dann jeweils einschlägige Passagen ohne ihren weiteren Kontext exzerpiert. Erhalten geblieben sind die Exzerpte über Gesandtschaften von Römern an Fremde und von Fremden an Römer, dann – übrigens in jeweils nur einem einzigen Codex – über Belagerungen und über Tugenden und Laster sowie – in einem Palimpsest (s.o.) – über Sinnsprüche. Für Cassius Dio können wir außerdem Exzerpte nutzen, die auf Anordnung des byzantinischen Kaisers Michael VII. Dukas (um 1050–um 1090 n. Chr., Kaiser 1067–1078) ein Mönch namens Johannes Xiphilinos d. J. für ein Werk über »25 römische Monarchen von Pompeius Magnus bis zu Alexander Mamaeas« aus den Büchern 36–80 der Historien anfertigte, nämlich über Persönlichkeiten von Gnaeus Pompeius Magnus (106–48 v. Chr.), dem Gegenspieler Caesars, bis zu Alexander Severus (208–235 n. Chr., Sohn der Iulia Mamaea, Kaiser seit 222). Wie man denjenigen Passagen, für die auch der vollständige Text erhalten ist, entnehmen kann, verkürzen die Exzerpte am Anfang und Ende den Originaltext, geben ihn aber im Hauptteil meist vollständig und wörtlich wieder, so dass die Exzerpte uns einen Blick in das Original ermöglichen.