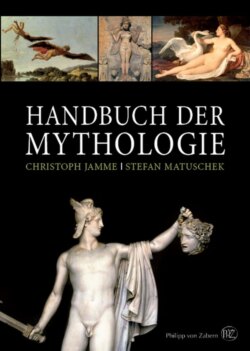Читать книгу Handbuch der Mythologie - Kai Brodersen - Страница 22
Aphrodite/Venus
ОглавлениеAphrodite ist die Göttin der Schönheit, der Liebe, der erotischen Verführung und der Lust. Ihr Kult ist orientalischer, wahrscheinlich phönizischer Herkunft, als wichtigste Kultstätten gelten die Inseln Zypern und Kythera. Sie werden beide in der Entstehungsgeschichte der Göttin genannt, mit der Hesiods ▸ Theogonie (Verse 188–206) zugleich deren Ausrichtung auf die geschlechtliche Lust motiviert: Der Gott Kronos schlägt seinem Vater Uranos (▸ Uranos und Kronos) mit einer Sichel das Geschlechtsteil ab, es fällt ins Meer und erzeugt weißen Schaum, dem Aphrodite (von gr. aphros = Schaum) an der Insel Zypern entsteigt. Sie gelangt von dort aus nach Kythera, ihr Begleiter ist der Liebesgott Eros. In den homerischen Epen gilt sie dagegen als eine Tochter des ▸ Zeus. Die Odyssee erzählt in einer komödiantischen Szene (VIII, 266–366), wie sie von ihrem Gatten Hephaistos beim Ehebruch mit dem Kriegsgott Ares gestellt wird: Als Gott der Schmiedekunst verfertigt Hephaistos ein spinnwebfeines Metallnetz, das die Ehebrecher im Bett wie in einer Falle fängt. Diese Szene motiviert das viel zitierte (‚homerische‘) Lachen der Götter. In der Ilias (III, 369–448) greift Aphrodite in den ▸ Trojanischen Krieg ein, indem sie den von Menelaos fast besiegten Paris vom Schlachtfeld rettet. Diese Parteinahme für die Trojaner passt damit zusammen, dass sie den Raub der Helena durch Paris provoziert und damit den Krieg mit ausgelöst hat. Denn mit dem Versprechen, ihm die Schönste der Frauen zu verschaffen, hat Aphrodite Paris bestochen, damit er ihr und nicht Hera oder ▸ Athene den goldenen Apfel als Schönheitspreis zuerkennt (daher der Ausdruck ‚Zankapfel‘). Platons Symposion (180d – 181e) unterscheidet die hesiodische und die homerische Aphrodite als zwei Göttinen: die „himmlische“, die rein männlich durch Uranos, und die „gemeine“, die zweigeschlechtlich durch Zeus und Dione gezeugt ist. Ihnen entsprechen zwei Arten der Liebe: die geistige, die sich nur unter Männern und insbesondere als philosophisch-akademische Knabenliebe zeige, und die körperliche.
Seit dem Ende des 4. Jh. v. Chr. wird Aphrodite mit der italischen Göttin Venus (lat. Anmut, Liebreiz) gleichgesetzt. Als Mutter des ▸ Aeneas, des aus Troja stammenden mythischen Ahnherrn Roms, ist sie die Schutzgöttin dieser Stadt, in der sie seit dem 3. Jh. v. Chr. mit mehreren Tempeln verehrt wird. Der unter Kaiser Hadrian 121 n. Chr. begonnene Doppeltempel für Venus und Roma auf dem Römischen Forum ist das größte Gotteshaus der antiken Stadt. Die Aeneis Vergils (19 v. Chr.), das römische Nationalepos, erzählt, wie Venus an drei entscheidenden Stellen eingreift, um das Schicksal ihres Sohnes zum Guten, d.h. letztlich zur Gründung Roms zu wenden: Sie löst seine Liebe zu Dido, die ihn bei sich behalten will (I, 657–694), sie bittet den Meeresgott Neptun, ihn vor Junos Nachstellungen sicher segeln zu lassen (V, 779–798), und sie bewegt schließlich ihren Gatten Vulkan (gr. Hephaistos) dazu, Aeneas für seine entscheidenden Kämpfe mit den besten Waffen auszustatten (VIII, 370–386). Ovids ▸ Metamorphosen (1 v. –10 n. Chr., X, 524–739) schildern in einer Episode Venus’ trauervoll endende Liebe zu dem schönen Jüngling Adonis, der trotz all ihrer Ermahnungen zur Vorsicht – sie erzählt ihm unter Küssen eine lange didaktische Geschichte dazu – auf der Jagd von einem Eber getötet wird. Weitere Episoden zeigen sie als Helferin (sie beglückt den Bildhauer Pygmalion, indem sie seine vollkommene Frauenstatue zum Leben erweckt, X, 270–297) und Rächerin (den Sonnengott, der ihren Ehebruch mit Ares verriet, straft sie mit einer unglücklichen Liebe, die den Tod der Geliebten verursacht, IV, 169–255). In zahlreichen Glücks- und Unglückserzählungen – Venus spielt in vielen Episoden der Metamorphosen eine Rolle – werden so die Wechselfälle vorgeführt, die aus Schönheit, Liebe und erotischer Verführung folgen. In einem Chorlied des Sophokles (Die Trachinierinnen, Mitte des 5. Jh. v. Chr., V. 497–516) wird diese Schicksalsmacht der Aphrodite beschworen (wobei die Göttin nach ihren Kultstätten Kypris und Kythere benannt ist): „Die erhabensten Siegesgewalten erringt doch Kypris stets. […] Die erfreuende Kythere saß daneben, hoch führend der Kämpfe Richtstab.“
Im Prozess der Christianisierung ist Aphrodite geradezu das Paradebeispiel, warum aus christlicher Sicht der antike Polytheismus und seine Göttergeschichten als frivol und sündig gelten. Dennoch bleibt sie in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Literatur in hohem Kurs. Möglich wird das durch die Gewohnheit, die heidnischen Götterfiguren als Allegorien, d.h. als bildhafte Vergegenwärtigung von Begriffen zu verstehen. Wer in dieser Gewohnheit von Aphrodite dichtet, huldigt keiner antiken Göttin, sondern verwendet einen künstlerischen Code zur Darstellung und Behandlung von weiblicher Schönheit und Liebe. Durch die Häufigkeit gerade dieser beiden Themen in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Dichtung erklärt sich die Häufigkeit der Venus-Figur (die Dominanz des Lateinischen im westlichen Europa verdrängt den griechischen Namen) in dieser grundsätzlich allegorisch verfahrenden Literatur. Deren Höhepunkte liegen im Hochmittelalter und im Barock. Der erste ist die höfisch-ritterliche Liebesdichtung in Frankreich und Deutschland im 12. und 13. Jh. In ihr dient die namentlich genannte Venus (z.B. im französischen Rosenroman, Roman de la rose von Guillaume de Lorris und Jean de Meung, 13. Jh.) oder die von ihr abgeleitetet Vorstellung einer „Göttin Minne“ (z.B. Gottfried von Straßburg, Tristan, Anfang des 13. Jh.) als Standardfigur, um die Macht der Liebe zu vergegenwärtigen. Mit einer negativen christlich-moralischen Bewertung erscheint sie in der im 14. Jh. entstandenen Tannhäuser-Legende: Sie erzählt von einem Ritter, der von der Frau Venus in einen Zauberberg (Venusberg) gelockt und dort verführt wird, der dann aus dieser erotischen Verlockung ausbricht und durch eine Wallfahrt nach Rom sein Seelenheil zu retten versucht, aufgrund des zu spät kommenden göttlichen Gnadenzeichens jedoch verzweifelt in den Venusberg zurückkehrt. In der deutschen Romantik ist diese Legende wieder populär geworden, in der erzählenden Literatur (Ludwig Tieck, Der getreue Eckart und der Tannhäuser, 1799; antichristlich-ironisch Heinrich Heine, Der Tannhäuser, 1836), vor allem aber durch Richard Wagners Oper Tannhäuser (1845).
Den zweiten, barocken Höhepunkt bilden das an Ovids Venus-Adonis-Episode anknüpfende Adone-Epos (1623) des zu seiner Zeit europaweit verehrten manieristischen italienischen Dichters Giovanbattista Marino sowie eine Vielzahl von Gedichten, die mit der antiken Figur, deren Beschreibung und szenischer Verlebendigung Macht und Wirkungen der weiblichen Schönheit und der Liebe ausmalen. Ein Gedicht von Christian Hofmann von Hofmannswaldau (1617–1679, Die versöhnte Venus) beginnt dabei mit einer ähnlichen Beschwörung der unentrinnbaren Schicksalsmacht, wie sie schon Sophokles bietet: „Die Göttin so die Welt und alle Hertzen bindet …“ Die Beliebtheit und Verbreitung der Figur haben auch damit zu tun, dass die antike mythische Anschauung eine viel größere erotische und sexuelle Freizügigkeit erlaubte, als sie bei der Darstellung historischer oder gar gegenwärtiger Personen toleriert worden wäre. In der Allegorie liegt damit eine Lizenz zur deutlicheren Erotik und Nacktheit. Ein anonymer, Scherzlied überschriebener Text in Benjamin Neukirchs Gedichtsammlung (1697–1727) beschreibt Venus und ihren Sohn Cupido (gr. Amor) zusammen nackt im Bade sitzend, mit detailliertem forschendem Interesse an dem je anderen Körper. Die literarische Beliebtheit der Venus-Figur belegt in dieser Zeit auch William Shakespeares Kleinepos Venus and Adonis (1593). Es ist das erste Werk, das Shakespeare im Druck veröffentlichte, und es blieb zu seinen Lebzeiten sein populärstes (16 Auflagen bis 1640).
In dem Maße, wie in der modernen Dichtung seit der Mitte des 18. Jh. mythische Allegorien insgesamt zurückgehen, nimmt auch die Präsenz der Venus-Figur ab. Sie dient nicht mehr als Standardausdruck der Themen Liebe und Schönheit, sondern begegnet nur noch dort, wo ausdrücklich auf die Antike reflektiert wird. Das geschieht affirmativ als neoklassizistischer Antikenkult (z.B. in dem Gedicht Vénus de Milo, 1852, in dem Charles Leconte de Lisle die antike Skulptur als Idealschönheit verehrt), aber auch satirisch (wie in Charles Baudelaires Prosagedicht Le fou et la Vénus, 1862, das den Antikenkult in einer zu Füßen der Venus-Skulptur kauernden Narrenfigur lächerlich macht). Arthur Rimbauds Sonett Vénus Anadyomène (Die auftauchende Venus, 1870) destruiert den klassizistischen Schönheitskult, indem es das Motiv der schaumgeborenen Göttin in die Beschreibung einer hässlichen Alten verkehrt, die sich aus einem Badezuber quält. Émile Zolas Roman Nana (1879/80) schildert das Leben einer Pariser Prostituierten, die als ‚Blonde Venus‘ auf der Operettenbühne steht: Die künstlerische Idealisierung bricht sich an der harten Berufswirklichkeit der verführerisch schönen Frau.
Sandro Botticelli: Die Geburt der Venus, um 1482, Florenz, Galleria degli Uffizi
Die Darstellung der Göttin in den bildenden Künsten ist durch zwei antike Skulpturen geprägt: die nach ihrem ersten Ausstellungsort, der römischen Villa Medici, benannte Venus von Medici und die nach ihrem Fundort, der Insel Milos, benannte Venus von Milo. Es sind zwei aus dem 1. Jh. v. Chr. stammende lebensgroße Marmorstatuen einer idealschönen nackten Frau. Die eine (Medici) versucht mit Armen und Händen ihre Brust und ihre Scham zu verdecken, die andere, die sich nur unvollständig, ohne Arme erhalten hat, ist von den Hüften an mit einem Tuch verhüllt. Die erste ist in der Neuzeit seit der Renaissance bekannt und hat als Typus der ‚schamhaften Venus‘ (Venus pudica) die Kunstgeschichte beeinflusst, die andere wurde erst 1820 entdeckt. Beide sind vielfach kopiert und auch malerisch dargestellt worden und zählen zu den bekanntesten Kunstwerken überhaupt.
In der Malerei der Renaissance, des Barock und des Rokoko ist die Göttin Venus als Verkörperung des Idealschönen das zentrale Sujet. Sie ist der Prototyp des weiblichen Aktes, den sie als mythische Figur und in antikisierender Ästhetik viel freizügiger repräsentieren kann, als es mit historischen oder noch lebenden Personen nach den zeitgenössischen Sittlichkeitsvorstellungen erlaubt wäre. Wie in der Literatur gibt der Mythos auch hier eine Lizenz zur deutlicheren Erotik und Nacktheit. Das gilt für viele Gemälde, die kanonisch geworden und durch massenhafte Reproduktionen bis heute populär sind: Die Geburt der Venus (1480er-Jahre) von Sandro Botticelli, Giorgiones Schlafende Venus (1508/10), die Venusgemälde von Lucas Cranach d. Ä. (1509, 1515/20), Tizians Venus von Urbino (1538). Tizians Himmlische und irdische Liebe (1514) eröffnet dagegen eine moralische Perspektive, indem die nackte einer gekleideten, keuschen Frau gegenübergestellt und damit in der Nachfolge Platons zwischen geistiger und körperlicher Liebe unterschieden wird. Durch Marsilio Ficinos Symposion-Kommentar ist diese Aufspaltung der Liebesgöttin in eine „Venus celestis“ und „Venus vulgaris“ der christlichen Renaissancewelt vermittelt worden (Über die Liebe oder Platons Gastmahl, 1474, Kap. 7: „Über die zweierlei Arten des Eros und die beiden Liebesgöttinnen“). In der französischen Hofkultur des Rokoko wird die Grenze zwischen Mythos und Gegenwart mitunter motivisch überspielt. So enthält François Bouchers Toilette der Venus (1751) optische Hinweise auf seine Auftraggeberin Madame de Pompadour, die Maitresse Ludwigs XV. In der Fülle der Venus-Bilder prägen sich als typische Szenen die Geburt aus dem Meerschaum, der Ehebruch mit Ares/Mars, Begegnungen mit Aeneas und intime Situationen bei der Toilette oder vor dem Spiegel aus. Ihre Attribute sind die Muschel (für das weibliche Geschlecht), der Delphin, der Apfel (Erinnerung an das Paris-Urteil), der Spiegel; der kindliche Eros/Amor ist oft ihr Begleiter. In Jean-Auguste-Dominique Ingres’ Vénus Anadyomène (1808–48) ist die künstlerische Idealisierung des nackten Frauenkörpers aufs Äußerste gesteigert, Otto Dix’ Venus mit schwarzen Handschuhen (1932) zeigt sie dagegen als zeitgenössische Prostituierte.
Jean-Auguste-Dominique Ingres: Venus Anadyomene, Paris, Musée du Louvre
Woody Allens Komödie Mighty Aphrodite (dt. Geliebte Aphrodite, 1995) konfrontiert die im Film mehrfach von einem antiken griechischen Chor beschworene Schicksalsmacht der Liebesgöttin mit der Banalität des aktuellen Pornogewerbes.
LITERATUR
Mario Leis (Hg.): Mythos Aphrodite. Leipzig 2000
Lotten Peterson u .a.: The Making of a Goddess. Aphrodite in history, art, literature. Lund 2005
Monica S. Cyrino: Aphrodite. London u.a. 2010
Amy C. Smith, Sadie Pickup (Hg.): Brill’s Companion to Aphrodite. Leiden u.a. 2010 SM