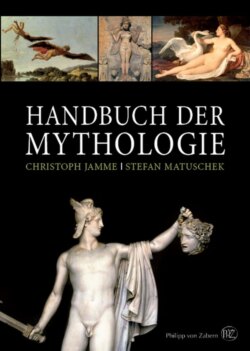Читать книгу Handbuch der Mythologie - Kai Brodersen - Страница 21
Antigone
ОглавлениеAntigone ist die Tochter des ▸ Ödipus, des Königs von Theben, und dessen Mutter Iokaste, also ein Kind des Inzests. Das sie auszeichnende Motiv ist der Widerstand gegen politische Macht: Als sich ihre Brüder Eteokles und Polyneikes gegenseitig im Streit um die Herrschaftsfolge ihres Vaters töten, widersetzt sich Antigone dem Verbot, den als Angreifer Thebens verfemten Polyneikes zu bestatten. Ihre deutlichste Gestalt erhält die Figur in der Antigone-Tragödie des Sophokles (um 440 v. Chr.). Er spitzt den Stoff auf den Konflikt mit Kreon zu, der als Iokastes Bruder und damit Antigones Onkel nach dem Tod von Ödipus’ Söhnen den Thron erbt und als Herrscher von Theben das Bestattungsverbot ausspricht. Als Antigone sich widersetzt, erlässt Kreon das Urteil, dass sie lebendig in ein Felsengrab eingeschlossen wird. Dort erhängt sich Antigone. Beim Anblick ihrer Leiche folgen ihr Haimon, ihr Verlobter und Kreons Sohn, sowie dessen Mutter durch Selbstmord in den Tod. Sophokles entwickelt die Tragik aus der Radikalität, mit der Kreon und Antigone auf ihren je einseitigen Positionen beharren. Kreon verstößt mit seinem politischen Urteil über Polyneikes gegen das göttliche Bestattungsgebot, und er treibt in seiner Unnachgiebigkeit seine Familie in den Tod. Antigone lehnt sich nicht nur gegen den Herrscher auf, sondern zugleich gegen die Geschlechterordnung, indem sie sich als Frau in die den Männern vorbehaltene Sphäre der Politik einmischt, und sie stellt ihre Pflicht gegenüber dem Toten radikal über die Rücksicht auf die Lebenden. Das wirft ihr ihre schwächere, aber auch versöhnlichere Schwester Ismene vor: „Sehr heiß erglüht dein Busen für Erkaltete“ (V. 88). Die Tragik ergibt sich somit aus dem Übermaß auf beiden Seiten, wobei Kreon als Verursacher dreier Selbstmorde jedoch deutlich negativer dasteht. Antigone gewinnt dagegen den Glanz der mutigen Widerstandskämpferin und der furcht- und selbstlosen Bruderliebe: „Mitlieben, nicht mithassen ist mein Teil“ (V. 523).
Andere literarische Fassungen des Stoffes (z.B. Aischylos, Sieben gegen Theben, 467 v. Chr., Seneca, Phoenissae, 1. Jh. n. Chr., Statius, Thebais, 79–91 n. Chr.) stellen den Bruderkampf ins Zentrum, so dass Antigone als Nebenfigur und auch in verschiedenen Rollen erscheint: als erfolglose Vermittlerin zwischen den Brüdern und als Totenklägerin. Auch ihr Widerstand gegen das Bestattungsverbot wird in Varianten gestaltet. In einer ganz anderen Rolle erscheint Antigone in Sophokles’ Tragödie Ödipus auf Kolonos (postume Erstaufführung 401 v. Chr.). Hier begleitet sie ihren blinden Vater ins Exil.
Seit der Wiederentdeckung der antiken griechischen Tragödien im westlichen Europa im 15. Jh. wird der Stoff von der Königsfamilie in Theben von vielen, vor allem französischen Tragödiendichtern aufgenommen (z.B. Robert Garnier, Antigone ou la piété, Antigone oder die Frömmigkeit, 1580 – der Titel markiert die Christianisierung der Figur –, Jean Rotrou, Antigone, 1637, Vittorio Alfieri, Antigone, 1783) und dient im 18. Jh. vielfach als Opernsujet. Er gilt, wie es der französische Klassiker Jean Racine sagt, als „der tragischste Stoff der Antike“, den Racine selbst allerdings nicht von der Antigone-Figur, sondern wie viele antike und frühneuzeitliche Dichter von deren Brüdern her erfasst (La Thébaïde ou les Frères ennemis, Thebais oder die feindlichen Brüder, 1664, Zitat aus dem Vorwort zur Ausgabe von 1675). Die Fokussierung auf die sophokleische Antigone beginnt im Kontext des deutschen Klassizismus: Friedrich Hölderlins Übersetzung und seine Anmerkungen zur Antigonä (1804) sowie Georg Wilhelm Friedrich Hegels Vorlesungen über die Ästhetik (gehalten 1817–1829, veröffentlichte Nachschriften seit 1835) erheben dieses Werk zum vollkommenen Muster eines tragischen Konflikts, in künstlerischer wie in konzeptioneller Hinsicht. Hegels Deutung, dass Kreon und Antigone exemplarisch die Sphären der Politik und der Familie und damit den Konflikt von Öffentlichem und Privatem-Individuellem verkörpern, findet große Resonanz, gilt aber heute als übertriebener Schematismus. Die Vorstellung, dass Sophokles’ Antigone das Modell für Tragik überhaupt gibt, bleibt jedoch in Kurs. Die Anfangsverse des zweiten Chorliedes: „Vieles ist ungeheuerlich, doch nichts ist ungeheuerlicher als der Mensch“ (V. 332f.), gelten geradezu als Motto für die Idee des Tragischen. Richard Wagner beruft sich auf Sophokles’ Figur („Heilige Antigone! Dich rufe ich an! Laß Deine Fahne wehen, daß wir unter ihr vernichten und erlösen!“) für die Programmatik seines mythischen Musikdramas: Antigone stehe für das ewige Reinmenschliche, das die Kunst gegen alle wechselnden Ansprüche staatlicher Ordnung und Interessen, gegen alle Politik durchsetzen solle (Oper und Drama, 1852, 2. Teil).
Das Prestige von Sophokles’ Tragödie und ihre Präsenz im Schulkanon führen dazu, dass die weiteren Adaptionen des Antigone-Mythos immer zugleich Auseinandersetzungen mit diesem besonderen literarischen Werk sind. Das zentrale Thema, das die Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jh. interessiert, ist der politische Widerstand, der jetzt in den Kontext der beiden Weltkriege rückt. 1916 ruft Romain Rolland mit seiner Kampfschrift À l’Antigone éternelle (An die ewige Antigone) die Frauen auf, ihre Männer vom aktuellen Krieg abzuwenden. Die antike Figur wird zum Ideal eines weiblichen Pazifismus, der sich gegen den männlichen Militarismus mobilisieren soll. Auf derselben Linie folgt 1917 Walter Hasenclevers Antigone-Tragödie, die ihren Zeitbezug dadurch kenntlich macht, dass in Kreon Kaiser Wilhelm II. erkennbar wird. Retrospektiv erzählt Alfred Döblin in seinem Roman November 1918. Eine deutsche Revolution (entstanden 1937–43, publiziert 1948–50) davon, wie die Schullektüre der Antigone die Frage nach Kriegsschuld und möglichem Widerstand aufwirft. Nach dem Zweiten Weltkrieg erörtern Bertolt Brechts Bearbeitung der Antigone des Sophokles und sein Vorwort zum Antigonemodell (1947/48) sowie Rolf Hochhuths Novelle Die Berliner Antigone (1963, Fernsehverfilmung 1968) skeptisch die Möglichkeiten des individuellen Widerstands im totalitären nationalsozialistischen Regime. In Grete Weils Roman Meine Schwester Antigone (1980) reflektiert die jüdische Ich-Erzählerin anhand der Sophokles-Lektüre ihr Verhalten im nationalsozialistisch besetzten Amsterdam und vergleicht ihre Überlebensstrategie neben der antiken auch mit modernen Widerstandskämpferinnen wie Sophie Scholl und Gudrun Ensslin. Die bekannteste Sophokles-Adaption des 20. Jh., Jean Anouilhs Antigone (Uraufführung 1944), zielt indes nicht auf den politischen, sondern auf den totalen, nihilistischen Widerstand. Im Kontext des französischen Existentialismus verkörpert diese Antigone den existenziellen Ekel an der Absurdität des Daseins: „Ihr ekelt mich an mit eurem Glück; mit eurem Leben, das man lieben soll um jeden Preis.“ Das politische Engagement in den Antigone-Adaptionen setzt sich allerdings auch über Europa und die beiden Weltkriege hinaus fort: Das Stück The Island (1973) von Athol Fugard handelt von einer Antigone-Aufführung in einem südafrikanischen Gefängnis und nutzt die antike Widerstandsfigur zur Diskussion der Apartheitspolitik.
Im Kontext der Gender-Studies wird Sophokles’ Antigone für die amerikanische Philosophin Judith Butler als Transgression etablierter Geschlechterrollen interessant (Antigone’s Claim – Kinship between Life and Death, 2000).
LITERATUR
Simone Fraisse: Le mythe d’Antigone. Paris 1974
Christiane Zimmermann: Der Antigone-Mythos in der antiken Literatur und Kunst. Tübingen 1993
Lutz Walther, Martina Hayo: Mythos Antigone. Leipzig 2004 SM