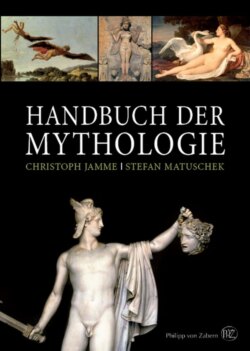Читать книгу Handbuch der Mythologie - Kai Brodersen - Страница 19
Theogonie
ОглавлениеDie Theogonie, wörtlich ‚die Abstammung der Götter‘, ist ein Lehrgedicht des Hesiod aus der Wende vom 8. zum 7. Jh. v. Chr. Hesiod ist der erste namentlich bekannte Dichter in der Weltliteratur. Für die homerischen Epen (die Ilias aus der ersten Hälfte, die Odyssee vom Anfang des 7. Jh. v. Chr.) kann kein individueller Autor identifiziert werden. Der Name Homer bezeichnet keine historisch verifizierbare Person, er wird den beiden Epen als gemeinsamer Autor und damit als der ‚erste Dichter‘ zugeschrieben. Zusammen mit den homerischen Epen gibt Hesiods Theogonie das älteste Zeugnis der antiken griechischen Mythologie. Nimmt man eine Dichterperson Homer an, dann haben, wie der Geschichtsschreiber Herodot in der Mitte des 5. Jh. v. Chr. urteilt, „Hesiod und Homer den Stammbaum der Götter aufgestellt, haben ihnen ihre Beinamen gegeben, die Ämter und Tätigkeiten unter sie verteilt und ihre Gestalten beschrieben“ (Historien, 2,53). Das heißt nicht, dass diese drei Werke die ganze Mythologie erfunden hätten. Denn sie fußen ihrerseits auf älteren Glaubensvorstellungen, Kulten, Götter- und Heldenerzählungen. Doch sind es diese drei Texte, die der griechischen Götter- und Heldenwelt ihre charakteristische Prägung gegeben haben, die bis in die neuzeitliche und gegenwärtige Vorstellung von ihr maßgeblich ist. Die Art, wie sie die Mythologie präsentieren, ist dabei wesentlich verschieden: Die homerischen Epen erzählen sie als Geschichten von Kampf und Abenteuer, Hesiod gibt sie als Ordnung. Zwar hat auch die Theogonie eine narrative und sogar kämpferische Dynamik, indem sie die gewaltsame Abfolge von drei Göttergenerationen (▸ Uranos, Kronos und ▸ Zeus) erzählt. Doch geht es ihr darum, die Herrschaft des Zeus als definitive Ordnung darzustellen. Der Kampf bedeutet hier, gemäß dem Titel, die Entstehung der göttlichen Ordnung. Er ist anders als bei Homer nicht spannend geschildert und ausgemalt. Dieses statische Moment zeigt sich schon darin, dass der Text mit dem Anruf und der Lobpreisung der Musen als Töchtern des Zeus beginnt. Dessen Sieg und Herrschaft sind also schon vorausgesetzt, bevor sie erzählt werden. Der Text zeigt die Entstehung und den Aufbau der von Zeus beherrschten Welt.
Mit seiner Intention auf eine Gesamtordnung der Götterwelt kann man Hesiod als den ersten Mythologen bezeichnen. Er erzählt nicht einfach mythische Geschichten, sondern integriert deren Ereignisse und Akteure zu einem insgesamt schlüssigen Aufbau. Damit erzeugt Hesiod die Vorstellung, in den Mythen überhaupt ein geordnetes Ganzes zu sehen. Mythologie wird hier im wörtlichen Sinne zu einer Lehre von den Göttern. Im Blick auf die vielfältige und heterogene Überlieferungslage, im Blick auf die vielen regionalen Differenzen und erst recht im Blick auf die nach Hesiod beginnenden künstlerischen Adaptionen und Varianten kann man die Mythologie freilich nicht als ein schlüssig geordnetes Ganzes ansprechen. Seit Hesiod aber ist die Erwartung da, es doch tun zu können, und sie wird immer wieder erneuert.
Hesiods Strukturprinzip ist die Genealogie. Seine Götterwelt entsteht durch Zeugung und Generationenfolge. Durch die Tatsache, dass die Götternamen zugleich Teile und Phänomene der physischen Welt (Erde, Himmel, Meer, einzelne Flüsse, Winde, Tag, Nacht u.a.) sowie psychische, ethische und rechtliche Abstrakta (Liebe, Freude, Klugheit, Frieden, Gerechtigkeit u.a.) bedeuten, wird die Götter- zu einer Seinsordnung im umfassendsten Sinne. Die Paarungs- und Abstammungsverhältnisse sind so als naturkundliche und ethische Aussagen zu verstehen: In der Zuordnung zu Göttern oder zu Titanen als ihren Vätern unterscheidet Hesiod z.B. die für den Menschen nützlichen von den ungünstigen, schädlichen Winden (Verse 869–875). In der Abfolge der ersten Zeus-Gattinnen steckt ein begrifflicher Aufriss, wie die starke zur guten Herrschaft wird: indem sich der Mächtige zunächst mit der Göttin Mentis (der Klugheit) verbindet, sich diese dann dauerhaft einverleibt (Zeus birgt Mentis in seinem Leib) und sich nachfolgend mit Themis (der Satzung), Eunomia (den guten Gesetzen) und Dike (dem Recht) paart, was schließlich zur ‚blühenden Eirene‘ (dem Frieden) führt (Verse 886–902). Indem Göttername und Begriff zusammenfallen, werden die Verwandtschaften, Verbindungen und Feindschaften der Götter zu naturkundlichen und philosophischen Theoremen. Hesiods Theogonie macht damit einen ersten Schritt hin zur Philosophie. Die vorsokratischen Philosophen knüpfen vielfach daran an. Allerdings kommt aus diesem Kreis auch die Kritik an den anthropomorphen Gottesvorstellungen bei Homer und Hesiod, die, wie es Xenophanes formuliert, „den Göttern alles zugeschrieben haben, was bei den Menschen schändlich ist und getadelt wird: zu stehlen, die Ehe zu brechen und sich gegenseitig zu betrügen“ (Kirk/Raven/Schofield, Die vorsokratischen Philosophen, Frgm. 166).
Nach dem Musenanruf beginnt die Theogonie als Schöpfungsmythos: Am Anfang steht die Göttin Gaia, die Erde, die das Chaos beendet, indem sie den Himmel, die Berge und das Meer als erste Gliederung der Welt hervorbringt. Zusammen mit ihr entstehen die Finsternis, die Himmelshelle (Äther) und der Tag (Verse 116–131). In all diesen Motiven zeigt sich eine Parallele zum Beginn des biblischen Schöpfungsmythos (Genesis 1,1–10). Bei Hesiod jedoch kommt von Anfang an der Gott Eros, die Liebe als Triebkraft hinzu. Durch sie entsteht alles Weitere als Paarung und Zeugung der Göttinnen und Götter, deren Geschlecht deshalb jeweils wichtig und eindeutig festgelegt ist. Das erste dieser Paare, die in liebender Umarmung zeugen, sind Gaia und Uranos, Erde und Himmel: ein erotisches Motiv, dessen späten Nachhall man noch in Eichendorffs Gedicht Mondnacht (1837) hören kann („Es war, als hätt’ der Himmel/Die Erde still geküßt“). Die sich an Gaia und Uranos anschließende Generationsfolge ist eine Geschichte von Vatermord und Vatersturz, in der jedoch die Mütter die entscheidende Rolle spielen. Sie sind es, die ihren Söhnen zum Sieg über den Vater verhelfen. Das hängt mit der Weissagung zusammen, dass die Väter von ihren Söhnen gestürzt werden (eine Dramatisierung der Generationsfolge), der sich die Väter dadurch zu entziehen versuchen, dass sie ihre Kinder verschlingen. Aus Rache dafür stehen die Mütter ihren Söhnen bei. Gaia schmiedet für Kronos die Sichel, mit der er seinem Vater Uranos das Geschlechtsteil abmäht (es fällt daraufhin ins Meer und aus dem Schaum, den es dort verursacht, wird ▸ Aphrodite geboren, Verse 161–195). Zuvor benetzt es noch den Schoß der Gaia, woraus die Erinnyen, die Rachegöttinnen entstehen: ein mythischer Hinweis darauf, dass auf die Tat die Vergeltung folgt. Kronos wird seinerseits von seiner Gattin Rheia überlistet, die den gemeinsamen Sohn Zeus vor ihm verbirgt und ihn stattdessen einen Stein verschlingen lässt (Verse 470–491). Der so gerettete Zeus stürzt seinen Vater vom Thron. Zeus entgeht seinem eigenen Sturz dadurch, dass er nicht seine Kinder, sondern seine erste Frau, Mentis, verschlingt; was zugleich eine Allegorie seiner Klugheit ist. Sie steht im Kontrast zur bloßen Gewalt des Kronos.
Die endgültige Herrschaft des Zeus lässt Hesiod schließlich aus drei Herausforderungen an ihn hervorgehen: durch ▸ Prometheus (Vers 535–616), die Titanen (617–728) und Thyphoeus (820–885). Prometheus’ Provokation ist doppelt, indem er Zeus zum einen mit einer Opfergabe zu betrügen versucht, zum anderen das Feuer stiehlt, um es gegen Zeus’ Willen den Menschen zu übergeben. Zeus durchschaut den Betrug und rächt sich an Prometheus, indem er ihn an einen Felsen binden und durch einen Adler quälen lässt, der ihm täglich die nachwachsende Leber wegfrisst. Die Menschen bestraft Zeus durch die Erschaffung der Frau: als „das schöne Übel zum Ausgleich des Feuer-Vorteils“ (Vers 585). Um die Nutzlosigkeit der Frauen darzustellen, vergleicht Hesiod sie mit den Drohnen in einem Bienenstock (595–601). Damit bezeugt Hesiod zum einen die unter antiken Autoren weit verbreitete Misogynie; zum anderen, dass ihm die biologischen Geschlechterverhältnisse im Bienenstock noch unbekannt waren. Der Kampf gegen die Titanen als zweite Herausforderung führt zu der polar-symmetrischen Weltordnung, in der die siegreichen olympischen Götter unter der Führung des Zeus den in den unterirdischen Tartaros verbannten Titanen gegenüberstehen. Der Fries des Pergamonaltars (2. Jh. v. Chr.) stellt diesen Kampf dar; der deutsche Schriftsteller Peter Weiss hat ihn als archetypische Darstellung des gesellschaftlichen Klassenkampfs gedeutet (Ästhetik des Widerstands, 3 Bde., 1975, 1978, 1981). Die dritte Herausforderung besteht schließlich in Typhoeus, einem letzten Sohn der Gaia, den sie nach der Niederlage der Titanen als Gegen-Gott gegen Zeus gebiert. Nach diesem Sieg ist Zeus der unangefochtene Herrscher.
Pergamonaltar, Ostfries (Ausschnitt), 2. Jh. v. Chr., Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung
All diese Kämpfe werden im Text eher genannt als beschrieben. Ästhetisch dominant sind dagegen lange Abstammungskataloge, die mit ihren Namen die physische und moralische Welt ausmachen. Darin dokumentieren sich (wie nach dem genannten Beispiel der Zeus-Gattinnen) ethische Überzeugungen und auch (etwa im Katalog der von Hesiod genannten Flussnamen, 337–345) das naturkundlich-geographische Wissen der Zeit.
LITERATUR
Hesiod: Theogonie. Griechisch/Deutsch. Übersetzt und hg. von Otto Schönberger. Stuttgart 1999
Robert Lamberton: Hesiod. New Haven u.a. 1988
Richard Hamilton: The Architecture of Hesiodic poetry. Baltimore 1989
Jenny Strauss Clay: Hesiod’s Cosmos. New York 2003 SM