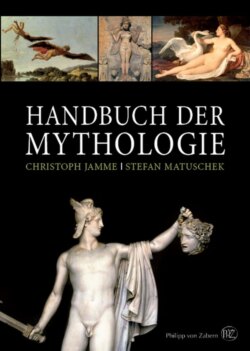Читать книгу Handbuch der Mythologie - Kai Brodersen - Страница 13
Mythos und Ethnologie
ОглавлениеEthnologische Mythenforschung ist ein mindestens in der aktuellen Ethnologie vernachlässigtes Feld; eine Ausnahme bildet der 1992 erschienene Band Mythen im Kontext. Seit Anbeginn der Ethnologie gibt es aber eine intensive Diskussion um die Frage, wieweit der wissenschaftliche Wirklichkeitsbegriff tauglich sei zu einem angemessenen Verständnis der magischen und religiösen Vorstellungen traditionaler Gesellschaften. Früher dachten alle Ethnologen, dass ihre Unterscheidungen von ‚rational‘ und ‚mythisch‘ auch von den primitiven Völkern selbst gemacht würden. Zum Beispiel besteht Bronislaw Malinowski – trotz des Aufweises einer permanenten Interferenz von Arbeit und Magie bei den Eingeborenen des Trobriand-Archipels – darauf, dass seine Unterscheidung von „mythischem und rationalem Verhalten“ auch von den Eingeborenen gemacht wird. Zur Begründung führt er an, dass Eingeborene Arbeit nicht durch Magie ersetzen. Das aber – so der Einwand Hans G. Kippenbergs – heißt nur, „dass der Eingeborene ein weniger mechanistisches Verständnis von Magie hat als Malinowski“. Die von Malinowski getroffene Unterscheidung zwischen instrumentellem und magischem Handeln setzt Max Webers soziologischen Begriff der Zweckrationalität voraus, der sich aber in der okzidentalen Gesellschaft erst historisch entwickelt hat. Die Unterscheidung zwischen gesellschaftlicher Wirklichkeit und religiösem Schein folgt dem Modell bürgerlicher Religionssoziologie. Die außereuropäischen Völker treffen diese Unterscheidung aber gar nicht. Die Dichotomie von ‚sakral‘ und ‚profan‘, so die These von Jack Goody 1961, werde keineswegs von den Handelnden selbst gemacht, sondern sei eine Kategorie des wissenschaftlichen Beobachters. Immer wieder geht es um die Frage, wie sowohl das mythische Bewusstsein als auch die Lebenswelt (vermeintlich) ‚exotischer‘ Gesellschaften zu einem Gegenstand der wissenschaftlichen Reflexion zu machen ist. Gerade die Glaubensvorstellungen fremder Ethnien zu verstehen bzw. in ihrem gesamtkulturellen Kontext zu erfassen erweist sich als besonders schwierig, ist ja Kultur – ein Symbolsystem (mittels Bildern, Wörtern und Ritualen) zur Ordnung der erfahrenen Wirklichkeit – direkter Beobachtung nicht zugänglich; was beobachtbar ist, sind Handlungen oder Verhaltensweisen von Individuen oder Gruppen. Nicht zufällig ist die Auseinandersetzung über das Verstehen fremden Denkens intensiv durch ein ethnologisches Paradigma angestoßen worden, nämlich durch die Monographie des Malinowski-Schülers Edward E. Evans-Pritchard über Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (1937), das als methodisches Paradigma für das Verstehen und Erklären fremder Denkformen auch intendiert war. Am Ende dieser Diskussion stand die Auflösung der Antithese zwischen Mythos und Logos beziehungsweise Mythos und Rationalität. Bahnbrechend für die Einsicht, dass der Mythos eine rationale Leistung darstellt, wurden die Arbeiten von Claude Lévi-Strauss. Es gibt, so seine These, eine Vielzahl (unbewusst wirkender) geistiger Operationen, die über kulturelle und zeitliche Abstände hinweg allen Menschen gemeinsam sind. Diese universelle Tätigkeit des menschlichen Geistes erzeugt die symbolische Ordnung der menschlichen Gesellschaft. Bei allen kulturellen Unterschieden zwischen den verschiedenen Teilen der Menschheit ist der menschliche Geist überall mit den gleichen Fähigkeiten ausgestattet. Heute weiß die Ethnologie, dass Menschen in primitiven Gesellschaften genauso rational denken wie in modernen, nur die Art der Rationalität ist eine andere. Mythen nehmen stets die Erzählform an; seine „doppelte Struktur, historisch und ahistorisch zugleich“ (Lévi-Strauss), ist die charakteristischste Eigenschaft des Mythos. Mythische Geschichten in allen, noch so verschiedenen Erzählkulturen operieren mit einer vergleichsweise kleinen Anzahl immer gleicher Elemente, die unendlich variiert werden. Mit einer genialen Metapher nennt daher Lévi-Strauss den mythischen Erzähler den „mythischen Bastler“: „Der Bastler ist in der Lage, eine große Anzahl verschiedenartigster Arbeiten auszuführen; doch im Unterschied zum Ingenieur macht er seine Arbeit nicht davon abhängig, ob ihm Rohstoffe oder Werkzeuge erreichbar sind, die je nach Projekt geplant oder beschafft werden müssten; die Welt seiner Mittel ist begrenzt, und die Regel seines Spiels besteht immer darin, jederzeit mit dem, was ihm zur Hand ist, auszukommen.“ Die Mythen sind überall nach einem Grundmuster aufgebaut, das im Detail sehr komplex ist, sich aber in vier Hauptthemen auflösen lässt. Diese Themen zerfallen wiederum in zwei Gegensatzpaare, nämlich einmal in den Gegensatz zwischen einer vollkommenen Schöpfung und einer unvollkommenen gegenwärtigen Welt und zum anderen in den Gegensatz zwischen Erfolg und Misserfolg. In Mythen bzw. Mythengruppen wird „ein Thema, sein Gegenteil und ihre Umkehrungen ein[ge]-schlossen“ (Lévi-Strauss). Es entstehen „Strukturen mit vier Termini, die untereinander verschränkt sind und untereinander eine Homologiebeziehung bewahren“ (Lévi-Strauss). Bei einigen ethnischen Gruppen fehlen Elemente des vielfachen Komplexes, obwohl man bei benachbarten Stämmen mit ähnlicher Kulturtradition diese Elemente kennt. Nicht jeder Stamm besaß eine spezifische Schöpfungsgeschichte, selbst wenn ein reicher Erzählungsschatz über den Ursprung des Sterbens und andere Züge einer verdorbenen Welt vorhanden war. Da ferner die Hauptthemen unterschiedliche Sonderthemen enthalten, hatten benachbarte Stämme zuweilen nicht das gleiche Sonderthema gemeinsam, sondern die eine Gruppe hatte dieses, die nächste ein anderes. Bei einigen ethnischen Gruppen findet man unterschiedliche, ja sogar offensichtlich gegensätzliche Versionen desselben Themas, was weitere Komplikationen mit sich bringt. Derart widersprüchliche Variationen finden sich jedoch noch im Einklang mit dem generellen vierfachen Schema. Eine Eigenheit von Mythen, die manche verwirrend finden, ist die Tatsache, dass die mythologischen Elemente unterschiedlich kombiniert werden können. Dies führt dazu, dass spezifische Themen ineinander übergehen und es unmöglich ist, ganze Geschichten systematisch zu klassifizieren, weil sie sich mit Geschichten anderer Kategorien überschneiden, wie auch immer diese bestimmt sein mögen. Gerade diese Möglichkeiten, das Thema zu variieren, führen dazu, dass Angehörige derselben ethnischen Gruppe unterschiedliche Versionen einer Geschichte erzählen, die in der Betonung von Details variieren oder sogar einander widersprechen. So entstammen zum Beispiel die heimischen nordamerikanischen Mythen einem Gebiet, in dem nicht weniger als 236 bekannte ethnische Gruppierungen leben. Im Allgemeinen besitzt – oder besser besaß – jede ethnische Gruppe ihre charakteristische Mythologie und Religion, die eng verwoben war mit den regionalen topographischen Verhältnissen und auch die örtliche Fauna und Flora widerspiegelte.
Claude Lévi-Strauss (1908–2009)
Manche schriftlose Völker unterscheiden selbst zwischen verschiedenen Gattungen der mündlichen Überlieferung, wobei die Grenzen fließend sind. So kennen die Trobriand-Insulaner in Melanesien kukwebanu (Märchen, zur Unterhaltung erzählt, fiktive Ereignisse), wosi (Gesänge), vina-vina (Liedchen beim Spiel), megwa oder yopa (magische Formeln) und schließlich libogwo, was wörtlich „alte Reden“ heißt und sowohl geschichtliche Erzählungen (über Taten früherer Häuptlinge etc.) wie Mythen über die übernatürlichen Geschehnisse der Vorzeit umfasst. Die Mythen werden als lili’u von den übrigen libogwo unterschieden, gehören andererseits aber als Berichte über wirkliche Geschehnisse zu ihnen. Beide, geschichtliche Überlieferungen wie Mythen, gelten uneingeschränkt als wahr und werden von Fabeln und anderen erdichteten Erzählungen unterschieden. Eine Grenze zwischen wahr und falsch, heiligen und profanen Berichten lässt sich nicht ziehen; die Unterscheidung zwischen verschiedenen zeitlichen Ebenen ist vielmehr primär, die nämlich zwischen der Urzeit und der jetzt gültigen Weltordnung.
Baal-Statue aus Syrien, späte Bronzezeit (um 1300 v. Chr.)
Ein weiteres wichtiges Ergebnis der ethnologischen Forschung des 20. Jh. (in Neuguinea, Nord- und Südamerika sowie Afrika) ist die Erkenntnis, dass der Mythos ein notwendiger Bestandteil des Kultus bzw. Ritus ist: Mythen treten immer im Zusammenhang mit Ritualen auf, als kognitiver Teil zu einem praktischen Vollzug, Mythen sind immer mündlicher Kommentar einer Kulthaltung. Darauf beruht ihre magische Wirkung: Ein Geschehnis der Urzeit wird durch die Erzählung wieder lebendig gemacht. Auch die grundlegende Zeitstruktur der Mythen, die Wiederholung, wird von hier aus verständlich. Nach der Auffassung der Naturvölker gewährleistet eine mythische Erklärung für die Entstehung eines Dinges dessen Existenz. Berühmt wurde Adolf Ellegard Jensens Deutung des Mythos von Hainuwele von der Insel Ceram. Der Mythos, so zeigte sich hier, ist die Gestaltung eines wichtigen Teils des Kulturlebens. Erst eine Parallele in einem eindrucksvollen Ritus bildet die Grundlage des Initiationsverfahrens, gibt Aufschluss über das Problem des Todes und der Zeugung und erklärt, wie die Nahrungspflanzen entstanden sind. Mythen dienen somit auch der Vermittlung von Natur und Kultur.
Beispiele für die enge Verzahnung von Mythos und Ritus gibt es zuhauf. So pflegte man in Syrien Darstellungen der Triumphe des Fruchtbarkeitsgottes Baal über seine Feinde rituell zu rezitieren und auch darzustellen, um einen ähnlichen Sieg der Fruchtbarkeit über die Trockenheit auf Erden zu erwirken. Mythen werden in Verbindung mit Riten gebraucht, um Kraftquellen zu erschließen und zu sonst nicht erreichbaren Erfahrungen zu gelangen. Die Akteure des Ritus werden aus unserer Welt herausgehoben und werden eins mit den Gestalten des Mythos, mit den Göttern und den Ahnen. Dramatische Beispiele hierfür gibt es bei den Voodoo-Zeremonien und den Riten der australischen Ureinwohner.
In allen naturvölkischen Ethnien, so lehrt uns die Ethnologie, vereinigt der Mythos verschiedene Grundfunktionen: ‚kultisch-religiös‘ vermittelt er heilige Wahrheiten und entscheidet über Schuld oder Unschuld; ‚historisch-sozial‘ erzählt er die Geschichte einer Institution, eines Ritus oder einer gesellschaftlichen Entwicklung, d.h. Geschichten berichten eingehend über den Ursprung detaillierter Formen des sozialen Lebens; ‚politisch‘ sind Mythen der Ausdruck eines primären kollektiven Narzissmus und dienen der Autorepräsentation, dem sozialen Identitätsbewusstsein. Dabei bleibt ein grundsätzliches methodisches Problem ungelöst: Lässt sich das Präreflexive reflektieren? Sind Mythen notwendig gebunden an ein magisches Weltverständnis, nach dessen Zerfall wir die Mythen höchstens noch ihren verbalen Inhalten nach kennen? Mit der Kenntnis des Mythos steht also immer auch das Problem des Verhältnisses von Mythos versus Erkenntnis zur Diskussion. Während der gelebte Mythos eine Deutung weder benötigt noch erlaubte, muss eine wissenschaftliche Behandlung die Entstehungsbedingungen für bestimmte Rationalitäten aufweisen. Dabei dürfen wir den Mythos weder zum „Prä-logischen“ (Lévy-Bruhl), zum Ausdruck einer durch Wissenschaft längst überholten Kindheitsstufe der Menschheit abstempeln noch ihn vorschnell in uns vertrautes wissenschaftliches Denken transformieren (Lévi-Strauss). Im ersten Fall bleibt die Frage der Bedeutung der Mythen für die Gegenwart unbeantwortet (der rätselhafte Mythos ist ja nicht irgendwo begraben in der versunkenen Prähistorie, sondern gehört unaufhebbar zu unserer Erfahrung), im zweiten Fall wird die Fremdheit des paganen Denkens eliminiert. In beiden Weisen des Umgangs mit dem Mythos wirken Denkschemata der Aufklärung nach, die es zu korrigieren gilt: Mythos ist nichts, was mit dem Einbruch des theoretischen Denkens überwunden ist.
CJ
LITERATUR
P. Ehrenreich: Die allgemeine Mythologie und ihre ethnologischen Grundlagen. Leipzig 1910
B. Malinowski: Argonauts of the Western Pacific. Dutton/New York 1922
A. E. Jensen: Mythos und Kult bei den Naturvölkern. Wiesbaden 21950
E. Leach: Mythos und Totemismus. Frankfurt a. M. 1973
C. Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie. Frankfurt a. M. 1977
C. Lévi-Strauss: Das wilde Denken. Frankfurt a. M. 1979
C. Lévi-Strauss : Mythologica, 5 Bde. Frankfurt a. M. 21980
H. G. Kippenberg, B. Luchesi (Hg.): Magie. Frankfurt a. M. 1987
K. H. Kohl (Hg.): Mythen im Kontext. Frankfurt a. M./New York 1992