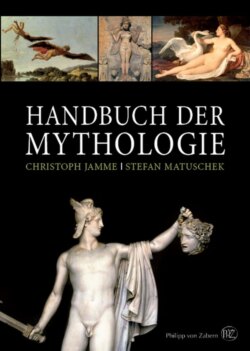Читать книгу Handbuch der Mythologie - Kai Brodersen - Страница 20
Achilleus/Achilles
ОглавлениеAchilleus (lat. Achilles) ist der Sohn der Meernymphe Thetis und des ▸ Argonauten Peleus. Als größter Kriegsheld der Griechen steht er für den Ruhm, in kontroverser Deutungsgeschichte aber auch für die Unmoral des männlichen Kampftriebs. Ein doppeltes Orakel erhebt ihn potenziell über ▸ Zeus und weissagt zugleich seinen Tod im Kampf. Es prophezeit, dass der Sohn der Thetis stärker werde als sein Vater, woraufin Zeus – kurz bevor er der Erzeuger dieses Sohnes wird – sein Interesse an Thetis aufgibt und sie dem sterblichen Mann überlässt. Den anderen Schicksalsspruch versucht Thetis mehrfach – vergeblich – zu verhindern: Sie bestreicht den Neugeborenen mit der unsterblich machenden Speise Ambrosia und legt ihn ins Feuer, das seine sterblichen Anteile verbrennen und ihn so unsterblich machen soll. Peleus, der ihn so findet und den Hintergrund nicht kennt, zieht ihn aus dem Feuer und vereitelt dadurch unbewusst den Plan. Um ihren Sohn vor dem ▸ Trojanischen Krieg zu bewahren, versteckt Thetis ihn als Mädchen verkleidet unter den Töchtern des Königs Lykomedes auf der Insel Skyros. Doch wird sie durch ▸ Odysseus überlistet, der unter die Gastgeschenke für die Mädchen Waffen mischt, die sofort das Interesse des verkleideten Achill wecken, so dass er sich enttarnt und in den Krieg ziehen muss. In ihm wird er zum Haupthelden der Griechen. So zeigt ihn die homerische Ilias, deren Erzählung vom Kampf um Troja Achill als zentrale Figur wählt. Gleich im ersten Vers wird er fokussiert („Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus“), und vor allem die Gesänge XVIII – XXII handeln von seinen leidenschaftlichen, rasenden Kriegstaten. Das Epos beginnt mit der für die Griechen bedrohlichen Situation, dass ihr stärkster Kämpfer Achill sich dem Krieg verweigert. Der Grund dafür ist sein Zorn auf den griechischen Heerführer Agamemnon, der ihm die Königstochter Briseïs als Kriegsbeute abgenommen hat, um sie für sich selbst zu beanspruchen. Erst als sein Freund Patroklos durch Hektor, den Haupthelden der Trojaner und damit Achills Widerpart, getötet wird, greift Achill wieder in den Kampf ein, wütet unter den Trojanern und tötet nach vielen anderen schließlich auch Hektor. Im anhaltenden Rache-Furor schändet er dessen Leichnam, indem er ihn an seinen Wagen gebunden über die Erde schleift, bis er ihn sich schließlich von Hektors Vater, dem Trojanerkönig Priamos, abkaufen lässt. Achills Tod wird in der Ilias nicht geschildert, jedoch prophezeit. Die homerische Odyssee setzt ihn voraus und zeigt den verewigten Achill als ehrwürdigen Bewohner der Unterwelt (▸ Unterweltmythen), der um seinen Nachruhm als Kriegsheld von dem schmachvoll, im heimischen Bad durch Gattenmord gestorbenen Agamemnon beneidet wird: „und ewig/Glänzet bei allen Menschen dein großer Name, Achilleus“ (XXIV, 15–97, hier 93f.). Der Neid, den der tote Achill auf die Lebenden empfindet, verfliegt, als er von dem Unterweltwanderer Odysseus die Heldentaten seines Sohnes Neoptolemos erfährt (XI, 467–540). Das Ehrengedenken des Kriegshelden findet sich auch in den Oden des griechischen Lyrikers Pindar (etwa 520–446 v. Chr.). Als edelmütig Liebender und nicht als grausamer Krieger erscheint Achill dagegen im Zusammenhang des ▸ Iphigenie-Mythos.
Die römischen Autoren, deren nationaler Gründungsmythos an Troja anschließt, bewerten die Figur anders. Cicero (Tusculanae disputationes, Gespräche in Tusculum, 45 v. Chr., 3,18) führt sie als abschreckendes Beispiel für krankhaft unbeherrschte Leidenschaft an. Ovids ▸ Metamorphosen (1 v. – 10 n. Chr., XII, 64–579) enthalten als eine eigene, detailgenau grausam erzählte Episode des Trojanischen Kriegs die Schilderung, wie Achill den unverwundbaren Cygnus erdrosselt. Gleich darauf erscheint er als Gastgeber eines großen Gelages, auf dem sich die Griechen ihrer Heldentaten rühmen. Den bei Homer ausgesparten Tod schildert Ovid so, dass Achill durch einen von ▸ Apollon ins Ziel gelenkten Pfeil stirbt (XII, 597–606). In einem milderen Licht zeigt ihn das Achilleis-Epos des römischen Dichters Statius (Ende des 1. Jh. n. Chr.). Es ist unvollendet geblieben und beschränkt sich auf die Jugend des Helden vor dem Eintritt in den Krieg. Neben seinem Versteck und der Enttarnung auf Skyros werden seine Lehrjahre bei dem Kentauren Chiron erzählt, der ihn in der Wildnis zu einem perfekten Junghelden bildet, sowie seine Liebe zu Deidamia, einer Tochter des Königs Lykomedes, die er schließlich heiratet und schwanger zurücklässt, als er nach Troja aufbricht. Bei Statius findet sich zum ersten Mal das Motiv, dem sich die sprichwörtliche Rede von der Achillesferse verdankt: Um die Todesprophezeiung zu vereiteln, taucht Thetis ihren Sohn in den Unterweltfluss Styx, wodurch er unverwundbar wird. Einzig die Stelle an der Ferse, an der sie ihn dabei festhält, bleibt unbenetzt und dadurch verwundbar.
Die mittelalterlichen Erzählungen des Troja-Stoffes (Benoît de Sainte-More, Roman de Troie, um 1165, Herbort von Fritzlar, Liet von Troye, um 1200, Guido delle Collonne, Historia destructionis Troiae, Geschichte der Zerstörung Troyas, 1287) setzen, aus lateinischen Quellen schöpfend, in trojafreundlicher Perspektive Hektor als Tugendhelden über Achill. Der Grieche wird dagegen zu einer ambivalenten Figur im Konflikt zwischen ritterlichem Kampf, Unmoral und unheilvoller Liebe zu der trojanischen Königstocher Polyxena, wodurch er riskiert, die Sache der Griechen zu verraten. Als ambivalente Figur stirbt er keinen Heldentod, sondern wird bei einem Treffen mit Polyxena von Paris aus dem Hinterhalt ermordet. Bei Benoît und Guido erscheint dies als gerechte Strafe, da Achill seinerseits Hektor nur durch einen Hinterhalt besiegen konnte. Eine spätere Fassung des im Mittelalter beliebten Troja-Stoffs, Konrad von Würzburgs Trojanerkrieg (1281–87), baut die Spannung aus Liebe und Rittertum anhand des Achill-Deidamia-Paars auf.
Die römischen und die mittelalterlichen Deutungen des Achill bleiben bis ins 18. Jh. hinein dominant, was daran liegt, dass im mittelalterlichen Westeuropa zwar Ovid und Statius, nicht aber die homerischen Epen bekannt waren. Ihre Wiederentdeckung seit der Renaissance schlägt nicht sofort durch, so dass sie die lateinischen Quellen als kanonische Fassung des Troja-Stoffes erst zum Ende des 18. Jh. ablösen. Große Beliebtheit gewinnt der nicht griechisch heldenhafe, sondern ambivalente, ins Rittermilieu versetzte Achill auf den Opernbühnen des 17. und 18. Jh., wobei neben der riskanten Liebe zu Polyxena (z.B. Jean-Baptiste Lully, Achille et Polyxène, 1687) vor allem die geschlechtliche Ambivalenz des als Mädchen verkleideten Achill das Interesse weckt. Sie kommt der zeitgenössischen Konjunktur der Kastraten auf den Opernbühnen entgegen und bietet die passende Rolle (z.B. Domenico Scarlatti, Tetide in Sciro, 1712). Das Libretto Achille in Sciro (1736) von Pietro Metastasio bringt es auf über 20 Opernbearbeitungen. An den mittelalterlichen Deutungen ist auch William Shakespeares Achill in seiner History of Troilus and Cressida (1601–03) orientiert, allerdings erscheint die Figur hier noch eindeutiger negativ als selbstgerechter Lüstling und hinterhältiger Hektor-Mörder.
Die Umwertung beginnt mit der Homer-Verehrung im deutschen Klassizismus zum Ende des 18. Jh. Johann Gottfried Herder verteidigt den Achill, wie ihn die Ilias darstellt, gegen die traditionelle moralische Verurteilung und erklärt ihn zum Muster der homerischen Humanität, die das wahrhaft Menschliche in allen ihren Möglichkeiten und Bedingungen zeige (Briefe zur Beförderung der Humanität, 1793–97, 34. Brief: „Über die Humanität Homers in seiner Iliade“). In der Idealisierung der griechischen und eben nicht der römischen Antike wird Achill zum strahlenden Helden einer glückseligen Zeit verklärt: Friedrich Hölderlins Gedicht Achill (1798) feiert den „herrlichen Göttersohn“, der sich an die helfende Mutter Thetis wenden konnte, als Gegenbild zur modernen Verlassenheit und Entfremdung. Johann Wolfgang Goethes Fragment gebliebenes Achilleïs-Epos (1808 publiziert) arbeitet den Merkmalen des Wüterichs und Leichenschänders entgegen und zeigt Achill nach seinem Sieg über Hektor ruhig und besonnen, wie er im Bewusstsein seines fortdauernden Nachruhms den eigenen Tod erwartet. Einen zeitgenössischen Kontrapunkt zu dieser Veredelung und Verklärung des griechischen Helden setzt Heinrich von Kleists Penthesilea-Drama (1808), das die beiden traditionell als Gegensatz gesehenen Rollen des Achill – den Krieger und den Liebenden – überblendet und ihn im Liebeskampf mit der kriegerischen Amazone nicht zum Sieger, sondern zum verwirrten, am Ende von der Frau zerfleischten Opfer macht. Kleist verändert so den antiken Mythos, der umgekehrt die in den Trojanischen Krieg eingreifende Amazonenkönigin Penthesilea durch Achill töten lässt. Im Übrigen aber setzt sich in der Dichtung über das 19. Jh. die klassizistische Verklärung der Achilles-Figur fort (z.B. Ludwig Uhland, Achill, 1812, Conrad Ferdinand Meyer, Der tote Achill, 1892), auch wenn sie vereinzelt (Heinrich Heine, Epilog zu den Gedichten 1853/54) ironisiert wird.
In einer an Kleist erinnernden Überblendung von Liebeslust und Kampf erscheint die Figur am Ende des 20. Jh. in Christa Wolfs Erzählung Kassandra (1983), diesmal aber nicht als Opfer, sondern als Täter. Aus weiblicher Perspektive gesehen, verkörpert „Achill das Vieh“, wie er hier immer wieder apostrophiert wird, „die nackte gräßliche männliche Lust“, in der „Mörderlust“ und „Liebeslust“ zusammenfallen. Und auch andere Beispiele belegen die entschiedene Abkehr von der klassizistischen Verklärung und Veredelung des griechischen Helden: Hubert Fichtes Essay Patroklos und Achilleus. Anmerkungen zur Ilias (1988) interessiert sich für die homosexuelle Liebe und die Verbindung von Sinnlichkeit und Gewalt; der amerikanische Psychiater Jonathan Shay konfrontiert den mythischen mit den realen, modernen Kriegern, indem er in einer Studie die Traumata von Vietnam-Veteranen mit den homerischen Schilderungen des wütenden Achill parallelisiert (Achilles in Vietnam. Combat Trauma and the Undoing of Character, 1994, dt. 1998: Achill in Vietnam. Kampftrauma und Persönlichkeitsverlust).
Bildliche Darstellungen des Achill sind außerordentlich zahlreich, ohne dass einzelne Werke kunstgeschichtlich kanonisch geworden wären. Aus der Antike sind sehr viele Relief- und Vasendarstellungen, aber keine Vollplastik überliefert. Die klassizistischen Erwartungen an ein Achill-Denkmal erfüllt die monumentale Statue des deutschen Bildhauers Johannes Götz (1909), die noch heute im Achilleion auf Korfu steht, einem für die österreichische Kaiserin Elisabeth (Sisi) 1890–92 erbauten Palast. Der Name verdankt sich der Achill-Verehrung der Kaiserin. Die Statue hat allerdings erst der zweite Besitzer, Kaiser Wilhelm II., in Auftrag gegeben (als Gegenstück zu einer am Ort schon vorhandenen Statue des sterbenden Achill). Sie zeigt den Kriegshelden in triumphaler Pose mit Speer, Schild und typisch griechischem Helm. In der neuzeitlichen Malerei begegnen die Achill-Darstellungen vor allem im 17. und 18. Jh. Achill-Zyklen, die mehrere Episoden aus seinem Mythos versammeln, stammen u.a. von Peter Paul Rubens (um 1630, acht Vorlagen für eine Serie von Wandteppichen) und Giovanni Battista Tiepolo (drei Fresken in der Villa Valmarana bei Vicenza).
LITERATUR
Joachim Latacz: Achilleus. Wandlungen eines europäischen Heldenbildes. Stuttgart 1995
Volker Riedel: „Der beste der Griechen“ – „Achill das Vieh“. Antikerezeption in der Literatur des 18. und des 20. Jh. In: Ders : „Der beste der Griechen“ – „Achill das Vieh“. Aufsätze und Vorträge zur literarischen Antikerezeption Jena 2002. S. 145–157 SM