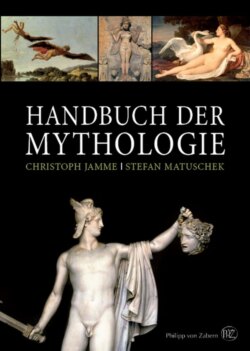Читать книгу Handbuch der Mythologie - Kai Brodersen - Страница 18
1. Europa Griechische Mythologie Christoph Jamme/Stefan Matuschek Einleitung
ОглавлениеWie der Begriff kommen auch die bis heute maßgeblichen Beispiele für den Mythos aus der griechischen Antike. Ursprünglich bezeichnet der Ausdruck die in Hesiods ▸ Theogonie und in den homerischen Epen Ilias und Odyssee erzählten Götter- und Heldengeschichten. Die Genealogie der griechischen Götter, der ▸ Trojanische Krieg und die abenteuerliche Irrfahrt des Kriegsheimkehrers ▸ Odysseus: Das ist vom ersten Aufkommen des Wortes an bis heute die Basis, auf der alle Rede vom Mythos steht. Wie komplex die Definitionsangebote für den Mythosbegriff im ausdifferenzierten Wissenschaftsbetrieb auch geworden sind, so stabil bleibt die Grundlage der hesiodischen und homerischen Texte. Denn sosehr moderne Mythosbegriffe auch moderne Phänomene wie Hollywoodfilme oder Markenprodukte mit einschließen, sie werden genau dann nicht mehr als Mythosbegriffe gelten können, wenn sie ihre Beziehbarkeit auf Hesiods und Homers Erzählungen verlieren. Die Theogonie, die Ilias und die Odyssee geben die nachhaltigste phänomenale Orientierung, was denn konkret unter Mythos zu verstehen ist. So prägt sein altgriechischer Ursprung den Begriff bis heute. Mit der zeitlichen geht die kulturräumliche Ausdehnung einher. Wenn man etwa von germanischen oder auch außereuropäischen Mythen und Mythologien spricht, überträgt man das altgriechische Konzept auf andere Kulturen. Damit wird man den jeweiligen kulturellen Besonderheiten freilich nicht gerecht. Denn wenn auch viele Kulturen traditionelle Götter- und Heldenerzählungen kennen, bleibt deren Kennzeichnung als ‚Mythos‘ doch eine spezifisch altgriechische Position. In diesem Begriff liegt ein Moment der Distanznahme und der Aufklärung: Mythos ist ein potenziell kritischer Begriff, der die Erzählung von Göttern und Helden als von Menschen gemachte Erzählung von den historischen Tatsachen und der göttlichen Offenbarung trennt. Damit gehört der Mythosbegriff zur altgriechischen Philosophie. Er ist ein Erkenntniswerkzeug, mit dem die antiken griechischen Philosophen Rechenschaft über das zu geben versuchen, was in ihrer Kultur traditionelle Geltung hat, ohne einem historischen oder philosophisch-logischen Wahrheitsanspruch zu genügen. Dieses Moment der Distanznahme, der potenziell kritischen Reflexion macht den Mythosbegriff aus. Er ist damit ein Zeugnis des mit den Vorsokratikern beginnenden, ab etwa 600 v. Chr. überlieferten philosophischen Denkens.
Für die Entstehung der altgriechischen Göttergeschichten nimmt man indes eine ursprüngliche Einheit von Mythos und Religion an. Die erzählten waren zugleich die geglaubten und verehrten Götter. Für viele von ihnen sind Tempel und andere Kultstätten erhalten oder archäologisch rekonstruierbar. Insofern zeugt die Mythologie von der Religion im antiken Griechenland. Sie ist nicht nur Erzählung, sondern auch rituelle Praxis. Durch die überragende Bedeutung der homerischen Epen indes erscheint der Mythos zugleich als Dichtung und wird dann im philosophischen Denken als solche, d.h. als Erzeugnis dichterischer Fantasie reflektiert. Die religiöse Dimension ist damit allerdings nicht negiert oder verloren. Vielmehr gehen Religion und Kunst eine Verbindung ein, wie sie gerade für die griechische Antike kennzeichnend und für die Orthodoxie-Vorstellungen monotheistischer Religionen unvorstellbar ist. Die Kunst gilt als Gottesdienst und Gotteszeugnis. Die Attische Tragödie, die die mythischen Überlieferungen in immer neuen dramatischen Zuspitzungen variiert und sinnlich vergegenwärtigt, ist kein Schauspiel im modernen, säkularen Sinne, sondern hat als Teil des Dionysos-Kults eine gottesdienstliche Dimension. Zugleich aber ist sie ein Künstler-Wettkampf: Die Tragödiendichter traten mit ihren individuellen Mythos-Variationen gegeneinander an, und die besten Stücke wurden prämiert. Die Ehrung des Gottes feiert zugleich die individuelle künstlerische Leistung. Und es ist genau diese künstlerische Leistung, der sich der einzigartige, langanhaltende Rezeptionserfolg der antiken griechischen Mythologie verdankt. Von mehreren Hundert namentlich erwähnten Tragödien haben sich allerdings nur insgesamt rund 30 der drei Autoren Aischylos, Sophokles und Euripides aus dem 5. Jh. v. Chr. erhalten. Zusammen mit den beiden homerischen Epen aber haben diese wenigen überlieferten Stücke den frühgriechischen Stoff lebendig gehalten und der Nachwelt, insbesondere den Kunstliebhabern und den Künstlern empfohlen. In der Ilias, der Odyssee und den Attischen Tragödien steht die griechische Mythologie als ein nicht zu überbietender Höhepunkt einer kultisch gefeierten literarischen Kunst da. Dieses Prestige ist einer der entscheidenden Gründe für das dauerhafte Interesse am Mythos und für die paradigmatische Geltung der griechischen Antike.
Was das literarische Ansehen betrifft, ist neben Homer und den Tragikern noch der Lyriker Pindar zu nennen, dessen Preislieder auf siegreiche Sportler (1. Hälfte des 5. Jh. v. Chr.) eine Reihe von mythischen Exkursen und Beispielen enthalten. Herodots Historien (um 430/425 v. Chr.), die die Entwicklung und die Kriege der griechischen Staaten, insbesondere die Perserkriege darstellen, zeigen, wie fließend der Übergang zwischen Mythos und Geschichtsschreibung war. Wiederholt beruft sich Herodot auf die homerischen Epen, um die Vorgeschichte zu referieren, die seinem Berichtszeitraum vorausliegt. Der ▸ Trojanische Krieg, von dem die Ilias und Odyssee erzählen, galt bei aller Verehrung des Dichters Homer als historische Tatsache.
Tragische Maske, Mosaik, 1. Jh. n. Chr., Neapel, Museo Archeologico Nazionale
Der Dichter Homer ist dabei seinerseits ein Beleg für die Verbindung von Mythos und Geschichte. So wie er in der Antike und bis weit in die Neuzeit hinein als eine historische Persönlichkeit verehrt und als ein blinder alter Mann vorgestellt wurde, ist er Fiktion. Das Motiv der Blindheit stammt dabei vom Typ des Sehers, dessen fehlendes Augenlicht sinnbildlich für die ‚höhere‘ Einsicht göttlicher Inspiration steht. In den mythischen Erzählungen tritt dieser Typ als Teiresias-Figur auf. Die weitere Vorstellung Homers entspricht dem Typ des Rhapsoden, dem umherziehenden Vortragskünstler, der über ein Repertoire tradierter epischer Erzählungen verfügt. Dieser Typ ist historisch belegt und kommt auch in der Odyssee vor, wo er in einer Vortragssituation am Königshof dargestellt wird. Dass es jedoch den einen blinden Rhapsoden Homer als Autor der Ilias und Odyssee gegeben hat, ist Fiktion. Es ist die mythische Personifizierung eines Prozesses, in dem eine Vielzahl mündlicher Überlieferungen zu zwei Themenkreisen gebündelt, harmonisiert und verschriftlicht wurden: Seefahrergeschichten flossen so zur Odyssee zusammen und die Erzählungen vom ▸ Trojanischen Krieg zur Ilias. Die Odyssee datiert man auf die Zeit um 700 v. Chr., die Datierung der Ilias ist umstritten. Da sie die Vorgeschichte zu den Irrfahrten des Kriegsheimkehrers ▸ Odysseus erzählt, galt sie seit ihrer Wiederentdeckung in der Renaissance als das ältere Epos. Folglich wurde und wird ihre Entstehung bis heute von der Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 8. Jh. v. Chr. angesetzt. In der jüngeren Forschung wird allerdings auch die Meinung vertreten, dass die Ilias trotz ihres ‚älteren‘ Inhalts der jüngere Text sei, der seine Gestalt erst um die Mitte des 7. Jh. v. Chr. erhalten habe.
Johann Heinrich Wilhelm Tischbein: Kopf des Homer in steinerner Fensternische, Hamburg, Kunsthalle
Was die beiden Epen miteinander verbindet, ist ihre einheitsstiftende Wirkung. Im Text der Ilias und der Odyssee sammelt, harmonisiert und fixiert sich eine vielleicht bis ins 9. Jh. v. Chr. zurückreichende mündliche Überlieferungsfülle verschiedener griechischer Völker, um fortan als dauerhafte und feste Grundlage für ein gesamtgriechisches kulturelles Bewusstsein zu dienen. Der Stoff der Ilias – der Kampf der vereinten Griechen gegen den gemeinsamen äußeren Feind Troja – ist dafür denkbar gut geeignet. Auch in dieser Funktion sind die altgriechischen Götter- und Heldengeschichten musterhafte Belege des Mythischen: Denn Mythen sind solche Geschichten, die durch ihre kollektive Anerkennung Gemeinschaften stiften. Die Bildung eines gesamtgriechischen (‚panhellenistischen‘) kulturellen Gemeinschaftsbewusstseins durch die homerischen Epen ist dafür das maßgebliche Beispiel. Neben den Texten zeugen bis heute Statuen und andere bildhauerische Werke wie Reliefs sowie auch Darstellungen auf Vasen und Trinkgefäßen von dieser Kultur. Sie sind ihrerseits Zeugnisse des (durch griechische Kolonien im ganzen Mittelmeerraum verbreiteten) antiken Mythos, deren Figuren und szenische Motive allerdings erst auf der Grundlage der literarischen Überlieferungen verständlich werden.
Bei all dem wunderbaren Charakter, den seine Götter und Heldentaten zeigen, zeichnet sich der antike griechische Mythos insbesondere durch seine realistische Anschaulichkeit aus. Das liegt nicht nur an den zahlreichen realen Ortsbezügen und den vielen menschlichen Gestalten und Verhältnissen, von denen er erzählt und die auf die aristokratisch-patriarchale Wirklichkeit verweisen, in denen diese Geschichten entstanden. Menschlicher Realismus prägt hier vielmehr auch die Sphäre des Göttlichen. Deren anthropomorphe Eigenschaften sind bekannt, und sie religionskritisch zu diagnostizieren ist eine der ursprünglichen Intentionen des Mythosbegriffs (▸ Mythos und Psychologie). Auf lange Sicht ist die menschliche Lebendigkeit, die das Göttliche im griechischen Mythos gewinnt, allerdings weniger ein Anlass zur Kritik als zur dauerhaften Erinnerung und Fortsetzung. Die Figuren und Motive der griechischen Mythologie haben sich so als eines der langlebigsten Ausdrucks- und Deutungsrepertoires in fast allen Bereichen der europäischen Kultur etabliert. Seitdem es überhaupt einen Markt für Lexika gibt, seit dem 18. Jh. also, ist das Angebot an Nachschlagewerken zur antiken Mythologie entsprechend zahlreich und bis heute unüberschaubar groß: Bis ins 20. Jh. war die Kenntnis der antiken Mythologie eines der Grundelemente der Bildung überhaupt. Mit dem Rückgang des altsprachlichen Unterrichts an den höheren Schulen nimmt deren Bedeutung ab. Im deutschen Sprachraum hatte die griechische Mythologie ihre populärste Präsenz in Gustavs Schwabs Nacherzählung Die schönsten Sagen des klassischen Altertums (3 Bde. 1838–40; kaum zählbare Neuauflagen bis heute). Sie bündeln die antiken Überlieferungen zu einer stringenten Erzählung, mit der sich vor allem die bildungsbürgerliche Jugend auf unterhaltsame Weise das notwendige mythologische Wissen verschaffen konnte. Was das junge Publikum betrifft, wird Schwab zuletzt von den Hörbüchern des bulgarischen Kinderbuchautors Dimiter Inkiow abgelöst, der (ab 2001) die griechischen Mythen auf aktuell kindgerechte Weise nacherzählt. An den ehemaligen Rang des Schwab wird diese Produktion durch den Ansehensverlust der altertumskundlichen Bildung freilich nicht anschließen können. Dennoch sind – wie etwa die Bezeichnung ‚Trojaner‘ für ein Computervirus oder die Verwendung des Europa-Stier-Motivs in der politischen Karikatur belegen – die Figuren und Motive der griechischen Mythologie als anschaulicher Deutungscode bis heute in Kurs.
LITERATUR
Timothy Gantz: Early Greek Myth. A Guide to Literary and Artistic Sources. Baltimore, London 1993
Maria Moog-Grünewald (Hg.): Mythenrezeption. Die antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart, Weimar 2008 (= Der Neue Pauly. Supplemente Bd. 5)
Udo Reinhardt: Der antike Mythos. Ein systematisches Handbuch. Freiburg, Berlin, Wien 2011 SM