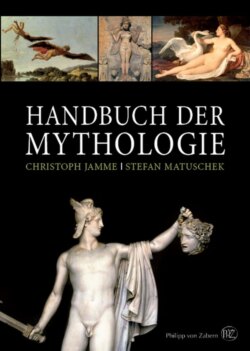Читать книгу Handbuch der Mythologie - Kai Brodersen - Страница 27
Daidalos und Ikaros
ОглавлениеDaidalos und Ikaros sind Vater und Sohn, deren mythisches Hauptmotiv die gemeinsame Flucht aus Kreta ist: Der Vater fertigt dazu künstliche Flügel an, mit denen ihnen die Flucht in die Freiheit gelingt, der Sohn scheitert an seinem Übermut, weil er gegen den Rat seines Vaters im Flug der Sonne zu nahe kommt, so dass seine mit Wachs zusammengehaltenen Flügel sich auflösen und er tödlich ins Meer stürzt (ausführlichste antike Darstellung bei Ovid, Ars amatoria, 1 v. Chr., II,21–96). In dieser Episode zeigen sich zugleich die je besonderen Eigenschaften der beiden Figuren: Daidalos verkörpert die Kunstfertigkeit (griech. daidalon = Kunstwerk), Ikaros den jugendlichen Übermut. Mit diesen Eigenschaften sind beide auch je für sich profiliert und rezipiert worden.
Daidalos ist der mythische Ahnherr aller Erfinder, Techniker, Handwerker, Architekten und Bildhauer. Sein Name bedeutet ‚der Kunstreiche, Geschickte‘. Ovids Metamorphosen (1 v. Chr. – 10 n. Chr., VIII,155–259) erzählen seine Lebensgeschichte am kompaktesten: Aus Neid über die Erfindergabe seines Neffen Perdix stößt Daidalos ihn von der athenischen Akropolis und flieht daraufhin nach Kreta zu König Minos. Für dessen Gattin Pasiphae baut er eine täuschend echt erscheinende künstliche Kuh, damit die Königin sich, darin versteckt, von einem von ihr geliebten Stier begatten lassen kann. Um den aus dieser Verbindung hervorgegangenen Minotauros – ein Menschenopfer verlangendes Schreckenwesen, halb Mensch, halb Stier – gefangen und verborgen zu halten, entwirft und baut Daidalos das Minoische Labyrinth. Das französische Wort dafür (dédale) erinnert bis heute an dessen mythischen Erbauer. Aus Heimweh und weil Minos ihn nicht ziehen lässt, entschließt sich Daidalos mit seinem Sohn zur Flucht. Neben der dominierenden ovidischen Erzählung von den künstlichen Flügeln gibt es die Variante, dass Daidalos durch Erfindung des Segels erfolgreich nach Sizilien entkommt, dort aber dann von Minos durch eine List aufgespürt wird. Daidalos verrät sich durch die Lösung einer kniffligen Aufgabe, an der alle anderen scheitern. Zur Erklärung, warum Minos ihn auf Kreta festhält, wird auch die Sage um Theseus und Ariadne herangezogen: Daidalos sei es gewesen, der Ariadne den Trick mit dem Faden beigebracht habe, wodurch Theseus, der den Minotauros tötet, wieder aus dem Labyrinth herausfindet. Als Rache dafür, dass Theseus die Königstochter Ariadne entführt, setzt Minos Daidalos und dessen Sohn im Labyrinth gefangen.
Die bekannteste moderne literarische Erinnerung an die antike Erfinder-, Künstler- und Handwerkerfigur ist der Name Stephen Dedalus, den James Joyce seiner autobiographisch gefärbten Hauptfigur in den Romanen A Portrait of the Artist as a Young Man (1914/15) und Ulysses (1922) gibt. Die Studienstiftung des deutschen Volkes, das größte deutsche Begabtenförderwerk, führt seit den 1990er-Jahren einen Daidalos-Kopf als Logo: Seine Haare sind Arme und Hände, was auf den Zusammenhang von Theorie und Praxis hinweisen soll.
Über die Ikaros-Figur sind keine weiteren Geschichten erfunden und erzählt worden. Sie hat vielmehr allein durch das Höhenflug- und Sturz-Motiv gewirkt. In den mittelalterlichen christlichen Ovid-Auslegungen und in der Literatur der frühen Neuzeit ist es moralisch gedeutet worden: als Exempel für das Sprichwort „Hochmut kommt vor dem Fall“, als Ermahnung, die goldene Mitte zu wahren (Francis Bacon, De sapientia veterum, Über die Weisheit der Alten, 1609, Kap. XXVII; Daidalos ermahnt seinen Sohn, zu Sonne und Meer gleichermaßen den sicheren Abstand zu wahren), und als Warnung, was demjenigen zustößt, der väterlichen Rat missachtet (Sebastian Brant, Das Narrenschiff, 1494, Kap. 41).
In der Literatur des 19. und 20. Jh. bekommt die Ikaros-Figur eine ganz neue Bedeutung. Sie dient nicht mehr als Exempel für moralische Verfehlung, sondern lädt sich stattdessen einerseits mit positiven Erwartungen und Sehnsüchten, andererseits mit Trotz und Melancholie auf. Die Missachtung des väterlichen Rats und der Höhenflug stellen nun Emanzipation, der Absturz dagegen Gefahr, Risiko und Märtyrertum dar. So verkörpert Ikaros die Erwartungen und Risiken der jungen Generation. Der Spannungsmoment zwischen Höhenflug und Absturz wird zur symbolischen Situation jugendlicher, emanzipatorischer Selbstbehauptung. Den Anfang setzt hier die Dramenfigur eines älteren Autors, der Euphorion im zweiten Teil von Goethes Faust (1832), der als himmelstürmender Jüngling den poetisch-politischen Elan der jungen Romantikergeneration repräsentiert und im dramatischen Umschlagspunkt vom Flug zum Sturz als „Ikarus! Ikarus!“ (Vers 9901) angerufen und betrauert wird. In der modernen Lyrik wird die so verstandene Ikaros-Figur zum Topos. Größte Resonanz hat ein Gedicht von Charles Baudelaire (Les plaintes d’un Icare, Die Klagen eines Ikaros, 1862), das die Spannung von übermütiger Erwartung und Frustration festhält: „mes bras sont rompus/Pour avoir étreint des nuées.“ „Je sens mon aile qui se casse.“ (Meine Arme sind gebrochen, da sie Wolken umschlungen haben. Ich fühle meinen Flügel, der bricht.) Die Psychologie dieser Figur pointiert der italienische Dichter Gabriele d’Annunzio, wenn er seinen Ikaros seine Sucht nach Höhen und Abgründen gestehen lässt („questa mia d’altezze e d’abissi avidità“, Altius egit iter, 1904; der lateinische Gedichttitel ist ein Ovid-Zitat zu Ikaros: Höher nahm er den Weg). Im Futurismus und Expressionismus verbindet sich das mythische mit dem technisch realen Flugmotiv zur Selbstdarstellung der jungen Generation als „Ikariden“ (Georg Heym, Die Morgue, 1911, Hellmuth Wetzel, Ikariden, 1912). Das Scheitern wird zur Schuld böswilliger Feinde (Johannes R. Becher, Dädalus und Ikarus, 1941), aggressiv zur Abscheu vor der heilen Welt (Gottfried Benn, Da fiel uns Ikarus vor die Füße …, 1913, Ikarus, 1915) oder paradox zum Triumph umgedeutet: „Ikarus ging unter/hoch über den anderen“ (Ernst Jandl, Ikarus, 1954). Besonders häufig erscheint die Ikaros-Figur schließlich in der DDR-Literatur. Das hängt mit den Zensur-Bedingungen zusammen, unter denen der Mythos artikulierbar macht, was in realistischer Darstellung verboten wäre. So schließen viele DDR-Autoren an die moderne, identifikatorische Deutung dieser Figur an, um ihre eigene Situation zwischen Freiheitssehnsucht, Emanzipationsdrang und Frustrationserwartung auszudrücken: Günter Kunert, Ikarus 64, 1964, Unterwegs nach Utopia I, 1977, Ikarus neuerlich, 1996; Bettina Wegner, Ikarus, 1974, Wolf Biermann, Ballade vom preußischen Ikarus, 1976, Sascha Anderson, der meissner ikarus, 1983. 1975 erschien ein DEFA-Film Ikarus (Regie: Heiner Carow), der seiner realistischen Geschichte um kindliche Flugzeug-Sehnsucht durch die mythische Figur und deren moderne literarische Deutung eine über den kindlichen Kontext hinausweisende Dimension gibt.
Nach Pieter Bruegel: De val van Icarus (Landschaft mit dem Sturz des Ikarus), ca 1590-95, Brüssel, Van Buuren Museum
Antike bildliche Darstellungen von Daidalos und Ikaros sind in den Wandmalereien in Pompeji (1. Jh. n. Chr.) und in römischen Reliefplastiken überliefert. Die bemerkenswerteste Darstellung gibt das Pieter Bruegel d. Ä. zugeschriebene Ölgemälde Der Sturz des Ikarus (1555/68). Es zeigt im weiten Panorama eine Meerenge mit Schiffen zwischen zwei Felsküsten, im Vordergrund einen pflügenden Bauern. Als kleines Detail, fast versteckt, sieht man, wie eine Momentaufnahme, die noch aus der Meeresoberfläche herausragenden Beine des Stürzenden. Das Gemälde hat eine lange Interpretationsdebatte hervorgerufen, die mittlerweile auch lyrische Texte enthält, u.a. von Wolf Biermann, Stephan Hermlin, Michael Hamburger und William Carlos Williams. Viele Bildmotive erklären sich aus dem Erzählkontext bei Ovid oder als Anspielung auf weitere Mythen. In den übrigen Darstellungen hat sich als Bildformel die Gegenüberstellung des fliegenden, nach unten blickenden Daidalos und des mit dem Rücken zur Erde stürzenden, in die Sonne blickenden Ikaros herausgebildet (Fresko nach Entwurf von Annibale Caracci im römischen Palazzo Farnese, 1603/04, Carlo Saraceni, Der Sturz des Ikarus, 1606/07).
LITERATUR
Bernhard Greiner: Der Ikarus-Mythos in Literatur und bildender Kunst. In: Michigan Germanic Studies 8. 1982, S. 51–126
Joseph Leo Koerner: Die Suche nach dem Labyrinth. Der Mythos von Dädalus und Ikarus. Frankfurt a. M. 1983
Achim Aurnhammer, Dieter Martin (Hg.): Mythos Ikarus. Leipzig 32008 SM