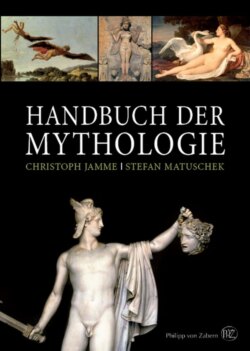Читать книгу Handbuch der Mythologie - Kai Brodersen - Страница 26
Athene/Minerva
ОглавлениеDie ewig jungfräuliche, aus dem Haupt des Zeus geborene Athene tritt in vielfacher Hinsicht als Schutzgöttin in Erscheinung. Ihre Geburt erzählt Hesiods Theogonie (Wende vom 8. zum 7. Jh. v. Chr., Verse 886–900): Aufgrund der Weissagung, einer seiner Söhne werde ihn dereinst stürzen, verschlingt Zeus seine mit Athene schwangere Frau Metis, so dass seine Tochter von ihm selbst zur Welt gebracht wird. Spätere Autoren malen dies aus, indem sie Hephaistos oder Prometheus mit einer Axt das Haupt des Zeus spalten lassen, dem dann Athene in voller Rüstung entsteigt. Die verschiedenen Funktionen als Schutzgöttin sind in zahlreichen bildhauerisch-architektonischen und textlichen Dokumenten belegt. Deren größtes ist der ihr geweihte Parthenon-Tempel auf der athenischen Akropolis (gr. parthenos = Jungfrau). In seinem Inneren soll nach Zeugnis antiker Schriftsteller eine prachtvolle, aus Gold und Elfenbein gefertigte, fast zwölf Meter messende Athene-Statue des Bildhauers Phidias gestanden haben, vor dem Tempel eine bronzene Kolossalstatue der Göttin ebenfalls von Phidias, deren funkelnde Speerspitze schon vom Meer aus sichtbar gewesen sei, als Zeichen der städtischen Wehrhaftigkeit. Beide Statuen sind verloren. Von der aus Elfenbein sind verkleinerte römische Marmorkopien erhalten. Für die Darstellungstradition der Jungfrau mit Helm und Speer sind die ebenfalls in römischen Kopien überlieferte Statue des Bildhauers Myron (um 450 v. Chr.) und die sogenannte Athene/Minerva Giustiniani (gefunden im 17. Jh. im römischen Palazzo Giustiniani) prägend geworden. Auf einem Giebelrelief des Parthenon ist die Episode dargestellt, die Athene zur Schutzgöttin der (nach ihr benannten) Stadt Athen macht: Gegen den Meergott Poseidon, der eine Quelle auf der Akropolis entspringen lässt, setzt sich Athene mit einem Ölbaum durch, der von den urteilenden Göttern als die nützlichere Gabe für die Stadt angesehen wird (erzählt z.B. in Ovids Metamorphosen, VI, 70–82). Die Schutzfunktion beschränkt sich allerdings nicht auf ‚ihre‘ Stadt Athen, sondern gilt generell für Burgen und Schlösser. Sie symbolisiert sich im Palladion, einem Kultbild der wehrhaften Göttin (nach ihrem Beinamen ‚Pallas‘): Erst dessen Verlust oder Raub bedeutet die Kapitulation, so auch im Fall von Troja, dessen Palladion direkt aus Zeus’ Händen vom Himmel gefallen sein soll und das zum endgültigen Untergang der Stadt schließlich von Odysseus und Diomedes geraubt wird. Der Beiname Pallas wird auf unterschiedliche Weise erklärt: Zum einen als Name einer jungen Gefährtin der Athene, den sie zum Andenken übernimmt, nachdem sie sie versehentlich in Wettspielen getötet hat. Zum anderen wird auch ein Titan namens Pallax angeführt, den Athene im Kampf besiegt und mit dessen Haut sie ihren Schild bespannt hat. Schließlich wird auch das griechische Verb ‚pallein‘ (schwingen, schleudern, werfen) herangezogen, das sich auf Athenes Umgang mit dem Speer beziehen soll (Platon, Kratylos, 406d – 407a).
Athena Giustiniani, Vatikan, Museo Chiaramonti e Braccio Nuovo
Im Trojanischen Krieg interveniert Athene, obwohl auch die Trojaner ihre Hilfe erflehen (Ilias VI, 297–311), mehrfach zugunsten der Griechen. Die Ilias pointiert dabei das Sich-Umkleiden der fein gewandeten Jungfrau in die waffenstarrende Kriegerin, auf deren Schild das versteinernde Gorgonenhaupt prangt, das Athene von Perseus erhielt (V, 733–747 und VIII, 384–391). Sie hilft den griechischen Kämpfern durch Rat und Tat, schließlich auch beim Bau des kriegsentscheidenden hölzernen Pferdes. Man kann dies insgesamt als ihre Rache an Paris sehen dafür, dass er nicht ihr, sondern Aphrodite den Schönheitspreis zuerkannte (woraufhin er Helena zur Belohnung erhielt und mit ihrer Entführung nach Troja den Krieg auslöste). Als Schutzgöttin für Handwerk und Künste weist sich Athene dadurch aus, dass sie beim Bau des mythischen ersten Schiffes, der Argo, die entscheidenden Hinweise gibt, dass sie als Meisterin der Webkunst gezeigt wird (Ovids Metamorphosen VI, 5–145, erzählen von ihrer Herausforderung durch die Weberin Arachne, die Athene zur Strafe in eine Spinne verwandelt) und dass sie die Doppelflöte erfindet (die sie aber dann verwirft, weil das Flötenspiel das Gesicht hässlich verzerrt). Durch die ihr als Attribut zugeordnete Eule ist sie allegorisch mit der Weisheit verbunden. Hegels berühmt gewordene Metapher von der „Eule der Minerva“, die erst in der Dämmerung ihren Flug beginnt, erinnert daran (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, Vorrede). Hegel greift die antike Allegorie auf, um mit seinem Bild des Dämmerungsflugs die Philosophie als eine auf den Geschichtsverlauf rückblickende Erkenntnisarbeit zu erklären.
Am Ende der homerischen Odyssee (XXIV, 529–547) sowie einiger griechischer Tragödien erscheint Athene als die streitschlichtende Instanz. In Aischylos’ Eumeniden, dem dritten Teil seiner Orestie (458 v. Chr.), hat sie ihren längsten Auftritt (Verse 566–1031), in dem sie die Gerichtsverhandlung über Orest auf dem athenischen Areopag führt und durch ihre Stimme den Ausschlag für seine Entsühnung vom Muttermord gibt. In Euripides’ Die Schutzflehenden (424 oder 421 v. Chr.), Iphigenie bei den Taurern (um 412 v. Chr.) und Ion (412–408 v. Chr.) ist sie die Schlussfigur der Dea ex machina, die von der Theatermaschinerie herabgelassene Göttin, die den menschlichen Konflikt löst. In Sophokles’ Aias (etwa 450 v. Chr.) und Euripides’ Troerinnen (415 v. Chr.) tritt sie am Anfang auf und markiert so eine dem menschlichen Geschehen übergeordnete, rahmengebende Handlungsebene.
In der Neuzeit ist Athene vor allem in der bildenden Kunst präsent, und zwar als Schutzgöttin oder Allegorie der Wissenschaften, der Künste, der Weisheit und Klugheit. Andrea Mantegnas Gemälde Minerva vertreibt die Laster aus dem Garten der Tugend (1502) sublimiert und adelt die kriegerische Seite der Göttin zum Widerstand gegen alles Sündhafte. In Raffaels Schule von Athen (1509) steht sie als monumentales Standbild neben Apoll über den zu ihren Füßen versammelten Philosophen und Wissenschaftlern. In Sandro Botticellis Darstellung Pallas und ein Kentaur (1482) erscheint die antike Göttin wie ein Erzengel als geistige Macht, die das Tierische bändigt. Als Gegenfigur zum Kriegsgott Ares/Mars verkörpert sie die Frieden und Wohlstand bringende Macht von Wissenschaft und Weisheit. Die in der Ilias (V, 844–887) erzählte Verwundung des Ares durch Athene erhält so eine zusätzliche allegorische Dimension (Tintoretto, Minerva vertreibt Mars, 1578; Peter Paul Rubens, Minerva beschützt Pax vor Mars, 1629/30; Jacques-Louis David, Minervas Kampf gegen Mars, 1771). Rembrandt (Minerva, 1631) zeigt die Göttin in der Pose des Gelehrten vor einem aufgeschlagenen Folianten. In der Verweisfunktion auf Kunst und Wissenschaften, auf Klugheit und Weisheit gehört Athene/Minerva zum Bildprogramm der Herrschaftsrepräsentation an den frühneuzeitlichen Höfen (z.B. Mantua, Fontainebleau, Versailles), was dann von den bürgerlichen Kunst- und Wissenschaftseinrichtungen im 19. Jh. fortgeführt wird (Deckengemälde im Louvre; Wandgemälde von Gustav Klimt im Treppenaufgang des Kunsthistorischen Museums in Wien, 1890/91). Auch noch die modernen Abspaltungen vom bürgerlichen Kunstbetrieb bleiben der Figur in ihrer allegorischen Funktion verbunden (Athene-Gemälde von Gustav Klimt und Franz von Stuck, beide 1898). Die Max-Planck-Gesellschaft und einige Universitäten führen bis heute die Athene/Minerva-Figur als ihr Emblem. Die Athene-Statue vor dem österreichischen Parlament in Wien knüpft an die politische Bedeutung der Stadt Athen als erster Demokratie an.
Gustav Klimt: Pallas Athene, 1898, Wien, Historisches Museum der Stadt Wien
LITERATUR
Susan Deacy, Alexandra Villing (Hg.): Athena in the Classical World. Leiden 2001
Susan Deacy: Athena. London 2008 SM