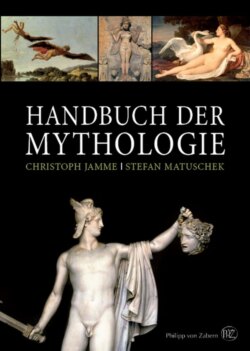Читать книгу Handbuch der Mythologie - Kai Brodersen - Страница 24
Argonauten
ОглавлениеAls Argonauten oder auch Minyer werden die Helden bezeichnet, die unter der Leitung des Iason eine Expedition nach Aia (bzw. Kolchis) unternehmen; sie gehören allesamt der Heldengeneration vor dem ▸ Trojanischen Krieg an. Ziel der Fahrt ist es, das Goldene Vlies des Widders, auf dem Phrixos und seine Schwester Helle einst nach Kolchis flohen, nach Griechenland zurückzubringen. Der Mythos war in der antiken Literatur sehr verbreitet und wurde in vielen Gattungen verarbeitet.
In den Zeugnissen, die vollständige Kataloge der Teilnehmer bieten, variieren Zusammensetzung und Anzahl der Helden – von 47 bis 66, Pindar nennt dagegen nur 10 nebst Iason –, es lassen sich jedoch 27 Helden anführen, die in den meisten Texten zu finden sind: Zu den namhaftesten gehören der Anführer Iason (Sohn des Aison und der Polymela), der Schiffsbauer Argos, der Steuermann Tiphys, Peleus (der Vater des Achilleus), ▸ Herakles und sein Schützling Hylas, die Dioskuren Kastor und Polydeukes (die beiden Brüder der Helena), Kalais und Zetes (die Söhne des Nordwindes Boreas) sowie der legendäre Sänger ▸ Orpheus. Die Handlung besteht aus zahlreichen Episoden, in denen der Fokus jeweils auf einzelnen Helden liegt; Iason spielt aber mit Abstand die wichtigste Rolle. Ihm trägt Pelias, der König von Iolkos, aus Angst vor einem Orakel, das ihm den Tod durch Iason prophezeit, die Rückführung des Goldenen Vlieses auf. Daraufhin lässt Iason das sprechende Schiff Argo bauen und die Expeditionsteilnehmer versammeln. Zu den wichtigsten Stationen der Hinfahrt gehören die Landung auf Lemnos, das nur noch von Frauen bewohnt wird, mit denen die Argonauten Liebesbeziehungen eingehen, der unbeabsichtigte Kampf mit den befreundeten Dolionen (ein thrakischer Stamm an der Südküste der Propontis), die Entführung des Hylas durch Nymphen in Mysien, wobei Herakles und Polyphemos, die nach ihm suchen, zurückgelassen werden, der Sieg des Polydeukes über Amykos, den König der Bebryker (ein wildes Volk an der Nordostküste der Propontis) im Faustkampf, in Salmydessos die Prophezeiung des Phineus, den die Söhne des Boreas vor den Harpyien retten, sowie die Fahrt durch die aneinanderschlagenden Felsen der Symplegaden. Nach der Ankunft in Kolchis erlegt der dortige König Aietes dem Anführer Iason drei Prüfungen auf, die er meistern muss, um das Goldene Vlies zu erlangen. Der Held besteht sie mithilfe der Königstochter und Zauberin ▸ Medea, die sich in ihn verliebt: Iason pflügt mit Stieren, die Feuer schnauben und eherne Füße besitzen, ein Feld, besiegt Krieger, die aus ausgesäten Drachenzähnen entstehen, und überwindet den schlaflosen Drachen, der das Vlies bewacht. Medea schließt sich den Argonauten nach erfolgreicher Gewinnung des Vlieses an und verhilft ihnen zur Flucht, indem sie ihren Bruder Apsyrtos unterwegs zerstückelt und den Verfolgern in den Weg wirft. Die Rückfahrt führt die Helden gemäß einer (aus verschiedenen Zeugnissen zusammengesetzten) Version über den südlichen Okeanos, per Landtransport der Argo durch Libyen oder den Fluss Tanais, durch den Nil, über Kyrene, Thera und Lemnos, den nördlichen Okeanos und die Säulen des Herakles (das heutige Gibraltar) sowie durch den Bosporos. In der wirkmächtigeren Version des Apollonios Rhodios fahren die Argonauten stattdessen durch die Flüsse Istros, Eridanos, Rhodanos, die Adria und das Tyrrhenische Meer zur Insel Aiaie, wo die Zauberin Kirke die Argonauten für den Mord an Apsyrtos entsühnt. Danach geht die Fahrt an den Sirenen, Skylla und Charybdis vorbei durch die Meerenge der Plankten, über Thrinakie (das heutige Sizilien) zu den Phaiaken, wo die Hochzeit von Iason und Medea abgehalten wird; diese Stationen sind eine Generation später auch Teil der Irrfahrt des ▸ Odysseus. Anschließend tragen die Argonauten ihr Schiff nach einem Sturm durch Libyen, fahren über Anaphe und Kreta, wo sie den bronzenen Riesen Talos bezwingen, über Aigina zurück nach Iolkos, wo Pelias durch eine List der Medea zu Tode kommt. Als Iason sich später von Medea trennt, um eine andere Frau zu heiraten, rächt sich die Zauberin auf grausame Weise, indem sie die gemeinsamen Kinder tötet.
In der Antike existierten viele Bearbeitungen des Mythos und dementsprechend sind verschiedene Varianten erhalten. Zu den wichtigen Zeugnissen gehören Pindars 4. Pythische Ode (5. Jh. v. Chr.), die Argonautika des Apollonios Rhodios (3. Jh. v. Chr.), die Argonautica des Valerius Flaccus (1. Jh. n. Chr.) sowie die Argonautika des Orpheus (verm. 5. Jh. n. Chr.). Dabei sind verschiedene Bedeutungstraditionen feststellbar: Wie aus den ältesten Belegen (einzelne Stellen bei Homer, Hesiod und Mimnermos) geschlossen werden kann, dürfte der Ursprung des Mythos in einer Konkurrenz von Hera- und Poseidonkult (repräsentiert durch Iason bzw. Pelias) liegen. Pindars Version ist als Siegeslied für einen Auftraggeber konzipiert und dadurch bestimmend für die späteren, ebenfalls auf Herrscherlob ausgerichteten Darstellungen. Dazu gehört auch das hellenistische Epos des Apollonios Rhodios, das sich allerdings besonders durch alexandrinische Gelehrsamkeit – und speziell durch Gründungssagen und literarische Auseinandersetzung mit Homer – auszeichnet. In dieselbe Tradition gehört die Verarbeitung des Mythos in den Argonautika des Orpheus. Die Argonautica des Valerius Flaccus schließlich sind wiederum auf Herrscherlob ausgerichtet und transportieren die Rom-Idee des flavischen Kaiserhauses; im Gegensatz zu Apollonios Rhodios erfolgt primär eine literarische Auseinandersetzung mit Vergils Aeneis (1. Jh. v. Chr.).
Im Zuge dieser unterschiedlichen Bearbeitungen war insbesondere die Konzeption der Heldenfigur Iason gravierenden Veränderungen unterworfen. Während Pindars 4. Pythische Ode (z.B. 138–151 und 412–421) noch einen positiven Helden Iason zeigte, führte Euripides in seiner Tragödie Medeia (5. Jh. v. Chr.) eine kritische Sicht auf den Anführer der Argonauten in die literarische Tradition ein. In der Forschung umstritten ist die Beurteilung des Helden bei Apollonios Rhodios: Entweder wird er als ratloser Antiheld interpretiert oder als moderner Held, der sich durch diplomatisches und demokratisches Vorgehen auszeichnet. Mit Ovid setzt sich die iasonkritische Tendenz fort, wobei das Gewicht auf die Gefühlswelt der verlassenen Frauen gelegt wird (Heroides 6 und 12; Metamorphosen VII, 9–158, 1. Jh. v. Chr.). Bei Valerius Flaccus erscheint der Held wieder in positiverem Licht, da er im Rahmen eines göttlichen Weltenplans handelt.
In der mittelalterlichen Rezeption sind beide Deutungstraditionen weiterhin fassbar, außerdem kommt eine dritte hinzu: Durch die Verknüpfung mit dem Trojanischen Krieg verschaffte der spätantike Autor Dares Phrygius (Historia de excidio Troiae, 6. Jh. n. Chr.) dem chronologisch früher anzusiedelnden Argonauten-Mythos den Status eines Prologs. In der Nachfolge schuf Benoît de Sainte-Maure basierend auf dieser Verbindung seinen Roman de Troie (um 1165), in dem Iason in positiver Lesart als vollendeter Ritter erscheint. Im Anschluss an Ovids Verarbeitung wird Iason im Roman de la Rose (1275–1280) dagegen als Liebesverräter bezeichnet, in Dantes La Divina Commedia (ca. 1307–1314) gar als Kuppler in den achten Höllenkreis versetzt; dieser Darstellung steht allerdings eine gleichzeitige, positive allegorische Ausdeutung im heilsgeschichtlichen Sinn entgegen. Der dritte Traditionsstrang besteht aus einer lexikonartigen Überlieferung des Mythos ohne besonderen Deutungsanspruch. Im ausgehenden Mittelalter verband dann Raoul Lefèvre (Histoire de Jason, um 1460) die drei Traditionen zu einer Iason-Biographie, in welcher die Moral der Ritterepik, göttliche Sendung und christliche Versöhnung gleichermaßen von Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang kann auch die Gründung des ‚Ritterordens vom Goldenen Vlies‘ am 10.1.1430 durch den Herzog Philippe le Bon von Burgund gesehen werden, die einer Erneuerung des Rittertums dienen sollte.
Mit dem verstärkten Interesse der frühen Neuzeit an Liebesbeziehungen vertrug sich die als Liebesverräter gebrandmarkte Figur Iason schlecht. Aus diesem Grund ist es nicht erstaunlich, dass der Held in der späten Tragödie Pierre Corneilles (La conquête de la Toison d’or, 1660) demontiert wird: König Aietes steht in der Schuld des Iason und bietet ihm die Hand seiner Tochter Medea an. Auf Drängen der anderen Argonauten soll sich Iason jedoch für das Goldene Vlies entscheiden. Noch komplizierter wird die Situation, als Hypsipyle eintrifft, wodurch zwischen den beiden Frauen Eifersucht geschürt wird; Iason entgeht dem Problem durch emotionslose Berechnung. Dieselbe Dreiecksbeziehung hatte zuvor Pietro Francesco Cavalli in seiner wirkmächtigen Oper Il Giasone (1649, Libretto von G. A. Cicognini) musikalisch umgesetzt. Einen Schritt weiter geht Jonathan Swift (M. Jason Hassard, a Woolen-Drapier in Dublin, Put up the Sign of the Golden Fleece and Desired a Motto in Verse, 1720); er macht aus Iason einen kleinbürgerlichen Wollhändler und sorgt mit dieser Entmythisierung für eine komische Umdeutung des Stoffes.
In der bildenden Kunst der Neuzeit wurde die Liebesthematik ausgeblendet; stattdessen fand eine Rückwendung zur antiken Ikonographie statt. Bereits aus dem 7. Jh. v. Chr. sind Darstellungen der Argonauten fassbar; populär war der Mythos aber auf süditalischen Vasen ab dem 5. Jh. v. Chr. und in der etruskischen Kunst. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist eine starke Fokussierung auf ausgewählte Episoden bemerkbar, die sich bis ins 4. Jh. n. Chr. fortsetzt. Dominant ist v.a. der Moment, in dem Iason das Goldene Vlies an sich bringt, wobei die restlichen Argonauten dabei zumeist ausgeblendet werden (vgl. dazu z.B. die Darstellung auf einem apulischen Volutenkrater, um 350 v. Chr., St. Petersburg, Eremitage 1718). Christian Daniel Rauch hat in seinem Bild Jason und Medea (1818, Staatliche Museen zu Berlin, National-Galerie) genau diese Ikonographie wieder aufgegriffen und als klassizistisches Marmorrelief umgesetzt (vgl. dazu z.B. ein syrisches Kalksteinrelief aus dem 4. – 6. Jh. n. Chr., Kansas City, Nelson Gallery 41–36): In der Bildmitte steht der Baum, an dem das Goldene Vlies hängt und um den sich der Drache windet. Dieser trinkt einen Schlaftrunk aus einer Schale, die ihm Medea, die rechts neben dem Baum steht, hinhält. Links neben dem Baum greift der gerüstete Iason nach dem Vlies, das ihm von einem kleinen Eros, der die Liebesverbindung mit Medea darstellt, heruntergereicht wird. Unterhalb des Baumes sind zwei Fackeln als Symbol der ehelichen Verbindung angebracht.
Während im Mittelalter und der frühen Neuzeit der Schwerpunkt der Rezeption auf der Iason-Figur lag, wurde in der Moderne die Argonauten-Fahrt an sich wieder stärker aufgegriffen und als Transportmittel für verschiedenste Inhalte verwendet: Im Realismus Ende des 19. Jh. diente der Mythos als Gefäß für Gesellschaftskritik, den Symbolisten Anfang des 20. Jh. als Folie für eine traumhafte Suche nach dem Heil der Menschheit. Seit den 1930er Jahren wurde der Mythos dann v.a. als Rahmen für die Behandlung existenzieller Krisen des Menschen genutzt. Anna Seghers z.B. zeigt in ihrer Erzählung Das Argonautenschiff (1948) einen greisen Iason, der sich im Rückblick auf sein Leben in seinen Tod fügt und sich von einem Wrackteil der Argo erschlagen lässt. Noch in der Postmoderne wird die Argonauten-Fahrt als Folie für eine existenzielle Suche verwendet, so z.B. bei Stefan Schütz (Katt, 1988), der einen Autor der DDR in der Schaffenskrise angesichts der westlichen Lebensweise auf eine Reise zu einer neuen Selbstbestimmung schickt.
Christian Daniel Rauch: Jason und Medea, 1818, Berlin, Friedrichswerdersche Kirche
Eine große Leserschaft erreichte die Comic-Adaption des Mythos Das goldene Vlies von Carl Barks (Original: The Golden Fleecing), in der Dagobert Duck, die reichste Ente der Welt, nach dem sagenhaften Schatz sucht; seit der Erstveröffentlichung 1955 wurde die Geschichte unzählige Male neu aufgelegt. Besonders breitenwirksam war auch die heroische Kinoverfilmung Jason und die Argonauten von Don Chaffey (Original: Jason and the Argonauts, USA/England 1963), in welcher die Handlung von menschlichem Mut und göttlichem Spiel zwischen Zeus und Hera bestimmt wird. Die Spezialeffekte, die zum Großteil in Stop-Motion-Technik geschaffen wurden, waren zu dieser Zeit revolutionär und noch heute besitzt der Film Kultstatus. Die Eingangssequenz des Filmes Medea von Pier Paolo Pasolini (Italien/Frankreich/Westdeutschland 1969) bot eine summarische Darstellung der Argonauten-Fahrt nach Kolchis. Mit seinem afrikanischen setting und der realistischen Darstellung von blutigen Riten wirkte der Film stilbildend. Die Fernsehproduktion Jason und der Kampf um das Goldene Vlies von Nick Willing (Original: Jason and the Argonauts, USA 2000) inszenierte dagegen eine düstere Welt von Gut und Böse, in denen der zaudernde Anführer Iason als postmoderner Antiheld eine Gruppe von gescheiterten Existenzen zum Ziel führen muss.
LITERATUR
Frank A. Dominguez: The Medieval Argonautica. Potomac 1979
Karl Scheffold: Die Sagen von den Argonauten, von Theben und Troia in der klassischen und hellenistischen Kunst. München 1989
Paul Dräger: Argo pasimelousa I. Der Argonautenmythos in der griechischen und römischen Literatur. Teil I: Theos aitios. Stuttgart 1993
Theodoros D. Papanghelis, Antonios Rengakos (Hg.): A Companion to Apollonios Rhodios. Leiden 2008
Arnold Bärtschi