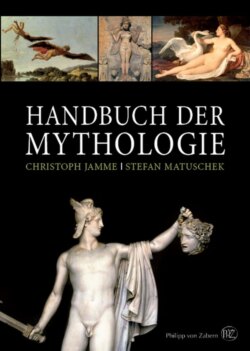Читать книгу Handbuch der Mythologie - Kai Brodersen - Страница 28
Demeter und Persephone/Ceres und Proserpina
ОглавлениеDemeter (lat. ▸ Ceres), Tochter des Kronos (▸ Uranos und Kronos) und der Rhea, ist die Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit. In der ersten Funktion gilt sie als Kulturstifterin und Begründerin der Sesshaftigkeit der Menschen. Man nimmt an, dass ihr Kult älter ist als die altgriechische Kultur. Zur mythischen Figur wird sie in Verbindung mit ihrer gemeinsam mit ▸ Zeus gezeugten Tochter Persephone (lat. Proserpina, gr. auch Kore = Mädchen, Jungfrau genannt): Hades (lat. Pluto), der Gott der Unterwelt, verliebt sich in Persephone und entführt sie als seine Gattin in sein unterirdisches Reich. Demeter vermisst sie und lässt sich nach erfolgloser, über die ganze Erde ausgedehnter Suche einen Tempel in Eleusis (in der Nähe Athens) errichten, in den sie sich zur Trauer über die verlorene Tochter zurückzieht. Dadurch schwindet alle Fruchtbarkeit, die Erde verdorrt, und die Menschen drohen zu verhungern. In dieser Notlage und durch die Klage Demeters bewegt entscheidet Zeus, dass Persephone aus der Unterwelt zurückkehrt, sofern sie dort noch nichts gegessen hat. Da sie jedoch schon von einem Granatapfel gekostet hat, läuft es auf die Vermittlung hinaus, dass sie einen Teil des Jahres bei ihrer Mutter auf der Erde, den anderen Teil bei ihrem Gatten in der Unterwelt verbringt. Durch diese Lösung erklärt der Mythos den Wechsel der Jahreszeiten: Nähe und Ferne der Tochter bedingen durch Glück und Unglück der Demeter den Zustand der Vegetation. Kultisch ist der Mythos mit den ‚Mysterien von Eleusis’ verbunden, einem bis ins 4. Jh. n. Chr. belegten Ritus, der im Sommer die jährliche Wiederkehr der Persephone feiert. Als Demeter-Gottesdienst war er eines der ältesten und wichtigsten religiösen Feste im antiken Griechenland, dessen Zeremonie sich in eine zahlreiche Öffentlichkeit und den Mysterienkult eines elitären Kreises priesterlicher Geheimnisträger teilte. Literarisch ist der Mythos zuerst in der zweiten „Homerischen Hymne“ (an Demeter, 2. Hälfte des 6. Jh. v. Chr.) dokumentiert, wirkungsgeschichtlich wurde im Mittelalter und in der frühen Neuzeit jedoch die Erzählung in Ovids ▸ Metamorphosen (1 v. – 10 n. Chr., V, 341–571) relevant.
Die christlichen Ovid-Auslegungen des Mittelalters deuten Proserpina allegorisch als Bild für die Seele, die vom Teufel (Pluto) in die Hölle entführt und von der Mutter Kirche gerettet wird (Ovide moralisé, Anfang des 14. Jh., V, 1833–3450). In der Renaissance und im Barock wird der Raub der Proserpina zum beliebten Sujet auf der Opernbühne (z.B. Claudio Monteverdi, Proserpina rapita, 1630, Jean-Baptiste Lully, Proserpine, 1680) und in der Malerei (u.a. Peter Paul Rubens, um 1620, Rembrandt, 1631/32, Luca Giordano, 1684–86, Fresko von Giovanni Battista Tiepolo im Palazzo Labia, Venedig, 1746), körperlich ausdrucksstark stellt Gian Lorenzo Berninis Doppelstatue von 1621/22 den männlichen Frauenräuber und das sich wehrende weibliche Opfer dar. In dieser Tradition der höfisch-mythologischen Unterhaltung steht auch noch Johann Wolfgang Goethes Monodrama Proserpina (1778), das aus einem Trauermonolog der gerade in die Unterwelt Entführten besteht. Ihre Mutter Demeter/Ceres erscheint in bildlichen Darstellungen dagegen kaum in mythischen Szenen, sondern vor allem in der (allegorischen) Funktion als Fruchtbarkeitsgöttin, was durch typische Attribute wie Ährenkranz oder Ährengarbe, Füllhorn und Früchte zum Ausdruck kommt. Ein Bild von Giorgione (Ceres, 1500–1510) zeigt sie indes in der Trauer um ihre Tochter.
Einen neuen Impuls gibt die Wiederentdeckung der zweiten „Homerischen Hymne“ im Jahr 1777, der schon 1780 die erste deutsche Übersetzung durch Christian Graf zu Stolberg folgt. Durch sie kommt der Demeter-Kult neu ins Bewusstsein. Resonanzstarken Ausdruck findet er in Friedrich Schiller Gedicht Das Eleusische Fest (1799), das Ceres, „die beglückende Mutter der Welt“, wie sie hier im Schlussvers heißt, als Kulturstifterin preist. Sie zivilisiert die Menschen vom blutigen Jagdtrieb zum friedfertigen Ackerbau. In dem vorausgehenden Gedicht Klage der Ceres (1797) schildert Schiller das Schicksal der Proserpina so, dass man es zugleich als Allegorie der Pflanzen verstehen kann: Sie gehören zugleich dem oberirdischen Licht und mit den Wurzeln dem Unterirdischen an, ihre lebendige Gestalt vergeht zum ‚toten‘ Samen, aus dem am Licht wieder neues Leben keimt. Die intensivste Fortsetzung findet das neue Interesse am Demeter-Persephone-Mythos dann in der englischen Literatur des 19. Jh. Das Proserpine-Drama (1820) von Mary und Percy Bysshe Shelley interpretiert den Stoff feministisch, indem die Mutter-Tochter-Beziehung programmatisch für Liebe und Leben, der Mann Pluto dagegen für Tod und Gewalt steht. Zwei Gedichte von Algernon Charles Swinburne (Hymn to Proserpine, The Garden of Proserpine, 1866) sehen Proserpina dagegen vor allem als Gattin Plutos und damit als Göttin der Unterwelt und verklären in ihrer Gestalt den Tod zu einem sehnsüchtig gesuchten Ende. Der Essay The Myth of Demeter and Persephone (1875/76) des einflussreichen Kritikers Walter Pater verbindet beide Perspektiven, indem er in ausführlichem Rückgriff auf die zweite „Homerische Hymne“ die beiden Figuren als urtümliche Weltanschauung eines bäuerlichen Volkes deutet, das die Natur als Kreislauf von Tod und Wiedergeburt zu verstehen gelernt hat. In der Ambivalenz von Leben und Tod zeigt auch der Maler Dante Gabriel Rossetti seine Proserpine (acht Fassungen 1874–82) als blasse Schönheit mit vollen roten Lippen und glänzendem schwarzem Haar, einen angebissenen Granatapfel in der Hand.
Spekulative Altertumsforscher zur Zeit der deutschen Romantik sehen im Demeter-Persephone-Mythos das Zeugnis einer urtümlichen Religion, die das Göttliche nicht (wie in den Vaterfiguren ▸ Uranos, Kronos und ▸ Zeus) männlich und himmlisch, sondern weiblich und erdgebunden (gr. chthonisch) auffasst. So deutet der Philologe Friedrich Creuzer (Symbolik und Mythologie der alten Völker besonders der Griechen, 4. Teil, 1812) die Mysterien von Eleusis als einen dem olympischen Polytheismus vorausgehenden und ihn als Geheimlehre begleitenden Glauben, der in Demeter und Persephone seine grundlegende, mütterliche Gottesvorstellung habe und mit ihr auch die Lehre einer Wiedergeburt nach dem Tode. Das mythische Mutter-Tochter-Paar rückt in dieser Deutung in Analogie zur jüdisch-christlichen Vater-Sohn-Gottheit. In der außerordentlich stark rezipierten These von Johann Jakob Bachofen, dass der patriarchalen eine ursprüngliche matriarchale Kulturstufe vorausliege (Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, 1861), erscheint Demeter als „höchster Ausdruck der Gynaikokratie“ (Frauenherrschaft). Als „stofflich weibliches Naturprinzip“ bildet sie den Gegenpol zum männlich Geistigen. Der moderne Feminismus tritt zunächst kritisch gegen diese Deutung an und sieht im Demeter-Persephone-Mythos gerade kein Symbol der Frauenherrschaft, sondern eine von Männern betriebene Einschränkung der Frau auf die Mutterrolle (Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949, dt. Das andere Geschlecht, 1951).
In ihrem Essay Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution (1976) würdigt die amerikanische Dichterin Adrienne Rich den Mythos dagegen als „the essential female tragedy“, die zusammen mit der Unterdrückung auch den Widerstand und die Befreiung der Frau artikuliere.
LITERATUR
Helene P. Foley (Hg.): The Homeric Hymn to Demeter. Translation, Commentary, and Interpretative Essays. Princeton 1994
Andrew D. Radford: The Lost Girls. Demeter – Persephone and the Literary Imagination 1850–1930. Amsterdam 2007
Margot K. Louis: Persephone Rises, 1860–1927.
Mythology, Gender, and the Creation of a New Spirituality. Farnham/Burlington 2009 SM