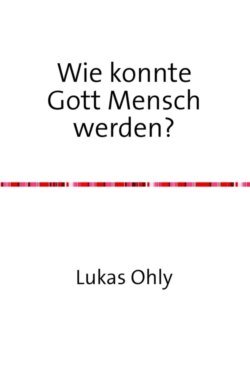Читать книгу Wie konnte Gott Mensch werden? - Lukas Ohly - Страница 10
Die lutherische Interpretation der Communicatio Idiomatum
ОглавлениеTexte Luthers: E. Hirsch: Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik; Berlin/Leipzig 1937 (im Folgenden H abgekürzt)
Konkordienformel: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (BSLK); Göttingen 198610 (739–1100), 805–812, 1017–1049
Die Communicatio Idiomatum, also die Gemeinschaft der Eigenschaften zwischen der göttlichen und der menschlichen Natur in Christus, ist seit dem Mittelalter ein Modell gewesen, um die differenzierte Einheit Christi zu bestimmen. Dennoch bedurfte sie in der Reformationszeit einer Revision. Anlass war der sogenannte Abendmahlsstreit zwischen Martin Luther und Huldrych Zwingli. Beide debattierten darüber, ob Christus in seiner menschlichen Natur beim Abendmahl anwesend sei, wenn es in den Einsetzungsworten heißt: „Das ist mein Leib.“ Seine persönliche Gegenwart beim Abendmahl stand dabei außer Frage. Zwingli betonte die geistliche Präsenz Christi beim Abendmahl und meinte deshalb, dass Christi Leib nicht real in Brot und Wein sei.[35] „Das ist mein Leib“ sei „non naturaliter sed significative“[36] zu verstehen. Dagegen hat Luther auf die sogenannte Ubiquitätslehre zurückgegriffen, um die leibliche Präsenz Christi beim Abendmahl zu erklären. Bei der Ubiquitätslehre handelt es sich um die Vorstellung, dass der erhöhte Christus nach seiner göttlichen Natur allgegenwärtig ist und deshalb auch überall sein kann, wo er will (H 38). Dies gelte auch für Christus nach seiner menschlichen Natur, weil beide Naturen in einer Person vereint seien (ebd.). „Aus dieser Wahrheit des zwiefachen Wesens … und der Einheit der Person folgt jene sogenannte Communicatio Idiomatum … also daß das, was des Menschen ist, mit Recht von Gott, und wiederum, was Gottes ist, vom Menschen gesagt werde … Man sagt in Wahrheit: Dieser Mensch hat die Welt geschaffen, und dieser Gott hat gelitten, ist gestorben, begraben usw.“ (H 39f.).
Aus diesem Unterschied zwischen Zwingli und Luther entwickelten sich bei beiden konfessionellen Richtungen unterschiedliche Varianten der Communicatio Idiomatum.
1. Einig waren sich beide Richtungen, dass alles, was von Christi Person gesagt werden könne, auch von ihren Naturen gelte, auch wenn eine Natur für sich selbst genommen diese Eigenschaft nicht habe. Auch wenn also die Gottheit oder göttliche Natur nicht leiden kann, hat sie in Christus gelitten. Dies nennt man das genus idiomaticum, die Gemeinschaft der Eigenschaften in Form ihrer Übereignung auf die Person Christi.
2. Einig waren sie sich auch, dass beide Naturen in ihren jeweiligen Eigenschaften am Heilswerk Christi teilnehmen, und zwar in Gemeinschaft mit der anderen Natur. Dies nennt man das genus apotelesmaticum, die Gemeinschaft der Eigenschaften in Form der Hervorbringung des Heils. Wenn Christus durch seine göttliche Natur Menschen heilte, so hatte seine menschliche Natur daran Anteil, auch wenn die menschliche Natur dazu selbst nicht fähig war. Die Konkordienformel, eine Schrift des Luthertums aus dem Jahr 1577, also 31 Jahre nach Luthers Tod, interpretiert das genus apotelesmaticum aber nicht im Sinne einer Synergie beider Naturen. Es ist also nicht so gedacht, dass Christus mit Hilfe der menschlichen Natur von Krankheiten heilen konnte, zu denen seine göttliche Natur allein nicht fähig gewesen wäre. Vielmehr gilt: „eine Natur wirket mit Gemeinschaft der andern, was einer jeden Eigenschaft ist“ (1031). Und doch hat nicht die göttliche Natur allein geheilt, sondern nur in Personeneinheit mit der anderen Natur.
3. Strittig war nur der eine Punkt, ob die menschliche Natur Eigenschaften der göttlichen Natur empfängt. Wenn Luther behauptet, der Leib Christi könne aufgrund seiner Ubiquität beim Abendmahl real präsent sein, so schreibt er dem menschlichen Leib Christi eine Fähigkeit zu, die nur für die göttliche gilt: allgegenwärtig sein zu können. Diese Eigenschaftsübereignung der göttlichen an die menschliche Natur in Christus nennt man das genus maiestaticum – weil die Eigenschaften der göttlichen Majestät an die menschliche Natur übertragen werden. Luthers Erklärung, warum Christus beim Abendmahl leibhaftig anwesend sein könne, entwickelte sich zum entscheidenden Streitpunkt, ob es das genus maiestaticum gebe oder nicht. Obwohl für Luther die Ubiquität Christi nur ein Behelfsmodell war und obwohl für Zwingli die Ablehnung der Realpräsenz Christi nicht in der Ablehnung der Ubiquität begründet war, entwickelten die lutherische und reformierte Theologie daraus den entscheidenden Differenzpunkt: „ob denn die Naturen in der persönlichen Vereinigung in Christo nichts anders oder nicht mehr denn nur allein ihre natürliche, wesentliche Eigenschaften haben“ (1032). Die Reformierten lehnten das genus maiestaticum ab. Die Lutheraner lehnten zwar auch ab, dass die Eigenschaften der menschlichen Natur an die göttliche Natur übertragen werden. Aber das Umgekehrte war für sie eine Bedingung, um die Realpräsenz Christi beim Abendmahl zu begründen: Christus ist beim Abendmahl leiblich anwesend, weil er allgegenwärtig sein kann. Und er kann allgegenwärtig sein, weil diese göttliche Eigenschaft auf die menschliche Natur übertragen wird, zu der auch die Leiblichkeit gehört.
Mit dem genus maiestaticum handelten sich die Lutheraner allerdings ein Folgeproblem ein: Wenn die menschliche Natur göttliche Eigenschaften empfängt, dann steht sie in Widerspruch zu sich selbst: Sie ist dann sterblich und unsterblich, leidensunfähig und hat trotzdem gelitten. In der Konsequenz droht ein Doketismus, weil dann Christus nur scheinbar gelitten haben kann. Denn weil es kein Gegenstück für das genus maiestaticum gibt, bei dem die menschliche Natur ihre Eigenschaften der göttlichen überträgt, besteht also eine klare Unterordnung in der Geltung der Naturen in Christus. Die göttlichen Eigenschaften, die der menschlichen Natur übertragen worden sind, dominieren dann die menschlichen Eigenschaften innerhalb der menschlichen Natur.
Um dieses Problem zu lösen, entwickelten die Lutheraner ein zeitliches Modell. Von seiner Geburt an bis zum Kreuzestod ging Christus in den Stand der Erniedrigung ein (status exinanitionis). In dieser Zeit hatte seine menschliche Natur zwar schon die Eigenschaften der göttlichen Natur (1021), aber sie machte keinen Gebrauch davon.[37] Nach der Erhöhung (status exaltationis) durch die Auferstehung hat Christus die Schwachheiten des Fleisches abgelegt und übt die göttliche Majestät vollständig aus.[38] Wird damit eine echte Lösung erreicht? Wenn doch die göttliche Natur schon seit der Geburt Christi ihre Eigenschaften auf die menschliche Natur überträgt, dann hat Christus also schon immer eine in sich widerstreitende menschliche Natur. Das Modell der beiden Stände (Erniedrigung und Erhöhung) versucht das Problem zu lösen, indem die Dominanz der göttlichen Natur über die menschliche Natur erst zeitlich später erfolgt. Die göttlichen Eigenschaften, die der menschlichen Natur seit der Geburt Christi übereignet worden sind, ordnen sich bis zu seinem Tod unter die Eigenschaften der menschlichen Natur unter. Der Widerspruch innerhalb der einen Natur soll durch ein wechselseitiges aber zeitlich sich umkehrendes Dominanz-Verhältnisses aufgelöst werden.
Terminologisch benutzt die Konkordienformel den Begriff der Erhöhung (exaltata) damit äquivok: Zum einen wird damit die Erhöhung Christi nach seiner Verherrlichung durch Auferstehung und Himmelfahrt gemeint, seitdem er zur Rechten Gottes sitzt: „daß die menschliche Natur … hernach durch die Vorklärung und Glorification erhöhet sei zur Rechten der Majestät“ (1021). Zum anderen wird aber auch die Übereignung der göttlichen Majestät an die menschliche Natur seit seiner Geburt „Erhöhung“ genannt: „Soviel nun diese Majestät belanget, zu welcher Christus nach seiner Menschheit erhoben (exaltatus), hat er solchs nicht erst empfangen, als er von den Toten erstanden und gen Himmel gefahren“ (ebd.).
Diese Äquivokation unterstreicht das Problem, die Eigenschaften der menschlichen Natur Christi ungleichzeitig zu denken, die gleichzeitig bestehen. Kann es überzeugen, dass die menschliche Natur Christi widersprüchliche Eigenschaften besitzt, von denen aber immer nur eine Seite in Anspruch genommen wird? Für leblose Gegenstände ist das undenkbar: Ein Stein kann nicht hart und weich zugleich sein, wenn er nur seine Weichheit gerade nicht in Gebrauch nimmt. Denn es gibt keinen Zustand, an dem der Stein überhaupt seine Eigenschaften in Gebrauch nehmen kann. Bei Personen dagegen kann man immerhin von ihren Tätigkeiten sagen, dass sie nur manche Eigenschaften in Gebrauch nehmen: Ein Sportler kann zugleich müde sein und seine Sportlichkeit nicht in Gebrauch nehmen. Dasselbe gilt für persönliche Möglichkeiten, die eine Person erleidet, die nicht alle realisiert werden können, aber zumindest einige: Eine Person kann nicht müde und munter zugleich sein. Welche Eigenschaft im Moment bei ihr realisiert ist, beruht aber nicht auf ihrer Entscheidung. Sie wird davon passiv ergriffen. Aber im Hinblick auf die widersprüchlichen Eigenschaften der menschlichen Natur Christi ist eine solche Entweder-Oder-Struktur spätestens bei Wesenseigenschaften nicht mehr gangbar. Denn hier handelt es sich nicht um mögliche Eigenschaften, sondern um notwendige, die in jedem Moment des Daseins realisiert sind: Christus ist nicht sterblich oder unsterblich, sondern sterblich und unsterblich. Wie kann er dann am Kreuz seine Unsterblichkeit nicht in Gebrauch nehmen? Bei diesem passiven Erleiden des Todes ist es wie mit dem Stein: Es gibt keinen Zustand, an dem Christus Wesenseigenschaften in Gebrauch nimmt, weil er sie nicht im Gebrauch realisiert, sondern im Sein. Das Dominanzmodell ähnelt dem Witz, dass eine Frau „ein bisschen“ schwanger sei.
Aber selbst wenn die Lutheraner eine ontologische Nachzeitigkeit erwogen hätten, wäre das Problem nicht gelöst. Wenn sie also behauptet hätten, dass die menschliche Natur Christi im Stand der Erniedrigung noch keine göttlichen Eigenschaften empfangen hätte, sondern erst im Stand der Erhöhung nach der Himmelfahrt, könnte Christus nur in widersprüchlicher Weise als Mensch zur Rechten des Vaters sitzen. Zudem wäre die menschliche Natur erst dann in Gottes Herrlichkeit eingegangen, wenn es sie schon nicht mehr gegeben hätte. Wir werden noch untersuchen, ob sich etwa die Reformierten dieses Problems wirklich entledigen konnten.
Noch eine weitere Spur legt die Konkordienformel, die das Problem der zwei Stände mit einer wichtigen ontologischen Differenz abmildert: Sie unterscheidet nämlich zwischen der menschlichen Natur und der „Knechtsgestalt“ Christi. Er hat „die Knechtsgestalt, ‚und nicht die Natur’ nach seiner Auferstehung ganz und gar hingelegt“ (808). Nachdem die knechtische Gestalt abgelegt worden ist, ist die menschliche Natur Christi zur Rechten der Majestät Gottes erhöht (1032f.). Versteht man „Knechtsgestalt“ als eine ontologische Kategorie ebenso wie den Naturenbegriff, so könnte verständlich werden, warum die göttliche Natur ihre Eigenschaften bis zur Himmelfahrt Christi nicht vollständig in der menschlichen Natur wirkt. Die „Knechtsgestalt“ wäre ein Trennungsstück zwischen den Naturen. Nachdem dieses Trennungsstück weggenommen worden ist, dominiert die göttliche Natur die menschliche Natur. Christus wäre jetzt im Stand der Erhöhung zwar nicht mehr sterblich, aber er wäre ja wirklich gestorben. Er wäre nicht mehr fleischlich, aber er hätte Fleisch gehabt. Er wäre zwar nicht mehr leiblich, aber aufgrund seiner allgegenwärtigen Räumlichkeit könnte er sich „in, mit und unter“ anfassbaren Medien räumlich und somit leiblich manifestieren. Der Leib Christi wird nach der Konkordienformel „mündlich“ empfangen, „doch nicht auf kapernaitisch[39], sunder übernatürliche, himmlische Weise“ (799). Es ist der Leib des Gekreuzigten, der nach Ablegung der Knechtsgestalt nur durch die Majestät der göttlichen Natur in Brot und Wein vermittelt wird: „denn kein Mensch das fürgesetzte Brot und Wein zum Leib und Blut Christi machet, sonder Christus selbst, der für uns gekreuzigt ist“ (998). Es wird also nicht bestritten, dass beim Abendmahl Brot und Wein empfangen wird (993), die durch die allgegenwärtige Majestät Christi zu seinem Leib werden. Die Knechtsgestalt ist damit ein wichtiges Verbindungs- und Trennungsstück, das, wenn es weggenommen wird, es schließlich erreicht, dass die menschliche Natur durch und durch von der göttlichen Natur durchdrungen ist und zugleich sie selbst bleibt, indem sie gewesen ist. Die menschliche Natur wird so nicht aufgelöst, denn sonst wäre die Geschichte Christi aufgelöst, oder die göttliche Natur hätte gelitten und wäre gestorben. Die Unterordnung der menschlichen Natur unter die göttliche wäre vielmehr geschichtlicher Art: Sie hat ewigen Bestand, weil sie gewesen ist. Im Stand der Erhöhung ist sie zwar nicht mehr sterblich, aber ihre Sterblichkeit hat sie geschichtlich realisiert und abgeschlossen.
Interpretiert man den Begriff „Knechtsgestalt“ ontologisch, so ist aber die Frage, woher sie kommt. Ist sie ein Werk der göttlichen oder der menschlichen Natur oder sogar ein Synergieeffekt von beiden? Mir scheint, dass sie ein Effekt beider Naturen ist. „Knechtsgestalt“ ist die geschichtliche Realisierung der menschlichen Natur im Stand der Erniedrigung der göttlichen Natur. Kommt diese geschichtliche Realisierung zum Abschluss, so ist die menschliche Natur nicht abgeschlossen. Abgeschlossen ist nur die Knechtsgestalt, aber auch sie ist als die geschehene bleibend wirklich. Zur menschlichen Natur dagegen gehört nicht nur das, was mit ihr geschehen ist, sondern was mit dem noch geschieht und geschehen wird, was geschehen ist. Sie ist also der Zukunfts- und Gegenwartsaspekt des Geschehenen. Deshalb hat die menschliche Natur über den Tod Christi hinaus Bestand. Und deshalb wirkt sie mit göttlichen Eigenschaften, die ihr übergeeignet sind.
Als Effekt der menschlichen Natur muss die Knechtsgestalt aber ontologisch etwas Eigenständiges sein. Denn sonst wäre das Trennungsstück zwischen den beiden Naturen innerhalb der menschlichen Natur zu finden, und der Widerspruch würde wiederkehren, dass die menschliche Natur Eigenschaften unterdrücken könnte, die ihr übergeeignet werden. Aber geschichtlich zu sein, kann auch als eine Eigenschaft der göttlichen Natur betrachtet werden. Deshalb ist die Knechtsgestalt ein Effekt beider Naturen und ihres gemeinsamen irdisch-geschichtlichen Vollzugs. Kommt dieser Vollzug zum geschichtlichen Abschluss, so bricht sie ab, und die Übereignung göttlicher Eigenschaften auf die menschliche Natur gelingt widerstandslos.
Die Unterscheidung von zeitweiser Knechtsgestalt und dauerhafter menschlicher Natur löst auch das Problem, das innerhalb des Luthertums aufgetreten ist unter dem Stichwort Krypsis oder Kenosis. Zwischen den Gießener und den Tübinger theologischen Lehrstühlen wurde im 17. Jahrhundert eine Debatte geführt, ob Christus im Stand der Erniedrigung (griechisch: Kenosis) seine göttlichen Eigenschaften nur verborgen hatte, sie aber im Verborgenen doch in Gebrauch genommen hatte (Krypsis), oder ob er sie wirklich abgelegt hatte, während er sie zugleich besaß. Hätte die göttliche Natur ihre Eigenschaften der menschlichen Natur in Knechtsgestalt übereignet, so wären die Widersprüche unvermeidlich, die innerhalb der menschlichen Natur auftreten würden. Die Krypsis löst also das Problem nicht, das mit dem genaus maiestaticum in die Christologie eingeht. Die Knechtsgestalt verhindert dagegen real, dass die göttliche Natur ihre Eigenschaften in der menschlichen Natur entfaltet, obwohl sie sie ihr schon übereignet hat. In der Knechtsgestalt wird der Effekt dieser Übereignung geschichtlich blockiert.