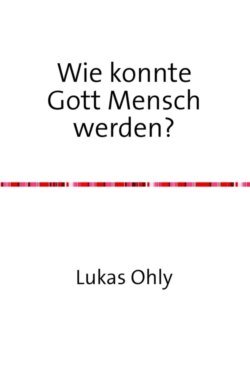Читать книгу Wie konnte Gott Mensch werden? - Lukas Ohly - Страница 6
Cyrill von Alexandrien – Untereinander angeordnete Naturen
ОглавлениеDaß Christus einer ist; in: Des heiligen Kirchenlehrers Cyrill von Alexandrien ausgewählte Schriften (hg. Otto Bardenhewer); München 1935, 111–204.
Zweiter und Dritter Brief des Cyrill an Nestorius; in: P-Th. Camelot: Ephesus und Chalcedon. Geschichte der ökumenischen Konzilien Bd. II; Mainz 1963, 225–228, 233–241, im Folgenden B abgekürzt
Die Übersetzung von Bardenhewer ist ausgesprochen ungenau, vor allem im Hinblick auf die zentralen Begriffe. So kommt in der Übersetzung der Personenbegriff vor, wenn er im griechischen Original fehlt, und umgekehrt. Der Hypostasenbegriff wird im Original der Schrift „Quod unus Christus sit“ fast ausschließlich benutzt, um die Gegenposition des Nestorius darzustellen. Dagegen wird der Ausdruck „Prosopon“ von Cyrill auch konstruktiv eingesetzt. Bardenhewers Übersetzung erweist sich damit als hochgradig interpretativ.
Ebenso ist es mit dem Begriff der Ähnlichkeit. In Bardenhewers Übersetzung ist der Logos einem Menschen nur „ähnlich“. Im Original kann das griechische Wort „Homoioma“ oder „Homoiosis“ aber auch „Gleichheit“ und „homoios“ „gleich“ heißen.
Es wird daher empfohlen, bei der näheren Beschäftigung den griechischen Text mit der Übersetzung zu vergleichen.[18]
In Cyrill von Alexandrien hat Nestorius einen erbitterten Widersacher gefunden, der politisch geschickt taktierte und daher auch in der christologischen Streitfrage beim Konzil in Ephesus im Jahr 431 den Sieg über Nestorius errungen hatte. Interpreten unterstreichen in der Regel, dass Cyrills Sieg diesem politischen Geschick geschuldet war und weniger seiner theologischen Stärke. Angeblich hatte er keine ordentliche Schulbildung.[19] Theologiegeschichtlich war sein Erfolg übrigens nicht nachhaltig: Allgemein wird das Konzil von Chalcedon von 451 als Korrektur betrachtet, die wieder ein Gleichgewicht zwischen der antiochenischen und alexandrinischen Position herstellte.[20] Grillmeier schätzt Cyrills Beitrag an der Bekenntnisbildung von Chalcedon sogar als gering ein.[21] Gleichwohl hat der zweite Brief Cyrills an Nestorius für die katholische Dogmenbildung höchsten kanonischen Rang[22], und in Lehrbüchern findet man die Formulierung, Cyrills Position sei in Chalcedon als orthodox akzeptiert worden.[23]
Cyrill betonte die Einheit Christi so stark, dass es ihm den Vorwurf einbrachte, die göttliche und die menschliche Natur zu einer Natur zu verschmelzen. Wir haben also hier zu prüfen, ob dieser Einwand ihn trifft oder ob Cyrill die Einheit Christi darstellen kann, ohne aus ihm etwas Drittes neben Mensch und Gott zu machen. Dabei war Cyrill nicht immer terminologisch scharf. Er konnte davon sprechen, dass Christus eine Natur hatte, und an anderen Stellen, dass er aus zwei Naturen sei.[24] Dann wiederum sprach er davon, dass die Einheit Christi in seiner Personalität bestehe (118, 149, an dieser zweiten Stelle benutzt Cyrill den griechischen Begriff Prosopon).
Dreh- und Angelpunkt seines christologischen Modells ist der Begriff der Natur. Cyrill scheint die christologische Problematik auf der Ebene eines differenzierten Naturbegriffs lösen zu wollen. Nach meinem Eindruck ist dieser Ansatz bisher nicht ausreichend gewürdigt worden. Aber wenn Cyrill oftmals den Naturbegriff unterschiedlich verwendet, so scheint dies daran zu liegen, dass er sich jeweils auf Unterschiedliches bezieht. Die Natur (griechisch physis) ist die Kategorie des Wesens einer Sache und oft vom Wesensbegriff (ousia) nicht zu unterscheiden. Denn es ist die Natur, die einen Gegenstand zu dem macht, was er ist. Nun kann aber nicht nur von der Natur eines Gegenstandes gesprochen werden, sondern auch von der Natur einer Art oder einer Gattung. Damit koexistieren Naturen auf unterschiedlichen ontologischen Ebenen. Cyrill kann also von der göttlichen Natur (117 und öfter) sprechen und sie von der Natur des Sohnes Gottes unterscheiden, obwohl auch der Sohn göttlicher Natur ist. Cyrill schreibt von der zweiten trinitarischen Sohn, dem göttlichen Logos (Wort), dass „das eingeborene Wort Gottes Gott war und der Natur nach aus Gott stammte“ (117f.). „Der Leib, der den Tod gekostet hat, war nicht irgendeines andern, sondern vielmehr dessen Leib, der der Natur nach Sohn war“ (125). Ganz deutlich unternimmt Cyrill also eine Differenzierung zwischen der Natur Gottes und der Natur des Sohnes. Obwohl der Sohn göttlicher Natur ist, hat er zugleich eine andere Natur als Gott der Vater. Denn sonst könnten beide nicht unterschieden werden. Cyrill benutzt also den Naturbegriff unterschiedlich, je nachdem auf welcher ontologischen Ebene sich der Gegenstand befindet, über den er spricht.
Zu den Voraussetzungen dieses Ansatzes gehört also, dass der Ausdruck „Gott“ ein Artbegriff ist, der drei Einzeldinge umfasst, nämlich Vater, Sohn und Heiligen Geist. Art und Einzelding haben zwar in manchen Hinsichten die gleichen Eigenschaften, unterscheiden sich aber doch auch voneinander hinsichtlich einziger Eigenschaften. Vergleichen wird Cyrills Argumentation mit der Differenz von „Frau“ und „Mensch“. Alle Frauen sind Menschen, aber nicht alle Menschen sind Frauen. Der Ausdruck „Mensch“ bezeichnet die Art, die aus Frauen und Männern besteht, während Frauen und Männer die Einzeldinge dieser Art darstellen. Logisch gilt nun, dass alles, was von der Art gesagt werden kann, auch vom Einzelding gesagt werden kann: Wenn der Mensch sterblich ist, so ist die Frau auch sterblich. Ebenso ist es, wenn man „Gott“ als Artbegriff versteht und die trinitarischen Personen in ihn einordnet: Wenn Gott unwandelbar ist, so ist auch der Sohn unwandelbar. Dasselbe gilt von dem Verhältnis der Einzeldinge zueinander, wenn sie über das Verhältnis zur Art bestimmt werden: Wenn Gott der Artbegriff ist, dann sind Vater und Sohn auch Gott. Dann ist der Sohn des Vaters auch Sohn Gottes, weil der Vater (genau wie der Sohn) Gott ist.
Anders ist es aber, wenn umgekehrt von einem der Einzeldinge gesprochen wird: Wenn Gott der Sohn vom Vater gezeugt ist, so ist damit nicht die Natur Gottes gezeugt, sondern eben nur die Natur des Sohnes. Dennoch schließen sich die Natur des Sohnes und die Natur Gottes nicht aus. Denn wenn die Natur Gottes Vater oder Sohn oder Geist ist, dann ist auch die Natur des Sohnes Vater oder Sohn oder Geist. Vergleichen wir dieses Verhältnis wieder mit der Beziehung aller Frauen zur Art Mensch: Wenn ein Lebewesen zur Art Mensch gehört, dann ist es entweder eine Frau oder ein Mann. Zur Natur des Menschen gehört es also, Frau oder Mann zu sein. Oben haben wir schon gesagt, dass alles, was von der Art ausgesagt werden kann, auch vom Einzelding ausgesagt werden kann. Folglich gehört es auch zur Natur einer Frau, dass sie eine Frau ist oder ein Mann. Das klingt zwar merkwürdig und scheint intuitiv wenig einleuchtend zu sein, erfüllt aber das logische Gesetz der sogenannten Addition[25]. In anderen Alltagssituationen ist aber diese Disjunktion durchaus üblich. Der Satz „Ich werde Marie am Dienstag oder am Mittwoch besuchen“ ist wahr, wenn ich Marie am Mittwoch besuche. Er bleibt auch wahr, nachdem ich sie am Mittwoch besucht habe. Das heißt also, dass die Disjunktion „am Dienstag oder Mittwoch“ auch dann wahr ist, wenn nur eine von beiden Optionen gezogen wird. Ebenso kann man von Frauen aussagen, dass sie Frauen oder Männer sind. Und ebenso kann man dann von Gott dem Sohn sagen, dass er Vater oder Sohn oder Geist ist. Wenn also zur Natur Gottes gehört, Vater oder Sohn oder Geist zu sein, dann kann dasselbe also auch vom Sohn ausgesagt werden. Deshalb erfüllt die Natur des Sohnes alles, was von der Natur Gottes ausgesagt werden kann – und zwar obwohl der Sohn zugleich eine eigene Natur hat, nämlich die Natur des Sohnes. Für Gott trifft nicht zu, dass er die Natur des Sohnes hat, weil auch der Vater und der Geist mit ihrer je eigenen Natur die Natur Gottes besitzen.
Welche spezifische Eigenschaft hat nun der Sohn, die der Vater und der Geist nicht haben? Entscheidend scheint für Cyrill die Eigenschaft zu sein, der Eingeborene zu sein: „Es wäre sehr verfehlt und ein Zeichen krankhaften und weit abirrenden Geistes, zu glauben, die unaussprechliche Wesenheit des Eingeborenen sei eine Frucht des Fleisches gewesen. Er war vielmehr als Gott gleichewig mit dem zeugenden Vater und aus ihm der Natur nach in unaussprechlicher Weise geboren“ (116).[26] Zur Natur des Sohnes gehört also alles, was er von Ewigkeit her besitzt, nicht erst durch die Vereinigung mit der menschlichen Natur. „Der Eingeborene war also der Natur nach nicht uns gleich, ist aber dann, wie es heißt, uns gleich, das ist Mensch geworden“ (128). Die Einheit des Menschgewordenen darf dabei nicht zu einer Änderung der Natur führen, und auch die Personeneinheit, die hypostatische Union, die Cyrill vorschlägt (B 226, B 235, B 241), darf der Natur des Sohnes nicht äußerlich bleiben. Das heißt, dass Personalität zur Natur des Sohnes gehört. Der Logos ist auch nach der Menschwerdung natürlich geblieben (148, 152). Folglich muss es an der besonderen Natur des Sohnes liegen, die Einheit mit der menschlichen Natur zu bilden. Dies leistet die menschliche Natur über das Geborensein. Wenn nämlich zur Natur des Sohnes gehört, der Eingeborene zu sein (116), dann ändert sich nichts an ihm, wenn er nun auch als Mensch von Maria geboren wird. Sie ist daher zu Recht Gottesgebärerin (theotokos) zu nennen (118). Christus hat nicht eine Natur nach der Fleischwerdung, sondern in der Menschwerdung ist er Gott geblieben und auch alles, was ihm der Natur nach zukam (142, 152).
Christus ändert also seine Natur als Sohn Gottes nicht, wenn er geboren wird. Denn das Geborensein ist eine Eigenschaft seiner Natur als Sohn Gottes. Geborensein gehört zwar nicht zur Natur Gottes, aber eben zur zweiten Hypostase der Trinität. Damit scheint Cyrill auch die Frage beantworten zu wollen, wie Christus darüber hinaus auch Mensch werden kann, obwohl er die Natur des Sohnes Gottes besitzt. Er ist Mensch, weil es zu seiner Natur gehört, geboren zu sein. Also kann er offenbar auch als Mensch geboren werden. Folgt man dieser Argumentation, so hätte Christus seiner Natur nach auch als Tier geboren werden können. Nicht als was er geboren wird, ist seiner Natur inhärent, sondern dass er geboren wird.
Spricht Cyrill dagegen vom Menschsein Christi, so schwächt er die Einheit hier ab: Der Sohn Gottes hat die menschliche Natur „angenommen“ (145), er ist erschien in menschlicher „Hülle“ (118; im Griechischen steht „Schema“, was „Form“ oder „Gestalt“ heißen kann). Die Personeneinheit der beiden Naturen wird über die spezifische Natur des Sohnes organisiert, ohne dass sie aber die Eigenschaften der menschlichen Natur besitzt. Cyrill vertritt also keine „Mia Physis“-Lehre, also keine Lehre, wonach die göttliche und menschliche Natur zu einer Natur verschmolzen oder die menschliche in der göttlichen Natur integriert worden sei. Cyrill stand öfter unter dem Verdacht, eine solche Lehre vertreten zu haben, und auch Monophysiten haben sich auf Cyrill berufen.[27] Sehr wohl aber hat Cyrill die Einheit der beiden Naturen über den Naturbegriff bestimmen wollen, nämlich über die spezifische Natur des Sohnes. Damit lässt sich die Gefahr abwehren, dass die Personeneinheit eine unwesentliche Einheit wird, weil die Person dann aus der Natur ausgenommen werden müsste. Es bleiben zwei Naturen, aber es liegt an der Natur des Sohnes, dass sie eine Einheit werden. Die Einheit wird über die Eigenschaft des Geborenseins organisiert, die der zweiten Hypostase gemäß ihrer besonderen Natur zukommt.
Die Personeneinheit ist deswegen möglich, weil die menschliche Natur Christi offenbar keine Personalität hat. Damit baut Cyrill eine Implikation der klassischen Anthropologie seiner Zeit um, die die Personalität der Natur zurechnet. Um sich von Nestorius abzugrenzen, betont er, dass Christus nicht in zwei Personen getrennt werden dürfe (174) und dass es keine Verschiedenheit der Personen gebe (142). Es werde auch in der Einigung der Naturen kein zweites Prosopon hinzugefügt (B 226). Anstelle einer Mia-Physis-Lehre vertritt Cyrill also eher eine Mia-Hypostasis-Lehre[28], ohne allerdings darin terminologisch explizit zu sein. Wie ist dieser Umbau gerechtfertigt außer über eine theologisch geschuldete Willkür? Wenn doch jeder Mensch aufgrund seiner Natur eine Personalität besitzt, so kann sie bei Christus nicht fehlen, ohne dass seine menschliche Natur defizitär wäre. Er wäre dann doch nicht wahrer Mensch, sondern hätte nur menschliche Gestalt. In diesem Fall droht ein Doketismus. Nestorius konnte das Problem dadurch lösen, dass die göttliche und die menschliche Personalität im Phänomen des Gesichts ununterscheidbar werden. Dadurch war Christus zwar aufgrund seiner Natur zwei Personen, die aber phänomenologisch reduziert werden konnten. Cyrills Vorschlag läuft dagegen darauf hinaus, dass der menschlichen Natur nichts fehlt, wenn sie nicht selbst die Personalität ausprägt. Sie übernimmt vielmehr die Personalität der Hypostase des Sohnes. Der Sohn Gottes ist ja aufgrund seiner Natur der Eingeborene und kann daher auch in Maria geboren werden, ohne seine Natur zu verändern. Die Person des Sohnes wird daher auch von Maria geboren, weil er seiner Natur nach der Eingeborene ist. Somit fehlt der menschlichen Natur nichts, weil sie durch die Geburt eine Personalität besitzt.
Der Sohn Gottes teilt daher mit dem Menschen die Eigenschaft des Geborenseins und kann deshalb auch Mensch werden. Nicht aber wird er menschliche Natur. Die menschliche Natur bleibt ihm äußerlich. Wie aber verhält sich die menschliche Natur zur Natur des Sohnes?